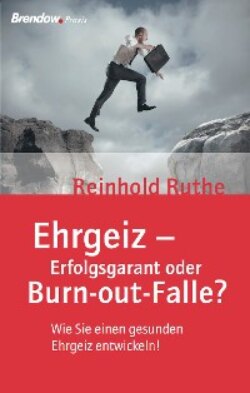Читать книгу Ehrgeiz - Erfolgsgarant oder Burnout-Falle? - Reinhold Ruthe - Страница 7
Kapitel 1
ОглавлениеWie kann die „Triebfeder Ehrgeiz“ entstehen?
Ehrgeiz ist ein vielschichtiges Problem, das seine Wurzeln häufig in der Kindheit hat. Viele Gründe und Motive spielen bei der Entstehung eine Rolle. Schon in den siebziger Jahren schrieb die bedeutende Kindertherapeutin Christa Mewes über den Ehrgeiz:
„Kinder, die in der sozialen Phase, in der Vier- bis Fünfjährigkeit, gestört sind, neigen zu Störertum, Angeberei und übertriebenen Ehrgeizhaltungen. Folgen der Gehemmtheit sind Zustände des Versagens und zusätzliche Entmutigungen. […] Man sieht, wie gerade auf dem Boden einer Geschwisterbewunderung eine umso hartnäckigere verdrängte Eifersucht heimlich wuchert und als Einnässen und Ehrgeiz sichtbar wird. […] Diese Bedenken gegen den Ehrgeiz beruhen darauf, dass das Fundament, auf dem so ein Kind seinen Lebensaufbau beginnt, zu schmal ist. Die Isoliertheit und das unterschwellige Gefühl, ungeliebt zu sein, pflegen sich im Laufe der Zeit zu immer stärkeren Kontaktschwierigkeiten auszuweiten. Ehrgeizige Kinder werden in Gemeinschaft als Streber und Tugendpinsel verlacht und missachtet.“4 Mewes stellt hier heraus, dass Ehrgeiz Folge eines elterlichen Fehlverhaltens sein kann. Ihre wichtigsten Punkte lauten:
Eltern, die ein ehrgeiziges Kind vorziehen, können ein anderes entmutigen und ins Abseits drängen;
Vernachlässigte Kinder können durch Angeberei und Ehrgeiz auf sich aufmerksam machen wollen;
Geschwisterbewunderung kann Eifersucht, Einnässen und Ehrgeiz hervorrufen;
Ehrgeiz kann zu Kontaktstörungen und zur Isolation beitragen.
Aufgedrängte Motivation führt zu falschem Ehrgeiz
Wie kommt es, dass manche Kinder ein besonderes Interesse am Lernen zeigen? Wie kommt es, dass andere desinteressiert und demotiviert sind?
Das Wort „Motiv“ ist abgeleitet von dem lateinischen Wort bewegen.
Motivation ist der Beweggrund zum Handeln. Motivation ist das Antriebselement zum Wollen. Durch Gewöhnung, Lernen, Automatisierung entstehen sogenannte sekundäre Motivationen. Wir alle kennen das Sprichwort: „Kinder müssen mit Zuckerbrot und Peitsche erzogen werden.“ Das ist altmodisch, das ist überholt. Das entspricht nicht modernen Erziehungsprinzipien. Durch Zwang entsteht eine Motivation, die von außen kommt, die aufgedrängt wird.
Wichtig ist eine Motivation, die von innen kommt. Das versetzt den Menschen in die Lage, aus eigenem Antrieb, aus eigener Überzeugung Aufgaben anzupacken. Es ist lohnend und befriedigend, wenn wir aus innerer Motivation etwas erreicht haben.
Ohne Vertrauen keine Motivation
So lautet die Überschrift eines Interviews, das mit dem Bahnchef Dr. Rüdiger Grube und mit dem Fußball-Bundestrainer Joachim Löw geführt wurde. Der Bahnchef beschreibt Motivation so: „Sie müssen die Begeisterung vorleben. Ich sage immer:, Wer für eine Sache nicht selbst brennt, kann andere auch nicht anzünden.‘ Das schafft Vertrauen, und ohne Vertrauen gibt es keine Motivation.“
Und Joachim Löw, der Fußball-Bundestrainer, antwortete auf die Frage nach den wichtigsten Elementen der Motivation Folgendes: „Zuerst muss ich als Trainer eine klare Vorstellung von dem haben, was ich erreichen will. Ich brauche ein Ziel, einen roten Faden. Der nächste wichtige Schritt ist die Transparenz. Dann wollen die Menschen auch mitarbeiten, weil sie sich zu Recht ernst genommen fühlen.“5
Das macht deutlich: Nur, wer Vertrauen schenkt, verhindert Eifersucht und Neid in der Gruppe. Begeisterung steckt an. Sie beflügelt und reißt andere mit. Nur, wer auf Rivalität und Ehrgeiz verzichtet, kann ein gemeinsames, großes Ziel erreichen.
Das klingt überzeugend und positiv, und doch bleiben Unzählige in der Wirtschaft, in der Schule, im Fußball, in der Firma und sogar in der Gemeinde hinter diesen hehren Zielen zurück.
Und noch eine weitere Gefahr besteht, nämlich dann, wenn der Begeisterte und Mitreißende ein hochgradig Ehrgeiziger ist. Wenn der Mitgerissene nur die Macht des Motivators erlebt, nur sein Überlegenheitsstreben, sein Macht- und Geltungsstreben! Wenn er besessen davon ist, andere auszuspielen, andere zu besiegen und selbst als der Erste und Beste sich zu präsentieren! Wenn er in erster Linie nicht die Gruppe oder die Mannschaft oder die Familie sieht!
Andere Entstehungsmöglichkeiten für den Ehrgeiz
Aus der eigenen Praxis als Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche kann ich bestätigen, dass ehrgeizige Kinder zum ruhigen Genießen auch im späteren Leben nicht in der Lage sind. Sie finden oft keine Befriedigung in den Angeboten der Gegenwart. Sie müssen powern, sich bestätigen und brauchen ständig Erfolge, die aber über Nacht schon in Vergessenheit geraten – und das Erfolgsstreben geht von vorne los. Sie sind also ständig in Betrieb, ständig unruhig und immer beschäftigt. Ein Beispiel ist der verstorbene Apple-Chef Steve Jobs. Eine große Zeitung beschreibt sein Leben und sein Werk folgendermaßen:
„Immer besser sein – das wollen viele. Wirklich fast immer besser sind nur wenige. Es zu sein und es zu wissen muss auch als Bürde empfunden werden. Jobs hatte die Begabung wohl immer schon besessen, der brennende Ehrgeiz kam später dazu und verschärfte sich bisweilen ins Missionarisch-Freudlose. […] Amerikaner, die ihn besser kannten, bestätigen das., He was not a fun guy‘, lautet die freundlichste Beschreibung. Jobs Ernst, seine Spaßverweigerung, hatte etwas sehr Unamerikanisches.“6
Das zum Thema Genuss, Freudlosigkeit, mangelnde Gelassenheit und Zufriedenheit. Fehlen dann die Erfolge und die Leistungsnachweise, treten Missstimmungen, depressive Erschöpfungszustände, Krisen und Lebensenttäuschungen auf.
Für den übertriebenen Ehrgeiz sind auch Ängste und Minderwertigkeitsgefühle maßgebend. Angst ist ja der Grundzug im Menschen. Schon die Tiefenpsychologin Karin Horney sprach vor Jahrzehnten von „basic anxiety“, von der Fundamentalangst im Menschen. Je größer die Angst, desto größer und unrealistischer wird das Persönlichkeitsideal des Kindes. Plötzlich will es das schönste, das klügste und das beste sein. Es will Überlegenheit um jeden Preis. Leider spiegeln viele Ehrgeizige als Kinder und spätere Erwachsene Streit, Hass, Neid, Geiz, Unruhe und Affektgeladenheit wider.
Leider ist es so, dass die konstruktive und lebensbejahende Motivation, die den Menschen antreibt, mitreißt, in Aktion bringt, ihn zu Leistungen und Aufgaben ermutigt, immer wieder mit negativen Motiven und belastenden Einstellungen verknüpft ist. Der Ausdruck Ehrgeiz bringt das sprachlich auf den Punkt. Das wird auch im nächsten Kapitel deutlich.
Drei Grundmotive verstärken den negativen Ehrgeiz und die Gefahr des Burn-out-Syndroms
Dr. Martin Grabe, Psychiater und Psychotherapeut an der Klinik Hohe Mark, hat drei Grundursachen für das Burnout-Syndrom beschrieben. Er spricht
1. von „inneren Antreibern“,
2. von „äußeren Antreibern“ und
3. von mangelnden Fähigkeiten.
Als Beispiel für innere Antreiber nennt Grabe „fehlende väterliche Zuwendung“, die das „Anstreben besonderer beruflicher Erfolge“ zur Folge haben kann. „Fehlende mütterliche Zuwendung“ kann dazu führen, dass das Kind versucht, als „Helfer gemocht zu werden“. Auch „durch äußere Bedingungen wie Geschwisterkonstellation oder sozialen Status“ können nichterfüllte Wünsche zu inneren Antreibern werden und etwa zu „Leistungsorientierung, Konkurrenz“ führen.7 Grabe schreibt, dass es bei „inneren Antreibern“ immer um Anerkennung geht und um Gemochtwerden. Fehlen diese Voraussetzungen, können sich Anerkennungssucht, Karriere- und Geltungsstreben entwickeln.
Die „äußeren Antreiber“ können – nach Grabe – mit der Geschwisterrivalität zusammenhängen. Älteste Kinder geraten sehr früh in eine verantwortliche Rolle und handeln später oft sehr ehrgeizig und leistungsorientiert.
Auch bei jüngeren Geschwistern besteht die Gefahr einer zu starken Entwicklung des Ehrgeizes, wie Grabe erklärt: „Jüngere Geschwister haben dagegen mehr mit Rivalität zu tun, und Geschwisterrivalität im übertragenen Sinne kann im späteren Leben ebenfalls zum Burn-out-Motor werden. Denn es gibt immer noch jemanden, der etwas besser kann oder der beliebter ist, und man wird mit Konkurrenzkämpfen nie fertig, wenn man leicht darauf anspringt.“8
Zu den „äußeren Antreibern“ zählen im Sinne Grabes auch:
Primärer Stress: die eigentliche Arbeitsüberlastung,
sekundärer Stress: das Gefühl, preisgegeben zu sein,
finanzielle Sorgen und
zu hohe Ideale.
„Mangelnde Fähigkeiten“ sind:
Dass jemand seinen Aufgaben nicht gewachsen ist,
dass jemand Minderwertigkeiten empfindet, die wiederum mit den „inneren Antreibern“ zu tun haben.
Das sind eine Reihe von Motiven, die den Ehrgeiz befördern und die zur Überbeschäftigung, zum Karrierestreben und möglicherweise zur Selbstausbeutung führen und das Zusammenleben gefährden.
Noch eine Bemerkung:
Viele Ehrgeizige sind Arbeitstiere. Um trotz des Stresses zu mehr Ausgeglichenheit zu kommen, greifen sie auf beliebte Tricks zurück, etwa Ratgeber für mehr Ausgeglichenheit oder besseres Zeitmanagement. Doch wird dieses Ziel in der Regel nicht erreicht. Dazu formuliert Martin Grabe treffend: „Ein Arbeitstier nutzt alle diese Tricks (z. B. ‚simplify your life‘) nur dazu, sich noch mehr aufzuladen und noch mehr zu schaffen.“9