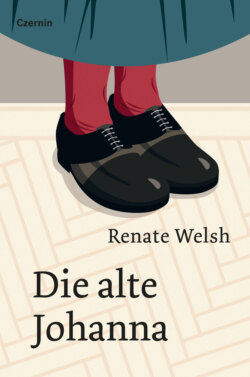Читать книгу Die alte Johanna - Renate Welsh - Страница 5
Vorwort
ОглавлениеSie wurde meine Nachbarin, als mein Vater 1965 das völlig verwahrloste alte Bauernhaus bei einer Versteigerung kaufte mit dem Auftrag »Machts was draus«. Es ging ihm vor allem um einen Ort, wo seine Enkel barfuß herumlaufen konnten. Ich stürzte mich voll Begeisterung, aber ohne die geringste Ahnung und ohne die nötigen Mittel in die neue Aufgabe und war mehr als dankbar, wenn die Nachbarin herüberkam und mir einen Handgriff zeigte oder einen Rat gab.
Sie war so ungeheuer kompetent in allen Dingen, es ging eine Sicherheit von ihr aus, die ich nur bewundern konnte. Es schien mir, dass ihr jeder Zweifel fremd und sie völlig eins war mit ihrer Rolle als Mittelpunkt einer großen Familie, und ich beneidete ihre Töchter um diese Mutter.
In meiner Erinnerung haben Gespräche lange Zeit vor allem auf den Besen gestützt beim Straßenkehren stattgefunden – in unserem Dorf musste jahrelang jede Hausfrau vor der eigenen Tür kehren, genauer gesagt den eigenen Gartenzaun entlang. Als ich noch neu im Dorf war, machte ich einmal den Vorschlag, die zwei Nachbarinnen könnten doch zu mir ins Haus auf einen Kaffee kommen, nachdem wir bestimmt schon eine Viertelstunde lang jede auf ihren Besen gestützt getratscht hatten. Das wurde jedoch entrüstet abgelehnt, dafür hätten sie nun wirklich keine Zeit.
Es muss im Frühsommer 1968 gewesen sein, dass ich meine Nachbarin fragte, ob sie mit mir nach Gloggnitz einkaufen fahren wolle. Da müsse sie sich erst anziehen, sagte sie. Ich hatte es eilig, meinte, das sei doch nicht nötig, ich würde mich sicher nicht umziehen, sondern fahren, wie ich war. Sie musterte meine Arbeitsjeans und den labbrigen Pullover. »Sie können sich das leisten, ich nicht«, sagte sie mit einer Endgültigkeit, die keinen Widerspruch duldete.
An den Satz und an mein Erschrecken erinnere ich mich genau, ich sehe sie und mich vor ihrer Haustür stehen, sehe, wie sie sich abwendet.
Der Satz zwang mich darüber nachzudenken, warum sie ihre Fenster öfter putzte als andere Frauen, warum sie nie anders als mit sauberer Kleiderschürze durchs Dorf ging, warum ihr Hof immer makellos gefegt sein musste. Seltsam ist, dass ich keine Erinnerung daran habe, wann sie mir zum ersten Mal ihre Geschichte erzählte, obwohl alle Einzelheiten dieser Geschichte in mein Gedächtnis eingeschrieben sind.
Sie war das uneheliche Kind einer Bauernmagd, die das uneheliche Kind einer Bauernmagd war, die das uneheliche Kind einer Bauernmagd war, aufgewachsen bei Pflegeeltern, die gut zu ihr, aber selbst arm waren. Nach Beendigung der Schulpflicht wollte sie eine Lehre machen, am liebsten als Schneiderin, die Gemeinde teilte ihr mit, das wäre nur dort möglich, wo ihre Mutter »zuständig war«. Im Glauben daran, dass etwas lernen vielleicht so gut wäre wie etwas haben, entschied sie sich wegzugehen, obwohl sie Angst davor hatte. Die Fürsorgerin lieferte sie im Gloggnitzer Armenhaus ab, wo der Armenrat ihre Zähne inspizierte, ihre Armmuskeln betastete und zufrieden feststellte: »Mager, aber zäh. Du bist also meine Dirn.« Sie versuchte sich zu wehren, erklärte, man hätte ihr doch versprochen, hier könne sie eine Lehre machen. »Das wäre ja noch schöner«, entrüstete er sich, »wenn ledige Kinder schon was wollen dürften!« Seit dieser Satz sie verletzt hatte, waren mehr als dreißig Jahre vergangen, dennoch war die Narbe noch nicht völlig zugeheilt.
Ich schnappte nach Luft. Gleichzeitig mit meiner Nachbarin sah ich meine acht Jahre ältere Schwester, die es nie verwunden hatte, dass mein Vater sich zwar zu ihr bekannt, ihr aber nicht seinen Namen gegeben hatte, die sich ihrer Mutter geschämt, sie verleugnet und später verzweifelt versucht hatte, dafür Abbitte zu leisten.
Wenn ledige Kinder schon was wollen dürften. Wenn man einem Menschen das Recht abspricht, etwas zu wollen, was bleibt da übrig? Ich begann zu ahnen, was meine Nachbarin zwang, sich und der Welt etwas zu beweisen. Wenn jemand Grund hatte, etwas zu beweisen, dann ganz gewiss nicht sie.
Dieser starken Frau, die ich bewunderte, von der ich so viel gelernt hatte, saß ihre Geschichte als Last im Nacken. Langsam entstand der Wunsch, ich könnte ihr das, was ihr widerfahren war, so zurückgeben, dass sie erkannte, wie stolz sie sein musste auf das, was sie aus dem Rohmaterial ihrer Erfahrungen gemacht hatte.
Ich begann zu recherchieren, erfuhr bald, dass ihre Geschichte auch die vieler anderer Frauen ihrer Generation war. Nie werde ich vergessen, wie mir eine Sechsundsiebzigjährige mit perfekt sitzenden drei weißen Locken links, drei weißen Locken rechts, hellgraues Twinset, die Füße genau parallel nebeneinander, die Hände im Schoß gefaltet, erzählte, wie sie mit 14 Jahren zu Fuß aus ihrem Heimatdorf in Niederösterreich zum Verein Christlicher Hausgehilfinnen in Wien gegangen war, wo ihr eine vornehme Dame eine Stellung angeboten hatte. Gleich in der ersten Nacht war der Sohn des Hauses in ihrer Kammer neben der Küche gestanden, es war ihr gerade noch gelungen ihn abzuwehren. Am Morgen hatte sie vor Scham und Verzweiflung stotternd die Dame des Hauses um einen Schlüssel gebeten. Die war empört gewesen: Was sie sich einbilde, warum stelle man überhaupt ein braves Mädel vom Land an? Irgendwo müssten die jungen Herren doch lernen!
Ich fragte meine Nachbarin, ob sie damit einverstanden wäre, wenn ich ein Buch über sie zu schreiben versuchte. Sie schüttelte den Kopf, zeigte auf die Bilder meiner Vorfahren in unserem Wohnzimmer. »Wer aus einer solchen Familie stammt, kann nie verstehen, wie es einer geht, die da herkommt, wo ich herkomme.« Ich war tief gekränkt, glaubte ich doch sehr gut zu wissen, wie es ist, sich nirgends zugehörig zu fühlen, immer anzuecken, ich wollte nicht daran erinnert werden, dass ich letztlich doch privilegiert war.
Einmal erzählte sie, dass die Dienstmägde die Kühe bis Allerheiligen barfuß hüten mussten. Kurz danach kam der Rauchfangkehrer sehr zeitig am Morgen zu mir. Wir hatten noch einen schliefbaren Kamin und nur eine wackelige Leiter. Ich hatte die halbe Nacht an einer Übersetzung gearbeitet und verschlafen, meine Hündin hatte wieder einmal sowohl meine Schuhe als auch meine Pantoffel versteckt, also musste ich in Socken die Leiter halten. Die Kälte tat weh, nicht nur in den Fußsohlen, der Schmerz stieg bis hinauf in die Zähne und in die Kopfhaut. Wenn die Mädchen damals gesehen haben, wie ein Kuhfladen in der kalten Luft dampft, dann war Ekel sicher ein Luxus, den sie sich nicht leisten konnten, dachte ich, sie sind bestimmt hineingestiegen und haben es genossen, die Zehen wieder bewegen zu können. Sobald der Rauchfangkehrer gegangen war, machte ich mir eine Notiz. Noch am selben Nachmittag kam meine Nachbarin herüber, weil ihr der Essig ausgegangen war. Ich hatte gerade Kaffee gekocht und bot ihr eine Tasse an. Plötzlich lachte sie. »Wenn Sie wüssten, was wir beim Hüten getan haben, würden Sie nicht die Füße mit mir unter einen Tisch stecken. Da würde Ihnen ja grausen vor mir.« Ich sprang auf und holte meinen Notizzettel.
»Wer hat Ihnen das gesagt?«
»Niemand.«
»Woher wissen Sie’s dann?«
»Ist mir logisch vorgekommen.«
Sie sah mich zweifelnd an. Wir schwiegen beide. »Na gut«, sagte sie, »wenn Ihnen das logisch vorkommt, dürfen Sie auch ein Buch über mich schreiben.« Von da an war sie bereit, alle meine Fragen zu beantworten.
Als ich versuchte, die private Geschichte in einen größeren Zusammenhang zu stellen, wurde mir klar, dass die zwanzig Jahre zwischen 1918 und 1938 so gut wie totgeschwiegen wurden, weil eine ehrliche Auseinandersetzung damit den Mythos von Österreich als unschuldigem ersten Opfer Hitlers infrage gestellt hätte. Ich recherchierte, las Zeitungen aus der Zeit. Bald erkannte ich, wie sinnlos es war, meine Nachbarin nach Ereignissen zu fragen, die nicht in der unmittelbaren Umgebung geschehen waren. Sie hatte keine Zeitung lesen, kein Radio hören dürfen, Nachrichten drangen nur durch den Filter des Dorftratsches zu ihr durch. Also musste ich Lokalnachrichten suchen und fand schließlich im Keller eines Heimatmuseums in den Blättern von Pfarren, Gewerkschaften, Brieftauben- und Kaninchenzüchtern sowie Lokalzeitungen nicht nur Material für meine Arbeit an Johannas Geschichte, sondern zu meinem Erstaunen in einem Fahndungsblatt mit dem Titel »Gritzner, auch deine Stunde kommt!« auch einen unerwarteten Gruß von meinem eigenen Ururgroßvater, der 1848 als Revolutionär in absentia zum Tode verurteilt worden war.
»Ich hätte so gern was gelernt«, sagte meine Nachbarin oft. Vielleicht war das der Unterschied zwischen ihr und vielen anderen. Sie war hungrig nach Wissen und neugierig bis zuletzt. Darüber hinaus hatte sie eine ganz erstaunliche Menschenkenntnis und aus dieser heraus einen untrüglichen Sinn für Anmaßung. Wenn wir beispielsweise Gäste hatten, die sie auch nur kurz gesehen hatte, gab sie Kommentare ab, die sich spätestens im Nachhinein als mehr als treffend erwiesen, selbst wenn ich sie zunächst als allzu kritisch abgelehnt hatte.
Bevor ich das Manuskript im Verlag ablieferte, wollte ich es meiner Nachbarin zeigen. Sie lehnte ab. »Ich hab es leben müssen, was soll ich es lesen auch noch!«
Ihre Familie las das Buch sehr bald nach Erscheinen und sie freute sich, als sie erlebte, wie ihre Enkeltöchter ihre Geschichte verstanden und ihr Mann zu mir sagte: »Vor dreißig Jahren hätten Sie das schreiben müssen, da wäre ich ihr ein besserer Mann gewesen.«
Sie blieb bei ihrer Weigerung. Erst nach dem Tod ihres Mannes sah ich sie eines Tages mit dem Buch in der Hand im Hof sitzen. Wie eine trächtige Katze schlich ich um sie herum, traute mich nicht sie anzusprechen. Schließlich hatte ich darin auch eine Protagonistin erfunden, weil ich sie brauchte als Gegengewicht zu einer anderen. Ihr einziger Kommentar war: »Ich weiß nur nicht, wieso du auch das geschrieben hast, was ich dir nicht erzählt habe.« Ein paar Jahre später sagte sie dann: »Wir müssten einen zweiten Band schreiben, der hört ja auf, noch bevor meine Älteste auf die Welt gekommen ist.«
Wir müssten ihn schreiben. Nicht: Du müsstest ihn schreiben. Ich zögerte, Fortsetzungen sind gefährlich, auch war ich in andere Projekte verstrickt.
Vor zehn Jahren ist sie gestorben, das Dorf hat seine Mitte verloren, eine Mitte, die am unteren Rand des Dorfes lag, knapp vor der Kurve, nach der die einzige Straße als Schotterweg über die Felder führt. Wenn ich mit den Nachbarn rede, fällt sehr bald ein Satz, von dem alle wissen, dass er von ihr stammt, jemand fragt, was sie zu dieser oder jener Sache wohl sagen würde, und alle nicken. Sie lebt nicht nur in ihren Kindern und Enkelkindern.
Als ich wieder einmal über sie nachdachte, schrieb ich den Satz: Sie hat bewiesen, dass ein Mensch mehr sein kann als die Summe dessen, was ihm widerfahren ist. Das ist zu kurz gegriffen, wie wahrscheinlich jeder Versuch, einen Menschen zu definieren. Sie war klug, großzügig, lebendig, stur, unbequem, neugierig, offen. Man konnte lachen mit ihr. Nie werde ich vergessen, wie wir nach einem ungeplanten Silvesterfest bei ihr auf dem Betondeckel ihrer Senkgrube Donauwalzer tanzten. Wir waren stolz darauf, dass sie uns mochte.
Ein Kind, das im Herzen seiner Eltern keinen Platz findet, findet auch keinen Platz in der Welt, schrieb Anna Freud. Ich glaube daran, dass es immer wieder Menschen gibt, die nebenbei und ohne zu suchen einen Platz für sich finden, indem sie Platz für andere schaffen. Sie hätte natürlich nur gelacht über eine solche Erklärung und gesagt, dass sie immer nur getan hat, was gerade notwendig war, »Du kannst schließlich Leute nicht wegschicken, wenn sie vor deiner Tür stehen«. An ihrer Selbstverständlichkeit konnten Herausforderungen auflaufen, egal wie unzumutbar sie sich gebärdeten. Ich habe also die Herausforderung angenommen, über die alte Johanna zu schreiben, trotz aller Bedenken. Ich habe versucht zu formen, was in ihren Erzählungen für mich gegenwärtig wurde, was ich beobachtet habe, was ich zu verstehen glaubte. Eine chronologische Ordnung habe ich nicht gesucht, Erinnerung geht ihre eigenen Wege. Für die Ordnung war sie zuständig, gegen diese Konkurrenz wäre ich nie angetreten.