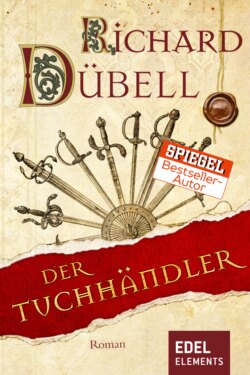Читать книгу Der Tuchhändler - Richard Dübell - Страница 8
2
ОглавлениеWenige Augenblicke später kehrte Hanns Altdorf er in Begleitung des Hauptmannes der Wappner zurück. Der gedrungene Mann hielt seine eigene Fackel in die Höhe und blickte sich ständig um, als wäre er von Feinden umgeben; sein Helm warf matte Reflexe und spiegelte das Fackellicht wider. Vor der Grube angekommen, straffte sich seine Haltung, und er machte eine exakte Ehrenbezeigung vor dem Richter und dem Kanzler. Den Polen ignorierte er, ebenso wie mich. Danach sah er von einem zum anderen; sein Gesicht wirkte gelassen, aber seine Haltung war angespannt. Die Anwesenheit der drei angesehenen Männer machte ihn unsicher.
»Ich danke Euch für Euer Kommen, Hauptmann Schermer«, sagte der Kanzler, als sonst niemand das Wort ergriff. Der Hauptmann nickte.
»Ihr habt Euch sicher gefragt, weshalb wir Euch und Eure Männer baten, die Kirche abzuriegeln«, fuhr Doktor Mair fort; und dann begann er, dem Hauptmann der Vilshofener Wappner das Garn aufzubinden, das wir zuvor gesponnen hatten. Ich beobachtete den Hauptmann: den Teil seines Gesichts, der unter dem weiten Helmrand zu sehen war. Er blähte die Nüstern und öffnete seinen Mund, als wolle er möglichst viele Sinnesorgane auftun, um die Nachricht zu empfangen. Daß er erfuhr, man wäre zufällig auf einen reichlich vom Feuer mitgenommenen Kirchenschatz gestoßen, war eine deutliche Ernüchterung. Sein Mund klappte beinahe hörbar zu, und seine Lippen schürzten sich, als wäre er enttäuscht. Sichtlich hatte er etwas Unerhörteres erwartet als ein paar geschwärzte, halb geschmolzene Monstranzen und Kelche, mochten sie auch noch so einen großen Wert darstellen. Ich dachte: Wenn du wüßtest, mein Freund, wenn du wüßtest; und war gleichzeitig erleichtert, als er keine Fragen stellte. Wir hatten uns zuwenig Zeit gelassen, um die holprigen Stellen in unserer Geschichte zu glätten, aber die tiefe Stimme des Kanzlers führte das Gedankenschiff des Hauptmanns sicher über die Untiefen hinweg in den Hafen, in dem wir es haben wollten.
»Herr Bernward hat große Erfahrung in solchen Dingen«, sagte der Kanzler und wies auf mich. Der behelmte Kopf ruckte kurz in meine Richtung und neigte sich nach hinten, so daß ich die zusammengekniffenen Augen sehen konnte, die mir einen unfreundlichen Blick zuwarfen. Er fragte nicht, worin meine Erfahrung bestehen könnte.
»Wir haben ihn gebeten, die Kostbarkeiten abholen zu lassen und zu untersuchen. Er wird seine Männer verständigen; bis diese ankommen, möchte ich Euch bitten, die Kirche weiterhin abzuriegeln.«
»Meine Männer können den Transport ebensogut übernehmen«, sagte der Hauptmann. Der Kanzler erstarrte einen Moment, und sein linkes Auge zuckte.
»Es wäre mir lieber, Ihr würdet Euch um die Leute draußen kümmern«, sagte er dann zögernd. »Ich könnte mir niemand anderen vorstellen, auf den ich mich in dieser Angelegenheit verlassen möchte.«
Der Hauptmann mochte einfach über die Ungereimtheiten in einer hastig vorgetragenen Geschichte hinwegzutäuschen sein, aber auf seinem eigenen Gebiet war er nicht so mühelos zu hintergehen; auch nicht mit dick aufgetragenen Schmeicheleien.
»Der Ausfall von zwei Männern wird meine Leute nicht so sehr behindern, als daß sie das Volk nicht auf Distanz halten könnten«, erwiderte er hartnäckig.
Doktor Mair schien ratlos. Ich mischte mich ein und sagte unfreundlich: »Meine Männer werden die Truhen abholen, Hauptmann. Sie sind absolut zuverlässig.«
Er schaute wieder zu mir hoch. Ich sah, wie er die aufsteigende Wut bekämpfte, und erwiderte seinen Blick, bis er sich abwandte.
»Wir werden so verfahren, wie wir es eben geschildert haben«, sagte der Kanzler geistesgegenwärtig. Der Hauptmann gab sich geschlagen.
»Ich gebe meinen Männern Bescheid«, sagte er heiser.
»Bitte behaltet für Euch, was Ihr erfahren habt«, sagte der Kanzler. »Wir wollen keine unziemliche Erregung unter den Bürgern und verfrühte Ansprüche der Nachkommen von etwaigen damaligen Besitzern.«
»Natürlich«, erwiderte der Hauptmann kurz und drehte sich auf dem Absatz herum, um die Kirche wieder zu verlassen. Er war nicht ein einziges Mal auf den Gedanken gekommen, in die Grube hinunterzuleuchten oder auch nur zu fragen, was um alles in der Welt der polnische Edelmann bei der Geschichte zu suchen hatte.
Manchmal scheint eine bestimmte Zeitspanne eine Ewigkeit zu währen; in Wahrheit sind jedoch nur wenige Augenblicke vergangen, und es wird einem schwindlig, wenn man sich unvermittelt des Umstandes bewußt wird, wie viele Ereignisse in wie kurzer Zeit abgelaufen sind. Als ich zum hinteren Seitenportal der Kirche hinaus ins Freie trat, war ich überrascht, daß es noch immer Nacht war. Noch immer wallte der Nebel in greifbaren Schwaden durch die dunkelblaue Finsternis, noch immer bildeten die wenigen Fackeln der Stadtknechte die einzigen, trübe blakenden Lichter, noch immer standen die Handwerker und ihre Bewacher wie regungslose, düstere Gestalten unter dem hochaufragenden Kirchenbau. Ich hätte schwören mögen, daß die Sonne schon hoch am Himmel stehen müsse, aber es war keinerlei Licht zu sehen, wenn man nach Osten blickte; kein noch so geringer Anschein der Dämmerung hob den steilen Lenghart vom Firmament ab oder die gedrungene Burg, die sich auf seinem Kamm erhob.
Vielleicht hatte die stumme Anwesenheit der Ermordeten unsere Gedanken beschleunigt; im nachhinein erschien es mir erschreckend und unglaubwürdig, was wir soeben besprochen hatten. Wenn die Seele der Toten noch am Tatort verweilt hatte, wie allgemein angenommen wird, was mochte sie sich über unser Gespräch gedacht haben? War sie voll hilfloser Entrüstung? Mir fiel ein, daß niemand auch nur ein Gebet für sie gesprochen hatte, und aus verschiedenen Gründen fühlte ich einen schmerzhaften Stich deswegen. Ihr Tod war zu einer so politischen Angelegenheit geworden, daß niemand einen Gedanken daran verschwendet hatte, daß ein Leben vernichtet worden war. Nicht einmal der polnische Ritter hatte ein Wort des Bedauerns ausgesprochen. Was hatte er gesagt? Der Tod der jungen Frau würde äußerst ernüchternd wirken. Ebenso ernüchternd war die Art und Weise, wie wir damit umgingen.
Ich wanderte ein paar Schritte unter dem vorspringenden Giebel des Portals hinaus ins Freie und drehte mich um. Die Strebepfeiler des Langhauses reckten sich ins Leere wie die Säulen im Inneren der Kirche. Ein paar der zunächst stehenden Wappner drehten sich zu mir um; da sie sahen, daß ich aus der Kirche gekommen war, wagten sie mir nicht näher zu kommen. Ihre Neugierde konnte kaum geringer sein als diejenige der Bauleute, die sie von der Kirche fernhielten. Ich war erleichtert, daß ich daran gedacht hatte, ihnen eine falsche Erklärung für die Vorgänge liefern zu lassen.
Ich bemerkte, daß ich gedankenverloren weitergegangen war. Ich hielt an und wartete, bis die anderen mir nachfolgten. Sie kamen zusammen aus der Kirche; sie hielten sich kurz neben dem Portal auf, dann schritt Albert Moniwid grußlos in Richtung auf das herzogliche Stadthaus davon, in dem sich das Lager der Polen befand. Der Kanzler wandte sich zum Friedhof der Kirche; wahrscheinlich wollte er durch die Widumsgasse um den Chorbau der Kirche herum zu seinem Haus zurückkehren und so den Menschen ausweichen, die sich vor dem Turm des neuen Doms auf der Altstadt drängten. Er hatte beinahe dieselbe Strecke wie Moniwid, aber die beiden gingen getrennte Wege. Doktor Mair nickte mir zum Abschied zu. Hanns Altdorfer und der Richter gesellten sich zu mir.
»Du wirst deine Männer selbst verständigen, nicht wahr?« fragte mich Altdorfer.
»Ich begleite sie sogar wieder mit hierher.«
Er dachte einen Augenblick nach.
»Ich glaube, du hast den Hauptmann beleidigt«, sagte er dann. »Mußtest du ihm so deutlich zu verstehen geben, daß du seine Leute für weniger zuverlässig hältst als deine eigenen?«
»Tue ich das?« fragte ich. »Hanns – ich habe das mit Absicht gesagt. Was glaubst du, was er seinem Leutnant oder seiner Frau oder meinetwegen auch nur irgendeiner Schlampe demnächst erzählt hätte? Sie wollten mir weismachen, daß ein Schatz in der Kirche gefunden wurde, würde er sagen; einer, der so wertvoll ist, daß keiner etwas davon erfahren soll, und doch haben sie diesen Krämer aus dem Säldental geholt, den keiner in der Stadt genau kennt, und ihm die ganzen Kostbarkeiten anvertraut. Ich glaube, daß daran etwas faul ist.«
Hanns Altdorfer zog die Augenbrauen zusammen. Ich ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»Was wird er jetzt sagen?« fuhr ich fort. »Er wird schäumen vor Wut und sagen: Sie haben einen Schatz in der Kirche gefunden, und sie wollten mir und meinen Männern nicht mal so weit vertrauen, daß wir ihn zu diesem Kaufmann außerhalb der Stadt tragen durften. Wahrscheinlich dachten sie, wir würden die Hälfte davon unterwegs selbst einstecken. Diesem Bernward vertrauen sie, den keiner kennt. Wir sind nur dazu gut, die Betrunkenen von der Straße zu kehren.«
Er sah mich an, dann lächelte er verkniffen.
»Ich denke, du hast recht«, sagte er. »Dennoch ist mir nicht wohl, wenn ich sehe, wie du einen schlichten Menschen, der nur seine Pflicht tut, manipulierst.«
Ich öffnete den Mund und wollte sagen: Was weißt du davon, doch dann schwieg ich. Er war mein Freund, und ich wußte, daß er die Wahrheit sprach. Es war eine Aussage, die auch Maria hätte tun können; oder Daniel, der in dieser Hinsicht schmerzhaft seiner Mutter glich. Nicht umsonst hatte sich mein Sohn seit langem von mir ferngehalten und beschränkte seine Besuche auf allzu wenige Gelegenheiten.
Hanns legte eine Hand auf meine Schulter.
»Ich habe es nicht böse gemeint«, sagte er. »Ich weiß, daß du das getan hast, was du für das Beste hieltest.«
»Schon gut«, sagte ich rauh.
Wir sahen zu Boden, und eines der seltenen peinlichen Schweigen zwischen uns entstand. Schließlich brummte der Richter: »Machen wir uns an die Arbeit.«
»Ja«, sagte ich. »Ich gehe und hole meine Männer. Was werdet Ihr tun?«
»Wir verwischen die Spuren«, sagte der Richter. »Wahrscheinlich ist der Boden unten in der Grube voller Blut und Stoffetzen, und wer weiß, wo sich noch überall Blutspuren befinden. Wir müssen sie beseitigen.«
»Was sagst du zu deinen Leuten?« fragte Hanns Altdorfer, der bei Girigels Worten noch ein wenig blasser geworden war.
Ich hatte es mir überlegt, noch als ich vorgeschlagen hatte, für den Abtransport der Leiche zu sorgen.
»Daß sie ein leichtes Mädchen war, das ich kenne und das umgebracht wurde – wir können das Offensichtliche wohl kaum verbergen. Daß du von der Bekanntschaft wußtest und mich benachrichtigen ließest, um mir einen Skandal zu ersparen; und daß ich für das Begräbnis sorgen will.«
»Werden sie Euch die Geschichte abnehmen? Ein leichtes Mädchen in Seidengewändern und Perlenstickereien?« fragte der Richter. Ich sah ihn an, und plötzlich erkannte ich, daß ich diese Kleinigkeit übersehen hatte. Ich biß die Zähne zusammen.
»Ihr habt recht«, sagte ich betroffen. Der Richter runzelte die Stirn.
»Wir werden ihr das Kleid ausziehen und es selbst aus der Kirche bringen«, sagte er nach einer Weile entschlossen. Hanns Altdorfer keuchte.
»Ohne mich«, stieß er hervor.
»Herr Notarius«, sagte Richter Girigel eindringlich. »Wir haben nun schon einiges auf uns genommen, um diesen Mord zu vertuschen. Wir dürfen nicht davor zurückschrecken, wenn wir die Geschichte Eures Freundes Bernward glaubwürdig machen wollen.«
Altdorfer verzog den Mund. Er sah nun kranker und erschöpfter aus als jemals zuvor.
»Wenn Ihr meint«, sagte er kläglich. Ich verspürte Mitleid mit ihm.
»Es tut mir leid«, murmelte ich. Er fuhr sich heftig über den Mund, als wolle er sich mit Gewalt daran hindern, sich zu übergeben. Seine Hand zitterte.
»Du hast gesagt, du willst die Männer nach dem Abtransport der Leiche sofort aus der Stadt schicken?«
»Noch an diesem Morgen. Mir wird schon ein Auftrag einfallen, der sie ein paar Wochen außerhalb Landshut festhält.«
»Wird das nicht auffällig sein?« erkundigte sich Richter Girigel. »Sie werden denken, daß sie genau aus diesem Grund weggeschickt werden.«
»Und wenn?« erwiderte ich achselzuckend. »Wichtig ist, daß sie nicht in der Nähe sind, solange der Fall nicht geklärt ist.«
»Irgendeinen Vertrauten unter deinen Leuten benötigst du«, sagte Altdorfer nüchtern. »Wo willst du die Leiche unterbringen?«
»Ich habe meinen Verwalter«, sagte ich einfach. »Er wird schweigen, weil er mir einen Skandal ersparen will. Kein Wort über unser Märchen wird je seinen Mund verlassen.«
»Hast du nicht einmal gesagt, du scheust davor zurück, ihm ein kompliziertes Geschäft anzuvertrauen?« fragte Hanns. »In dieser Angelegenheit willst du ihm jetzt vertrauen?«
»Das ist etwas anderes«, erwiderte ich steif. »Wenn es um eine persönliche Sache geht, würde er sich lieber umbringen lassen, anstatt mich in Verlegenheit zu bringen.«
»Wenn du meinst«, sagte er. Ich hatte nicht den Eindruck, ihn überzeugt zu haben. Er zögerte, als wollte er noch etwas hinzufügen, aber der Richter nahm ihn am Arm und drängte: »Laßt uns wieder hineingehen.«
Die beiden verabschiedeten sich von mir. Ich drehte mich um und machte mich auf den Rückweg. Inzwischen hatten sich die meisten der Handwerker wieder zerstreut und schlafen gelegt, in der sicheren Gewißheit, daß sie nichts zu sehen oder hören bekämen; und wenn es doch etwas Interessantes gab, dann würden sie es erfahren, weil einige von ihnen auf jeden Fall bei der Kirche ausharren würden, bis die Wappner verschwanden. Dafür waren einige der Scholaren und Lehrer aufgewacht, die man zugunsten der Wappner in einen Seitentrakt des Pfarrhauses umquartiert hatte und die nun von groben Händen entschlossen in den Eingang des Hauses zurückgedrängt wurden. Ich dachte, daß der Hauptmann diesen Zwischenfall bestimmt willkommen hieß, um sich abzureagieren.
Wie ich erwartet hatte, saß mein Verwalter in der Stube und hütete das Feuer. Er wäre nicht einmal zu Bett gegangen, wenn ich es ihm befohlen hätte. Ich setzte mich zu ihm und erklärte ihm mit ernstem Gesicht die Geschichte, die ich mir ausgedacht hatte. Ich hatte ein wehes Gefühl dabei, besonders als ich sah, wie sich seine Züge in einer Mischung aus Mitleid und Furcht um meinen Ruf in die Länge zogen. Er war nicht überrascht, daß ich angab, eine Frau in der Stadt besucht zu haben. Ich erkannte verblüfft, daß er die ganze Zeit über etwas Ähnliches von mir erwartet hatte und erstaunter gewesen wäre, wenn er die Wahrheit erfahren hätte: daß ich seit Marias Tod einen gramerfüllten Zölibat hielt. Als ich sagte, ich würde für ein ordentliches Begräbnis in aller Stille sorgen und meine Stimme dabei ungewollt überkippte, hielt er es für erneute Trauer um eine Frau, die ich geliebt oder für die ich zumindest Zuneigung empfunden hatte, und seine Augen wurden feucht. Er war noch nicht bei mir gewesen, als Maria starb, aber die Geschichte war ihm mit Sicherheit in allen Einzelheiten hinterbracht worden.
»Suche mir zwei von den Knechten aus, auf deren Schweigen man sich verlassen kann. Sie sollen mich zurück in die Stadt begleiten und den Leichnam hierherbringen, wo wir ihn bis zum Begräbnis aufbahren werden.«
»Wünscht Ihr, daß ich das Gesinde unterrichte und Gebete gesprochen werden?« fragte er, obwohl er sich die Antwort denken konnte. Als ich es verneinte und ihn darum bat, für ein Zimmer zu sorgen, das abgeschlossen werden konnte, nickte er nur stumm. Wenn er sich fragte, warum ich in aller Welt gerade einem käuflichen Mädchen meine Zuneigung geschenkt hatte und deshalb aus Angst vor einem Skandal meine Liebe in aller Stille begraben mußte, ließ er sich nichts anmerken.
»Niemand wird etwas erfahren.«
»Wenn die Knechte zurückkommen, möchte ich, daß du sie mit einem Auftrag möglichst weit weg schickst. Irgendein Botendienst wird sich sicherlich finden lassen. Ich will, daß Gras über die Sache gewachsen ist, bis sie zurückkommen. Es ist keine Ungerechtigkeit den Männern gegenüber, verstehst du; ich will nur verhindern, daß sie zuletzt doch etwas weitertratschen. Am besten gibst du ihnen dafür eine zusätzliche Entlohnung.«
»Ich habe verstanden, Herr Bernward.«
Ich lächelte ihn an und konnte nicht vermeiden, daß mein Lächeln wehmütig wurde. Ich fühlte mich niedergeschlagen wegen seiner bedingungslosen Ergebenheit, die ich mit einer Lüge vergalt; er dachte, es sei wegen der Toten, und murmelte: »Der Herr sei ihrer Seele gnädig.«
»Amen«, sagte ich und fühlte einen neuerlichen Stich, weil es das erste Gebet war, das jemand für die Ermordete sprach.
»Hole mir jetzt die Knechte«, sagte ich. »Ich warte hier auf sie und bringe sie in die Stadt.«
Er stand auf, aber als er an der Tür war, zögerte er. Er drehte sich um und fragte: »Soll ich Euch nicht diesen zweiten Gang abnehmen?«
»Nein«, sagte ich. »Ich muß es selbst tun.«
»Natürlich«, sagte er und verließ den Raum. Ich saß am Tisch und starrte auf meine Finger, die ruhelos auf dem glatten Holz trommelten. Über diesen Tisch waren ebenso viele geschäftliche Gespräche wie Trinksprüche und fröhliche Witze gewandert; letzteres zumindest, als Maria noch lebte und meine Familie um mich versammelt war. Zum ersten Mal allerdings war eine solch gewaltige Lüge über ihn hinweg gegangen. Ich hatte mich noch nie gescheut, die Schwäche meiner Geschäftspartner auszunutzen, um den Vorteil auf meiner Seite ein wenig anzuheben; umgekehrt war es sicherlich auch einige Male geschehen. Niemand erwartete etwas anderes, wenn er in geschäftliche Verhandlungen einstieg. Aber die einfache Seele und die Zuneigung eines anderen Menschen zu mir hatte ich noch niemals so ausgenutzt. Plötzlich fühlte ich die Erbitterung wie einen schlechten Geschmack in meinem Mund aufsteigen. Vielleicht war meine Erinnerung getrübt, aber ich konnte mich nicht entsinnen, daß ich früher Zuflucht zu Lug und Trug hatte nehmen müssen, um der Gerechtigkeit zur Geltung zu verhelfen. Es mochte sein, daß ich mich zu lange mit meinem Leben als Kaufmann herumgeschlagen hatte. Ich hatte es nicht vermocht, meine Familie zusammenzuhalten; womöglich hatte ich auch die Fähigkeiten verloren, auf die ich früher so stolz gewesen war.
Es dauerte nicht lange, bis der Verwalter mit zwei verschlafen blinzelnden Männern in die Stube kam. Ich kannte beide gesichtsweise, und von einem wußte ich sogar den Namen. Früher hatte ich jeden meiner Knechte persönlich gekannt; früher, als meine Geschäfte noch geringeren Umfang hatten; früher, als ich noch einzelne Handelsfahrten selbst unternahm, als ich noch dachte, dieses neue Leben könnte mein altes ersetzen.
– Früher, als Maria mit Daniel auf dem Arm und Sabina und der kleinen Maria im Schlepptau durch den Haushalt gewirbelt war und alle Knechte die Arbeit niederlegten, um ihr nachzublicken. Warum nur fehlst du mir heute so besonders, meine Geliebte?
Früher hatte ich jeden meiner Knechte mit dem Namen ansprechen können und über seine Familienverhältnisse, sein Vorleben und seine Ängste und Freuden Bescheid gewußt. Ich seufzte im stillen; mir war mehr als nur mein privates Glück aus den Händen geglitten.
»Guten Morgen, Herr Bernward«, stammelten die beiden im Chor. Ich nickte ihnen zu und erwiderte den Gruß; den, dessen Namen ich wußte, fragte ich: »Wie geht es dir, Egid?«
Er sagte überrascht: »Gut, Herr Bernward.«
»Das freut mich.« Ich wandte mich an seinen Gefährten. »Wie ist dein Name?«
»Kaspar, Herr Bernward.«
Ich wandte mich an den Verwalter: »Hast du mit ihnen gesprochen?«
»Nein, ich wollte es Euch überlassen.«
»Gut. Hört zu, Egid und Kaspar. Ihr werdet mich in die Stadt begleiten, zur Baustelle des Martinsdoms. Was wir dort finden, werdet ihr in eine Decke wickeln, die wir mitnehmen, und wieder hierher zurück transportieren. Ihr werdet während des Transports und auch hinterher kein Wort verlieren über das, was wir gesehen haben. Habt ihr mich verstanden?«
Die beiden wechselten einen überraschten Blick, aber sie nickten.
»Danach«, fuhr ich fort, »habe ich einen weiteren Auftrag für Euch. Habt ihr Frauen oder Familie?«
Sie schüttelten beide die Köpfe; Kaspar etwas zögernder als Egid. Er war um einige Jahre jünger als Egid, der schon zu ergrauen begann, und ich nahm an, daß er ein Liebchen unter dem Gesinde hatte. Um so besser, wenn er ihr eine Weile lang nichts erzählen konnte.
»Dann wird es euch nichts ausmachen, wenn euch dieser Auftrag für einige Wochen von hier fortführt. Der Verwalter wird es euch erklären, wenn wir zurück sind. Macht ihr eure Sache auch dabei gut, werde ich nicht kleinlich sein. Habt ihr auch das verstanden?«
Sie nickten wieder. Egid fragte: »Mit Verlaub, Herr: Was sollen wir für Euch transportieren? Ich meine, wegen der Größe der Decke. Und sollen wir einen Maulesel mitnehmen?«
»Kein Maulesel«, sagte ich. »Und es muß eine große Decke sein.« Ich zögerte einen Moment, aber es gab keine Möglichkeit, der Wahrheit auszuweichen.
»Wir holen die Leiche einer jungen Frau«, sagte ich.
Für einen Moment herrschte absolute Stille im Raum. Ich sah alles wie durch eines jener famosen Gläser, in denen eine Ameise plötzlich so groß erscheint wie ein Pferd: Ihre Gesichter wechselten von Befangenheit zu Bestürzung, die Kiefer der beiden sanken herab, und ihre Augen weiteten sich.
»Setzt euch hierher«, sagte ich barsch. Sie gehorchten mit schlotternden Gliedern. Ich fühlte einen Trommelwirbel im Magen, als ich betont ruppig sagte: »Sie war eine Dirne aus der Stadt, und ich bin zu ihr gegangen. Gestern nacht wurde sie umgebracht, und jemand, der wußte, daß ich sie kannte, hat mich benachrichtigt. Sie hat keine Familie, und ich will vermeiden, daß sie in einem Armengrab verscharrt wird; denn ich mochte sie, und ihr Tod tut mir leid.«
Sie starrten mich an. Ich sagte: »Deshalb will ich auch, daß niemand etwas davon erfährt. Habt ihr dies ebenfalls verstanden?«
Der ältere der beiden, Egid, nickte nach kurzem Zögern entschlossen. Der jüngere sah mich noch immer mit weitaufgerissenen Augen an. Er war zu unerfahren, um wie Egid seine Gedanken hinter seinem Gesicht zu verbergen. Ich konnte in seinen Zügen lesen wie in einem Buch.
»Ich habe sie nicht getötet, mein Freund«, sagte ich ruhig zu ihm. »Ich weiß auch nicht, wer es letztlich getan hat. Ich bin jedoch sicher, er wird der Gerechtigkeit nicht entgehen.« Ich sah sie wieder beide an. »Ich will euch nicht dazu benutzen, ein Verbrechen zu vertuschen. Der Stadtkämmerer ist unterrichtet, und er wird die Sache untersuchen, ohne daß mein Name genannt wird.«
Ich wußte nicht, ob ich sie überzeugt hatte. Glaubten sie mir nicht, konnten sie mich – nach ihrer Rückkehr – getrost dem Richter anzeigen. Von seiner Seite hatte ich nichts zu befürchten. Ich beendete das Gespräch, und sie rafften sich auf und marschierten schweigend zur Tür hinaus. Der Verwalter blieb im Raum, und endlich sah ich ihm ins Gesicht. Sein Blick war voller Bedauern.
»Ich wünsche Euch viel Glück, Herr Bern ward«, sagte er. »Ich werde die Knechte wegschicken, sobald Ihr mit Ihnen zurück seid. Euch lasse ich derweil etwas zu essen richten.«
»Ich glaube nicht, daß ich danach hungrig sein werde«, erwiderte ich.
»Eßt nur«, sagte er. »Essen heilt die Wunden der Seele; zumindest ein wenig. Wenn Ihr wieder zu Hause seid, werdet Ihr Hunger haben.«
Es war ein weiser Rat, den er mir gab; und es stellte sich heraus, daß er recht hatte.
Die Zeit war nun doch merkbar vorangerückt, als der Leichnam endlich in einem der leerstehenden Lagerräume im hinteren Teil des Hauses lag, aufgebahrt und von der Decke, in der wir sie hierher transportiert hatten, notdürftig zugedeckt. Es war eine traurige Bahre, ohne Kerzen und ohne Blumengebinde. Statt dessen hing der Geruch von Gewürzsäcken im Raum, die sich zuvor darin befunden hatten und die ich gestern hatte auslagern lassen, um Platz zu schaffen für die Stoffe aus Venedig, die ich in den nächsten Tagen erwartete. Bis dahin mußte auch die Tote ihren Platz geräumt haben. Der Verwalter brachte die beiden Knechte hinaus, um sie sogleich nach Reichenhall zu senden. Ich hatte dort ein größeres Kontingent Salz aufgekauft, dessen Bereitstellung mir vor ein paar Tagen avisiert worden war und um das sich ohnehin jemand hätte kümmern müssen. Es war ein Geschäft, in das ich mich als Zwischenhändler eingeschaltet hatte: Der eigentliche Empfänger war ein Kaufherr in Augsburg, zu dem ich das Salz transportieren ließ. Derartige Transporte waren zeitraubend und schwierig; die Stadt München besaß seit altersher das Salzstapelrecht, und dies bedeutete, daß alles zwischen Landshut und den Bergen westwärts geschaffte Salz nur in München die Isar überqueren durfte und dort erst einmal gestapelt und zum Verkauf niedergelegt werden mußte, woran die Münchner kräftig verdienten. Trotz der merkwürdigen Umstände platzten die beiden Männer fast vor Stolz, daß ich sie für diese verantwortungsvolle Aufgabe einsetzte, und waren Feuer und Flamme, sofort loszureiten. Ich selbst war überrascht über die Findigkeit meines Verwalters. Die Salzkarren würden nur langsam vorwärtskommen und eine Ewigkeit in München festhängen; vor Nikolaus waren die beiden nicht zurückzuerwarten.
Ich blieb noch einen Moment in dem Lagerraum stehen, der unvermittelt zu einem Totenzimmer geworden war. Der Verwalter hatte die Kerze mitgenommen, aber die Dämmerung war jetzt so weit angebrochen, daß ein schwacher Lichtschimmer durch das schmale Fenster hereinfallen konnte. Er reduzierte die Gegenstände im Raum zu schemenhaften Umrissen aus Licht und Schatten. Die Tote lag unter der Decke, die ihre Gestalt zusätzlich verhüllte; alles mögliche konnte unter den rauhen Falten verborgen sein, doch zu wissen, was es wirklich war, machte diesen Umstand weniger beruhigend als vielmehr makaber. Vielleicht liegt es daran, daß kaum jemand, der sich einer zugedeckten Leiche gegenüber findet, widerstehen kann, die Decke zu lupfen und in das tote Gesicht zu blicken: der Unglauben, daß der Tod einen menschlichen Körper zu einem abstrakten, lang ausgestreckten Gebilde völliger Regungslosigkeit reduzieren kann. Auch mich drängte es in diesem Augenblick, die Decke noch einmal anzuheben; mir kam in den Sinn, daß ich noch nicht einmal ihre Gesichtszüge kannte. Ich hätte den Lehm fortwischen können, der die Hälfte ihres Antlitzes verkrustete, aber die unbewußte Zärtlichkeit, die in einer solchen Geste steckt, ließ mich erschauern, und der Drang verschwand.
Die Männer hatten den Leichnam beinahe sanft abgelegt und die Decke darüber wieder geradegezogen. Sie hatten kein Wort mehr verloren, seit wir von meinem Hof in die Stadt hinein aufgebrochen waren; weder über den Umweg durch die Widumsgasse, über die wir uns schließlich der Kirche von hinten her näherten (wir betraten sie durch das nur von zwei Wappnern bewachte Südportal); noch über die schweigende, einsame Gestalt Hanns Altdorfers, der am Rand der Grube stand und blicklos hinunter starrte. Sie hatten die Tote behutsam auf demselben Weg zurücktransportiert, unkenntlich in die dicke Decke gewickelt, und es schien, als würden sie eine Schlafende nach Hause tragen, so vorsichtig gingen sie mit ihr um. Zuletzt hatten sie sie auf den beiden Tischen ausgestreckt, die mein Verwalter zusammengeschoben hatte, und waren gegangen.
Ich starrte auf ihr Werk, ihr Werk und meines, und fühlte mich schwach. Ich dachte daran, mich wieder niederzulegen und noch etwas zu schlafen, bis die Sonne vollends aufgegangen wäre. Aber ich wußte, daß ich keine Ruhe finden würde: Meine Erschöpfung war seelischer Natur, nicht körperlich, und ich hatte noch niemals schlafen können, wenn meine Seele wund war. Plötzlich freute ich mich auf das Essen, das der Verwalter mir gerichtet hatte. Ich schloß die Tür und verriegelte sie.
Der Verwalter leistete mir bei meiner einsamen Speise Gesellschaft, anfangs ohne etwas zu sagen. Später schnitt er ein geschäftliches Thema an. Ich wußte, es war, um mich auf andere Gedanken zu bringen, doch dann steigerte er sich in das Problem hinein und schien zu vergessen, was am heutigen Morgen vorgefallen war. Wir diskutierten, bis die Küchenmägde in die Stube kamen und das Essen für die restlichen meiner Knechte und Mägde auftrugen. Es gab ein paar Fragen nach Egid und Kaspar, die sie befangen von meiner Gegenwart an den Verwalter richteten, doch ich beantwortete sie selbst und auf eine Weise, die keinen Verdacht aufkommen ließ, es könnte an ihrer Entsendung etwas merkwürdig sein. In einigen Gesichtern sah ich gar unterdrückten Neid auf die vermeintlich bevorzugte Behandlung, die den beiden angediehen war. Die Männer und Frauen rückten sich selbst unsicher um den Tisch herum zurecht. Es irritierte sie sichtlich, daß ich ebenfalls auf der Bank saß und der Verwalter auf dem einzigen Stuhl; als dem Hausherrn hätte dieser Platz mir gebührt, aber ich hatte mich noch niemals um solche Dinge geschert. Da ich jedoch kaum jemals in ihrer Gesellschaft aß, waren sie es nicht gewöhnt, daß ich die traditionelle Ordnung der Dinge mißachtete. Als die Sonne endgültig über die Hügelkette jenseits der Stadt geklommen war, zerstreute sich die Schar, um sich für den Kirchgang zu richten, und mir wurde bewußt, daß heute ein Feiertag war: Allerheiligen, der Tag des Totengedenkens. Wie passend, dachte ich bitter. Der letzte der Knechte verließ die Stube, und ich war wieder mit dem Verwalter allein.
»Ich muß dafür sorgen, daß sich ein Totengräber der Leiche annimmt«, sagte ich. »Kennst du einen in der Stadt?«
»Nein«, erwiderte er. »Und ich glaube nicht, daß Ihr es wünschen würdet, wenn ich mit einem Umgang pflegte.«
Ich zuckte mit den Schultern, aber in diesem Fall hatte er recht; sich mit dem Totengräber abzugeben wurde für ebenso schandbar angesehen wie die Bekanntschaft mit dem Henker. Niemand, der etwas auf sich hielt, würde öffentlich zugeben, daß er den einen oder anderen persönlich kannte.
»Und nun?« fragte ich ihn. »Ich kann sie doch nicht einfach so verscharren.«
»Ein Priester …«, sagte er zögernd, aber ich winkte ungehalten ab, und er duckte sich. Es war lange her, daß Priester und Bischöfe zu meinen Freunden gezählt hatten.
»Ein Apotheker in der Stadt gehörte vor längerer Zeit einmal zu unseren Geschäftspartnern«, sagte er nach einer Weile.
»Tatsächlich?« fragte ich. »Das muß aber schon lange her sein.«
»Etliche Jahre«, sagte er. »Es war ganz zu Anfang meiner Tätigkeit für Euch, als Ihr Euch noch nicht … noch nicht wieder um die Geschäfte gekümmert hattet. Sein Name ist Sebastian Löw; soweit ich mich erinnern kann, hat er einen Batzen Geld in eines Eurer Unternehmen gesteckt und ist mit einem schönen Gewinn davongekommen. «
»Ich wundere mich, daß dir der Name noch geläufig ist«, sagte ich.
Er lächelte kaum sichtbar.
»Ich habe in unseren Papieren nachgesehen, während Ihr fort wart«, gab er zu. »Ich erinnerte mich an den Apotheker und dachte, daß er Euch vielleicht von Nutzen sein könnte.«
Ich nickte überrascht; ich hatte ihm so viel Initiative gar nicht zugetraut.
»Ich denke, er wird sich freuen, Euch einen Gefallen erweisen zu können.«
»Das wohl nicht gerade. Aber er ist mir verpflichtet, damit hast du recht. Ich frage mich nur, was ein Apotheker für mich tun kann.«
»Ein Mann seiner Profession kennt sicher wiederum jemanden, der sich …«, er machte eine verkrampfte Bewegung; es war ihm unangenehm, meinen vermeintlichen Schmerz so direkt ansprechen zu müssen, »… ohne großes Aufhebens der Verstorbenen annehmen kann.« Er schwieg, als er sah, wie ich mein Gesicht verzog.
Ich hatte viel zuwenig nachgedacht, als ich in der Kirche sagte, ich könne mich des Leichnams annehmen, ohne Aufsehen zu erregen und ohne allzu viele Leute damit befassen zu müssen. Tatsächlich wurden es immer mehr, die mit der Toten in Berührung kamen. Einen schwatzhaften Apotheker mit hineinzuziehen schien mir in diesem Zusammenhang der Gipfel der Leichtsinnigkeit zu sein. Ich schüttelte den Kopf.
»Ich habe leider keinen anderen Einfall«, murmelte der Verwalter schüchtern.
Ich öffnete den Mund, um zu sagen: Wir begraben sie einfach irgendwo im Wald oder versenken den Leichnam in der Isar, aber ich schloß ihn auf der Stelle wieder. Dazu ist es nun zu spät, mein einfallsreicher Peter, dachte ich voller Zynismus; dazu hättest du das Märchen mit der heimlichen Geliebten nicht erfinden dürfen. Nicht einmal der Verwalter wird dir abnehmen, daß du ihre Leiche lieblos dem Wasser übergibst. Ich hätte die beiden Knechte einfach mitnehmen und ihnen befehlen sollen, die Tote im Verborgenen zu begraben; ich hätte angeben sollen, ich täte es für den Stadtkämmerer, dem ich bei der Aufklärung eines Verbrechens helfen würde; ich hätte
– mich von Anfang an gar nicht darauf einlassen sollen
dem Kanzler und seinem famosen polnischen Rittersmann die Leiche überlassen sollen, anstatt eine derart komplizierte Geschichte zu erfinden und mich in meinen eigenen Fallstricken zu verfangen. Ich mußte erkennen, daß ich unter den gegebenen Umständen keine andere Wahl hatte, als den Vorschlag des Verwalters anzunehmen.
»Ich habe auch keine Idee«, sagte ich. »Daher denke ich, ich werde deinem Ratschlag doch folgen.«
Er verkniff sich zu sagen, daß er dies ebenfalls für das beste hielt. Seinem Gesicht war es dennoch anzusehen.
Ich seufzte und sagte: »Wie kann ich den Mann dazu zwingen, seinen Mund zu halten?«
»Ich glaube, es reicht, wenn Ihr ihn darum bittet.«
»Das kann ich mir kaum vorstellen«, sagte ich düster.
Er drehte die Hände nach außen und hob die Arme, und ich winkte ab.
»Ich werde ihm vorschlagen, ihn an einem der nächsten Geschäfte zu beteiligen«, entschied ich. »Das wird zumindest vorhalten, bis das Geschäft abgewickelt ist.«
»Wenn Ihr meint«, entgegnete der Verwalter. Ich nickte und stand auf.
»Wo liegt seine Apotheke?« fragte ich.
»Schräg gegenüber dem Rathaus in der kleinen Gasse, die zur Floßlände führt.«
»Ich werde sogleich wieder aufbrechen«, seufzte ich. »Zum drittenmal hintereinander in die Stadt.«
»Wenn Ihr wollt, kann ich ebenso gut … «
Ich lächelte, und er senkte den Kopf. »Ich muß Euch nochmals an die Stofflieferung erinnern«, sagte er. Ich zog scharf den Atem ein.
»Richtig«, sagte ich. »Nun komme ich doch nicht dazu, mich selbst darum zu kümmern. Würdest du sie entgegennehmen und die Fuhrleute auszahlen? Und nachsehen lassen, ob der Holländer, der die Lieferung organisiert hat, schon wieder zurück ist?«
»Walther vom Feld? Der für den Herzog arbeitet?« »Richtig. Sein Haus ist in der Spiegelgasse.«
»Selbstverständlich, Herr Bernward.«
»Danke.«
Er zuckte mit den Schultern, und ich schob die Sitzbank mit den Kniekehlen zurück und kam hinter dem Tisch hervor. Als ich an der Tür war, drehte ich mich nochmals zu ihm um. Er sah mich an, als wollte er mir noch irgend etwas mit auf den Weg geben; einen Trost oder ein gutes Wort. Seine Miene versetzte mir einen leisen Schmerz. Er fand nicht die Worte, die er hatte sagen wollen; er sagte nur: »Ich werde mich hier um alles kümmern.«
»Gut«, antwortete ich und ging.
Der Nebel hatte noch nicht aufgegeben, gegen die Sonne anzukämpfen, die seit ihrem Aufgang seine graue Decke zu schmelzen versuchte. Im Licht des Morgens lag er hell glimmend über dem Tal und verbarg die Umrisse von Gebäuden und Bäumen ebenso gut wie während der Nacht. Ich konnte den niedrigen, schlanken Turm der Abtei erst sehen, als ich mich ihm ein ganzes Stück genähert hatte, und zu diesem Zeitpunkt war mein eigener Hof längst im Morgennebel versunken; aber was die Sicht verbarg, trug den Ton um so weiter, und so hörte ich das dünne Geläut der Klosterglocke bereits, während ich noch unter meinem Tor hindurch ins Freie trat. Es begleitete mich mit seinem monotonen Rhythmus bis zum Ufer des nördlichen Isararms, hinter dem sich das Äußere Tor erhob; dann erstarb es mit einem letzten Mißton, als die heiligen Frauen die Glocke anhielten. Ich war diesmal nicht allein auf der Straße: Ein paar Bauernkarren rumpelten über ihre schadhafte Decke zur Stadt hin, und ihre Lenker grüßten mich mit der interesselosen Freundlichkeit von Reisenden, die sich zufällig auf dem Weg treffen. Die Ladeflächen der Karren waren leer; sie fuhren nicht zum Markt. Die meiste Arbeit für den Winter war getan, und sie konnten es sich leisten, den Feiertag gaffend und staunend in der Stadt zu verbringen. Ihre Frauen und Kinder saßen neben ihnen auf den Böcken, und beim einen oder anderen befand sich als ausnahmsweise menschliche Fracht ein Knecht oder ein fröstelndes Paar Mägde auf dem Karren. Der neue Kirchenbau und die Messe, die der Domkapitular davor las, würden die Hauptattraktion für die Besucher abgeben, und ich dachte daran, daß nur ein glücklicher Zufall es verhindert hatte, daß heute morgen ein Gaffer über die Leiche stolperte und Gott und die Welt alarmierte. Im selben Moment fiel mir ein, daß niemand von uns den Domkapitular davon in Kenntnis gesetzt hatte, was geschehen war. Ein neuerlicher Fehler, der uns unterlaufen war; Doktor Federkiel, der Kapitular, würde nicht vorbeihören, wenn der Tratsch seine Ohren erreichte, daß des Nachts in der Kirche der Teufel los gewesen war. Und er würde keine Ruhe geben, bis er herausgefunden hatte, was den Grund dafür darstellte. Ich erschrak, als mir das Ausmaß unseres Versäumnisses bewußt wurde; schon nahm ich mir vor, Federkiel schnellstens aufzusuchen. Aber was sollte ich ihm erzählen? Unser Märchen vom wundersam aufgetauchten Kirchenschatz wohl kaum. Während ich noch an diesem neuerlichen Problem arbeitete, stockte mein Schritt unwillkürlich, und ich geriet in die Bahn eines der Ochsengefährte. Sein Lenker pfiff mir schrill zu, und ich sprang erschrocken zur Seite. Er neigte sich zu mir herab, als er seine Tiere an mir vorbeisteuerte, und rief: »Nichts für ungut, Herr. Ich wollte vermeiden, daß Euch die Ochsen auf die Zehen treten.«
Ich blieb ein paar Augenblicke neben der Straße stehen und ließ ihn passieren, dann wanderte ich nachdenklich weiter. Es machte nicht viel Sinn, wenn ich den Domkapitular aufsuchte; er kannte mich kaum. Bestenfalls wußte er, daß ich im Unfrieden aus dem Dienst des Bischofs von Augsburg geschieden war, und dieser Umstand sprach nicht gerade für mich. Wenn ich ihm die Geschichte unterbreitete, klang sie noch verdächtiger, als wenn es einer der anderen getan hätte. Es war Hanns Altdorfers Aufgabe, Doktor Federkiel zu benachrichtigen. Ich nahm mir vor, den Stadtkämmerer so schnell wie möglich aufzusuchen und ihm unser neues Problem zu schildern. Zuerst stand jedoch Sebastian Löw auf der Liste. Ich stöhnte innerlich: Schon begann die Zeit zu drängen. Ich schritt ein wenig schneller aus.
Wie mein Verwalter gesagt hatte, fand sich die Apotheke des Sebastian Löw schräg gegenüber des Rathauses. Es war nicht die einzige am Platz; zwei weitere befanden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Löws Haus bildete den Anfang des kleinen Gäßchens, das direkt zur Lände am Isarufer hinunterführte; der Eingang zu seinem Laden lag in der Gasse. Entlang der Hauptstraße grenzten ein schön geschmücktes Bürgerhaus und der mächtige Kasten des herzoglichen Zollhauses an seine Fassade; weitere prunkvolle Patrizierhäuser schlossen sich daran an. In der Gasse selbst war nicht zu erkennen, ob das Haus des Apothekers deren gesamte Länge einnahm oder ob sich ein weiteres Haus daran anschloß; die Mauer mit wenigen, schmalen Fenstern war einheitlich. Vielleicht verbarg sich ein kleiner Innenhof mit einem Kräutergarten dahinter.
Ich bog in die enge Gasse ein; ihre rechte Seite lag im diffusen Sonnenlicht, das vom Nebel gestreut wurde, die linke im ebenso unscharf abgegrenzten Schatten. Löws Eingangstüre war ein dunklerer Umriß darin, in dem die metallenen Türbeschläge ein mattes Funkeln von sich gaben. Ich drückte den Riegel hinunter und stand in einem kurzen, düsteren Gang. Als ich die Tür hinter mir schloß, wurde er fast vollkommen dunkel. Ich zögerte einen Moment, bis sich meine Augen an das schlechte Licht gewöhnt hatten.
Ich hörte kein Geräusch aus dem Inneren des Hauses. Unangenehm wurde ich mir der Möglichkeit bewußt, daß seine Bewohner vielleicht noch schliefen. Immerhin war es ein Feiertag. Ich blieb unschlüssig in dem schmalen Gang stehen.
Dann hörte ich ein paar schnelle Schritte, und zu meiner Linken öffnete sich eine Tür und ließ durch ihre Öffnung das ungewisse Licht des Nebelmorgens in den Gang. Ich kniff die Augen zusammen und erspähte eine hochgewachsene Figur im Gegenlicht.
»Guten Morgen«, sagte die Gestalt mit heller Stimme. »Was können wir für Euch tun?«
Ich erkannte einen jungen Mann; er mochte vielleicht Daniels Alter haben. Ich fragte überrascht: »Seid Ihr Sebastian Löw?«
Der junge Mann schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er fröhlich. »Ich bin sein Sohn. Wollt Ihr meinen Vater sprechen?«
»Ich bitte darum.«
»Wenn es sich um eine Arznei handelt, die Ihr kaufen wollt …« Er wies mit dem Kopf hinter sich in die Stube, auf deren Schwelle er stand. Ich hatte schon den scharfen Geruch der Tinkturen und Wässerchen wahrgenommen, als er die Tür geöffnet hatte; jetzt trat er unwillkürlich einen Schritt beiseite, und ich erhaschte einen Blick auf ordentliche Reihen dunkler Glasflaschen, die in einem offenen Schrank blinkten. »Ich kann Euch ebenso gut weiterhelfen«, vollendete er.
»Es handelt sich um etwas anderes«, sagte ich. »Würdet Ihr bitte Euren Vater verständigen?«
»Wie ist Euer Name?« fragte er nüchtern.
»Peter Bernward.« Er gab kein Anzeichen, daß ihm der Name bekannt war.
Ich dachte: Das läßt sich nicht gerade erfolgversprechend an. »Ich bin Kaufmann. Euer Vater kennt mich.«
Er nickte und trat vollends beiseite. »Bitte tretet ein«, sagte er. »Ich werde meinen Vater sofort holen.«
Ich drückte mich an ihm vorbei in die Apotheke hinein, und er verließ mich mit einer gemurmelten Entschuldigung. So hatte ich es mir einst vorgestellt: Daniel, mein eigener Sohn, der Geschäftsfreunde und Kunden empfing, wenn ich selbst beschäftigt war, und in die Stube bat. Er hatte es sich anders ausgedacht und mein Haus an dem Tag verlassen, als ihm von Meister Stethaimer die Arbeit eines Steinmetzes an der Kirche angeboten wurde. Seither trafen wir uns einmal im Monat; wenn er viel zu tun hatte, seltener. Wir stritten uns jedesmal. Ich seufzte und sah mich um.
Die Apotheke war ein finsterer Raum, wenn man einmal darinnen stand. Vom noch dunkleren Gang aus hatte sie hell gewirkt, aber wie immer kam es auch hier auf den Standpunkt an. Von innen zeigte sich, daß das Fenster mit seiner dicken Glasscheibe nur wenig Licht einließ, und die dunkel gebeizten Schränke, Truhen und Regale rings an den Wänden taten ein übriges, den Raum zu drücken. Direkt unterhalb des Fensters stand ein schräges Pult mit zerkratzter Oberfläche und vielen Tintenflecken; ein dickes Pergament war mit metallenen Klammern darauf festgehalten. Ich trat näher und erkannte eine feine, blasse Zeichnung, die auf den ersten Blick zu abstrakt wirkte, um etwas darzustellen, und beim zweiten Blick etwas offenbarte, das Hühnergedärm ähnelte. Sie war noch frisch; der junge Löw mochte sie angefertigt haben.
Es war klar zu erkennen, daß Löw sich hier einen Arbeitsraum und gleichzeitig das Lager seiner Arzneien eingerichtet hatte. Wo immer es möglich war, hatte er eine kleine Ablagefläche geschaffen, auf der tönerne und gläserne Vorratsbehälter standen, bereit, irgendeine heilbringende Flüssigkeit aufzunehmen oder etwas aus ihrem Inhalt in ein anderes Gefäß abzugeben. Die Decke des Raumes war hoch, und die Regale an den Wänden reichten bis hinauf. Um an die obersten Reihen von Behältern zu gelangen, würde der Apotheker auf einen Schemel steigen müssen. Mein Blick folgte den ordentlichen, dunkel blinkenden Fläschchen und Krügen, die in Reih und Glied auf den Regalbrettern standen, bis oben zur wuchtigen Holzdecke; als ich den Kopf in den Nacken legte, wurde mir fast schwindlig von dem intensiven Kräutergeruch, der in dem kleinen Raum hing. Selbst an der Decke war Platz für Vorräte: Trockensträuße, grobe Säckchen mit verblaßten Blüten und die obszön geformten Umrisse gedörrter Pilze hingen an einer Unzahl von festen Nägeln, die zur Hälfte in die Deckenbalken getrieben waren. Ein Bündel Alraunenwurzeln in einer Ecke sah aus wie eine phantastische Gruppe von gehenkten Zwergen.
Der Geruch, den die vielen Büschel und Wurzeln ausströmten, war zuerst unangenehm und beißend. Nach einiger Zeit jedoch erlangte er eine beruhigende Qualität; er stieg zu Kopf und machte das Atmen wie auch das Denken leicht. Ich betrachtete die Rücken von mindestens einem halben Dutzend schwerer Folianten und dachte müßig, welches Wissen sich hinter dem fettigen braunen Leder verbergen mochte, als sich die Tür wieder öffnete und Sebastian Löw seine Apotheke betrat.
Er brachte den Duft gebratenen Specks mit herein, und für einen Augenblick verdrängte das herbe Aroma die medizinischen Gerüche. Der Bratengeruch paßte zu ihm: Er war ein mittelgroßer Mann mit einer Halbglatze und einem prallen runden Bäuchlein, das bedeutend größer war als mein eigenes. Er blinzelte mich kurzsichtig an, aber sein Gesicht hatte sich bereits zu einem breiten Lächeln verzogen. Hinter ihm betrat sein Sohn die Stube und schloß die Tür.
»Herr Bernward«, sagte der Apotheker mit überraschender Wärme in der Stimme. »Ich bin erfreut, Euch endlich kennenzulernen.«
Er trat auf mich zu und streckte eine kleine Hand aus. Ich reichte ihm meine voller Erstaunen, und er pumpte begeistert damit auf und ab. Danach legte er seine andere Hand darüber, ohne mich loszulassen. Seine Finger waren weich, und die Innenfläche seiner Hände zart wie die einer reichen Bürgersfrau. Er wandte den Kopf zu seinem Sohn und rief: »Das ist Herr Bernward von Säldental, mein Junge. Dein Studium verdankst du nicht zuletzt ihm.«
Der Junge nickte scheinbar gelassen; ich konnte jedoch trotz des schlechten Lichts sehen, daß sich seine Wangen röteten.
»Ich weiß, Vater«, sagte er verlegen.
Löw blickte wieder zu mir auf.
»Ich freue mich«, sagte er nochmals, bevor er meine Hand losließ. Ich war noch immer so überrascht von seiner Begrüßung, daß ich einen Schritt zurücktrat, um Platz zum Nachdenken zu haben.
»Ich freue mich, daß Ihr Euch freut«, murmelte ich täppisch und verbiß mir im letzten Moment den Nachsatz: Wenn ich auch nicht weiß, weshalb Ihr so voller Freude seid. Ich bemühte mich nach Kräften, meine Fassung wiederzuerlangen. Es gelang mir erst, als mich das Mißtrauen über seine überschäumende Freundlichkeit einholte. Womöglich erwartete er, daß ich ihm ein Geschäft anbieten würde; er lag noch nicht einmal so falsch damit.
Löw breitete die Arme mit einer Geste des Besitzerstolzes aus.
»Seht Euch um«, sagte er. »Ich habe vor vielen Jahren als kleiner Apotheker angefangen und immer von der Hand in den Mund gelebt. Heute kann ich meinen Sohn auf die Universität nach Innsbruck senden.« Er strahlte mich an und schien auf eine Erwiderung zu warten.
»Die Früchte harter Arbeit«, entgegnete ich unverbindlich. Er schüttelte begeistert den Kopf.
»Nicht nur«, rief er. »Nicht nur. Wißt Ihr, daß ich das erste Geld, das ich beiseite brachte, in einen Handel investierte, den Ihr in Tirol getätigt habt und für den Ihr noch Geldgeber suchtet?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Das ist lange her …«, sagte ich zögernd. Er schien es nicht zu hören.
»Meine Frau wollte mich erschlagen«, fuhr er fort. »Es fehlte nicht viel, und sie hätte es getan. Dann habt Ihr Euren Handel mit großem Erfolg abgeschlossen, und ich bekam mein Geld zurück und noch einmal die Hälfte davon als Gewinn. Daraufhin wollte mich meine Frau zu Tode küssen, und beinahe wäre ihr das auch gelungen.«
Er hatte eine Art zu sprechen, die einem lustigen Singsang glich; seine Stimme hüpfte bei den Vokalen auf und ab. Es war nicht die Stimme, die ich bei einem Apotheker erwartet hätte. Wenn er damit die Verwendung einer Arznei erklärte, mußte es sich fast anhören, als mache er sich insgeheim über deren Benutzer lustig. Seine offenen, faltenlosen Züge glichen diesen Eindruck jedoch wieder aus; wahrscheinlich war es eher so, daß sie in Verbindung mit seiner beschwingten Sprechweise das Gefühl vermittelten, die bloße Einnahme der verkauften Medizin würde sämtliche Beschwerden im Handumdrehen lindern.
Mir war noch immer nicht klar, wie ich mich auf die Begeisterung verhalten sollte, die der Mann an den Tag legte. Ich bemerkte, nur um etwas zu sagen: »Glücklicherweise seid Ihr noch am Leben.«
»Ja«, antwortete er und zwinkerte. »Mit knapper Not. Seit dieser Zeit habe ich immer wieder einmal daran gedacht, in Eure Geschäfte zu investieren; leider hat sich niemals wieder etwas ergeben. Nun, wie auch immer, der damalige Gewinn hat mir neben dem Geld genug Selbstvertrauen gegeben, um mein eigenes Glück zu machen, und das hat es mir wiederum ermöglicht, meinen Sohn studieren zu lassen.«
Er schlug die Hände mit einem lauten Klappen vor dem Bauch zusammen und schüttelte sich. »Ich rede und rede«, sagte er dann sachlich. »Was kann ich für Euch tun, Herr Bernward?«
Ich holte Atem. Ich konnte nicht verhindern, daß mein Blick auf die stumme Gestalt des jungen Löw fiel, der hinter seinem Vater stand und ihn mindestens um eine Haupteslänge überragte. Als ich einen Moment zögerte, schien der alte Apotheker meine Gedanken zu erraten.
»Ihr könnt vor meinem Sohn frei heraus sprechen«, sagte er beruhigend.
Ich setzte zum Sprechen an und verstummte wieder; ich hatte sagen wollen, daß es mir lieber sei, wenn ich mit ihm unter vier Augen sprechen könne, aber ich wußte nicht, wie ich es ihm erklären sollte. Ich dachte daran, daß mein Verwalter gemeint hatte, Löw würde sich freuen, mir einen Gefallen erweisen zu können, und sein Verhalten schien diese Annahme beinahe zu bestätigen. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, daß dies tatsächlich der Fall war; ich hatte geplant, sein Schweigen mit dem Anreiz auf eine Geschäftsbeteiligung an meinem nächsten größeren Handel zu erkaufen, eine Geschäftsbeteiligung mit einem entsprechend hoch angesetzten Gewinn, den ich mir zu gegebener Zeit vom Kanzler des Herzogs wieder zurückzahlen lassen würde. Die Frage war, ob der Apotheker grundsätzlich so sehr daran interessiert war, daß er mir sein Schweigen in einer für ihn zumindest äußerst merkwürdigen Angelegenheit versichern würde – ob er überhaupt darauf eingehen würde, mir zu helfen, die Tote unter die Erde zu bringen. Ich wußte nicht, welche Geschichte ich ihm erzählen sollte, um sein Mißtrauen einzuschläfern, und ich wußte nicht, ob ich ihn nicht allzusehr beleidigen würde, wenn ich vor seinem Sohn nicht sprechen wollte. Ich hob die Arme und gab ein unartikuliertes Brummen von mir. Spätestens jetzt wurde mir schmerzhaft klar, daß ich meine Schritte genauer vorplanen mußte, wenn ich mich nicht in den tausend Fußangeln meiner Geschichte verfangen wollte.
Der Sohn des Apothekers unterbrach meine Gedanken: »Ich werde Euch besser alleine lassen«, und machte Anstalten zu gehen. Ich konnte deutlich erkennen, daß sein Vater irritiert war. Ich mußte eine Entscheidung treffen.
Hastig sagte ich: »Nein, bleibt hier. Entschuldigt, daß ich so lange nachgedacht habe; die Angelegenheit ist sehr delikat.«
Der junge Mann blieb unsicher stehen und sah abwechselnd von mir zu seinem Vater. Ich hatte den Eindruck, daß es ihm lieber gewesen wäre, wenn er hätte gehen können. Er fühlte sich deutlich unwillkommen. Ich versuchte ihn anzulächeln, um die plötzliche Beklemmung im Raum zu lösen. Schließlich überwand der Apotheker mit seiner Unbekümmertheit die ungute Atmosphäre. Er lächelte breit und sagte: »Was immer Euer Problem ist, gegen das Ihr Euch von meinen Arzneien Besserung erhofft, Ihr könnt es getrost auch meinem Jungen anvertrauen. Er ist Medicus.«
»Noch nicht, Vater. Noch nicht«, warf der junge Mann gequält ein, aber Löw tat es mit einem Kopfschütteln ab.
»Was habt Ihr für Beschwerden, Herr Bernward?«
Ich hörte mich beinahe sagen: Ich habe eine Leiche am Hals und kann sie nicht loswerden, und für einen Moment überwältigte mich die Idiotie einer solchen Szene derart, daß mich ein Kichern in der Kehle kitzelte. Ich schluckte es hinunter und sagte zögernd: »Ich brauche Euren Rat und Euer Versprechen, darüber absolutes Schweigen zu bewahren. Ihr könnt versichert sein, daß ich mich entsprechend erkenntlich zeigen werde.«
Er runzelte die Stirn, ging aber nicht weiter auf meine Versicherung ein. Mit gleichbleibender Freundlichkeit sagte er: »Beides steht Euch immer zur Verfügung.«
Ich hatte das Gefühl, ich müsse die Verhältnisse von Anfang an klarstellen. »Ich will Euch im Gegenzug an einem meiner nächsten Geschäfte mit einer einträglichen Marge beteiligen; höher, als irgendeinen anderen Teilhaber.«
Er seufzte, dann lächelte er erneut.
»Wißt Ihr«, sagte er, »Ihr seht die Dinge leider nicht ganz richtig. Ich bin an der Reihe, den Gegenzug zu machen. Ich schulde Euch mindestens einen Gefallen, und ich zahle ihn Euch mit der größten Freude zurück. Ganz abgesehen davon brauchte es diese Verpflichtung nicht einmal. Ich will Euch gerne behilflich sein, ob ich nun in Eurer Schuld stehe oder nicht.«
Er sah mich erwartungsvoll an, als wollte er sagen: Was ist nun, sprecht! Ich fragte: »Und ich kann mich auf Euer Stillschweigen verlassen?«
Er zuckte mit den Schultern und drehte die Handflächen nach außen; die Geste war beredt genug. Ich atmete tief ein, dachte an Hanns Altdorf er und Doktor Mair und hoffte inständig, das Richtige zu tun.
»Ein Mitglied meines Gesindes ist heute morgen ermordet aufgefunden worden«, sagte ich und setzte meine Worte so vorsichtig wie ein Blinder seine Füße. »Der Mörder hat ihr Gewalt angetan und sie dann erwürgt. Ich möchte, daß Ihr mir helft, sie ordentlich zu beerdigen.«
Er sah schockiert aus.
»Warum wollt Ihr das arme Ding nicht offiziell begraben?« fragte er.
»Ihre Eltern sind Geschäftspartner; ich hatte sie ihnen zu Gefallen in meinem Haus aufgenommen. Ich kann ihnen nicht einfach sagen: Eure Tochter ist unter meinem Dach geschändet und erschlagen worden. Es ist ihr einziges Kind; ich muß mir etwas anderes einfallen lassen.«
»Ihr wollt ihnen vermutlich auch den Anblick der Leiche ersparen.«
»Genau das.«
Löw drehte sich um und sah zu seinem Sohn hoch. Der junge Mann gab den Blick zurück, dann heftete er seine Augen auf mich und fragte: »Was ist mit dem Mörder?«
»Einer meiner Knechte ist seit heute morgen abgängig. Ich glaube, daß er es gewesen ist. Er hat sie seit einiger Zeit umworben, und ich habe das Gefühl, sie hat in der Vergangenheit seinem Werben mehr als einmal nachgegeben. Vielleicht wollte sie es diesmal nicht tun. Versteht Ihr: Dieser Umstand kommt noch hinzu und macht es mir doppelt schwer, mit ihren Eltern zu sprechen.«
»Ihr werdet die Geschichte nicht geheimhalten können. Stellt Euch den Tratsch unter Euren Dienstboten vor.«
»Außer dem Verwalter und mir weiß niemand Bescheid. Die Tote liegt heimlich aufgebahrt in einem leeren Lagerraum.« Ich schloß den Mund und wußte im selben Moment, daß ich einen Fehler gemacht hatte: Der Apotheker und mein Verwalter kannten nun zwei unterschiedliche Versionen der Angelegenheit. Wenn sie nur einmal zusammentrafen, würde mein ganzes Lügengebäude einbrechen. Ich hätte mich ohrfeigen mögen. Lahm setzte ich nach: »Mein Verwalter ist völlig erschüttert. Er kannte das Mädchen gut. Aus diesem Grund bin ich selbst zu Euch gekommen. Er erträgt es nicht, sich jetzt mit der schrecklichen Angelegenheit zu befassen. Bitte sprecht ihn vorerst nicht darauf an.«
Sie zuckten beide mit den Schultern, in einer völlig identischen Geste: Vater und Sohn.
»Was wollt Ihr nun anfangen?« erkundigte sich der Apotheker.
»Ich habe bereits zwei meiner Knechte, auf die ich mich verlassen kann, auf die Spur des Mörders gesetzt. Sie haben Befehl, ihn nötigenfalls mit Gewalt nach Burghausen zu schaffen. Ich selbst werde die dortigen Behörden informieren. Ich will den Fall nicht in Landshut ans Licht zerren.«
»Sind Eure Geschäftspartner aus der Stadt?« fragte Löw mitfühlend.
»Aus der Umgebung«, antwortete ich vage.
Sie nickten beide.
»Ich will das Mädchen nun begraben lassen, damit ihre Seele Ruhe finden kann«, fuhr ich fort. »Es liegt mir daran, sie auf dem Friedhof auf meinem Hof zur Ruhe zu betten. Danach wird mir einfallen, was ich ihren Eltern berichten kann.«
»Und es muß möglichst bald geschehen, damit Euer Gesinde nicht Wind davon bekommt«, sagte der Sohn des Apothekers nüchtern.
»Wie habt Ihr ihr Verschwinden erklärt?«
»Ich habe verlauten lassen, sie sei mit dem geflohenen Knecht durchgebrannt.«
Mittlerweile hatte ich begonnen zu schwitzen. Vor allem der Sohn des Sebastian Löw stellte zu viele Fragen. Ich hatte nicht den Eindruck, daß er argwöhnisch war; er war nur neugierig. Aber er zwang mich zu hektischen Improvisationen. Ich wünschte mir, ich hätte doch verlangt, er solle uns alleine lassen.
»Hoffentlich kommt das den Eltern nicht zu Ohren«, sagte der Sohn des Löw, und ich hätte schreien mögen.
»Das habe ich in der Eile nicht bedacht«, erklärte ich mit zusammengebissenen Zähnen. Er sah mich an und hob die Schultern, als wolle er sagen: Man kann nicht an alles denken. Er sprach es aber nicht aus; im Gegenteil – endlich schwieg er. Ich wandte mich an seinen Vater.
»Ich dachte nun, Ihr könntet mir vielleicht helfen, Herr Löw. Ich brauche einen Totengräber, der die Beerdigung vornimmt.« Ich sprach zögernd, da ich nicht wußte, ob er es nicht als Zumutung auffaßte, nach einem Totengräber befragt zu werden. Aber seine Gesichtszüge veränderten sich nicht; er war ein praktisch denkender Mann. »Am besten noch heute: Mein Gesinde ist fast vollständig in der Stadt, um die Messe zu besuchen, und es wird niemandem auffallen.«
»Heute ist Feiertag«, sagte Löw nachdenklich und bewies, daß sein Reichtum nicht nur von geschickt angelegten Investitionen gekommen war. »Aber für ein entsprechendes Entgelt wird der eine oder andere sicher bereit sein …«
»Mit einem Totengräber ist es nicht getan«, mischte sich der junge Löw ein. »Ihr braucht einen Arzt, der die Todesursache beurkundet.«
Ich starrte ihn vollkommen überrascht an. Im ersten Moment konnte ich nichts darauf erwidern; eine vage Erinnerung lähmte meine Zunge. Ein älterer Mann, der professionelles Mitleid ausstrahlte, während er mich sanft von der Seite meiner toten Gattin schob und lateinische Phrasen murmelte; wahrscheinlich hatte ihn mein damaliger Verwalter kommen lassen. Eine Urkunde, die ich tränenblind und kraftlos unterzeichnete, ohne sie zu lesen – wenn ich sie überhaupt wahrnahm, dann in der Hoffnung, es möge mein Todesurteil sein, das sofort vollstreckt würde; und in gewisser Weise war es das auch. Es war meinem Gedächtnis völlig entschwunden gewesen.
»Fühlt Ihr Euch wohl?« hörte ich den alten Löw sagen.
»Ja«, krächzte ich und kehrte in die Gegenwart zurück. »Ja. Es war alles ein wenig viel auf einmal, befürchte ich. Ich brauche einen Arzt, sagt Ihr?«
»Schon zu Eurer eigenen Sicherheit. Wenn Euch die Eltern der Toten Schwierigkeiten machen …«
Sebastian Löw legte seinem Sohn die Hand auf den Arm.
»Du kannst die Urkunde ausstellen«, sagte er sanft. »Du bist Arzt.«
»Vater«, protestierte der junge Löw. »Ich bin noch nicht fertig mit dem Studium.«
»Aber du weißt bereits alles. Du hast es selbst gesagt.«
»Vater«, rief er nochmals gequält. »Das hat damit nichts zu tun!«
»Wieso nicht? Wenn dich das Wissen nicht mehr von einem ausgebildeten Medicus unterscheidet, was dann?«
Der junge Mann starrte seinen Vater verwirrt an.
»Was dann?« stieß er mit heller Stimme hervor. »Was dann? Ich bin eben noch kein ausgebildeter Arzt. Mir fehlen noch ein paar Semester!«
»Also entweder weißt du nun schon alles, und dann sehe ich den Unterschied nicht«, brummte der Apotheker, »oder du weißt noch nicht alles, und dann hast du die letzten Tage mächtig aufgeschnitten.«
Der Sohn des Apothekers errötete bis unter die Haarwurzeln. Er suchte nach einer Erwiderung. Gerade als ich sagen wollte, sie sollten den Streit beilegen, rief er empört: »Ich habe nicht aufgeschnitten!«
Löw zuckte mit den Achseln. »Also dann …«, sagte er herausfordernd.
»Herr Löw«, unterbrach ich hastig. »Es ist nicht nötig, daß Ihr Eurem Sohn so zusetzt. Vielleicht geht es auch ohne die Urkunde.«
»Ein großes Risiko für Euch«, wandte der junge Löw ein. »Wenn die Tote, wie Ihr sagt, die einzige Tochter ist, können die Eltern sich unberechenbar verhalten. Ihr braucht etwas, das Ihr im Notfall vorweisen könnt und das auch vor Gericht besteht.«
Ich konnte ihm nicht sagen, daß ich tatsächlich nichts brauchte, was vor Gericht irgend etwas aussagte. Innerlich stöhnte ich verzweifelt; ich wollte, er hätte sich nur halb so viele Gedanken um mein Wohlergehen gemacht.
Der junge Mann seufzte.
»Ich werde Euch die Urkunde ausstellen«, sagte er resigniert. »Mein Vater würde mir sonst doch keine Ruhe lassen. Ich werde sie als Studieus der Medizin unterzeichnen; das dürfte Euch im Fall des Falles zumindest fürs erste Luft verschaffen. Zur Not könnt Ihr die Urkunde später noch von einem Medicus beglaubigen lassen.«
Der alte Apotheker strahlte seinen Sohn an. Es fehlte nicht viel, und er hätte ihn umarmt.
»Seht Ihr? Mein Sohn. Da dies nun geklärt ist, werde ich mich um den Totengräber kümmern. Er wird nicht billig sein, aber er wird schweigen. Und ich werde versuchen, den Preis für Euch zu drücken.«
»Seid Ihr sicher, daß er nicht plaudern wird?«
»Absolut«, sagte er. »Ich kenne ihn gut; hoffentlich schockiert Euch dieses Geständnis nicht. Er hat als Knabe bei der großen Pest vor dreißig Jahren seine gesamte Familie verloren und sich durchgebracht, indem er die Pesttoten aus den Häusern abgeholt und verscharrt hat. Er bekam den Hauch des Schwarzen Tods selbst zu spüren, aber er hat ihn überlebt. Der Mann hat keine Veranlassung, aus Freude am Erzählen sein Mundwerk zu benutzen.«
Ich fühlte mich zu erschöpft, um darüber zu diskutieren. Ich konnte nur hoffen, daß ich weiterhin das Richtige tat; ich hatte mittlerweile nicht einmal mehr ein Gefühl dafür, wie ich mich verhalten sollte.
»Bitte verständigt ihn«, sagte ich.
»Es wird wohl eine Stunde dauern, bis er hier ist. Können wir Euch in der Zwischenzeit etwas anbieten? Wollt Ihr mit uns essen? Es wäre mir eine Ehre.«
»Nein, vielen Dank«, wehrte ich ab. »Ich will Euch nicht beleidigen, aber im Moment ist mir nicht nach Essen zumute.«
»Natürlich«, sagte er beruhigend. »Vielleicht ein andermal? Wenn Ihr diese unselige Geschichte hinter Euch gebracht habt.«
»Gerne«, sagte ich. »Wenn Ihr mich nun entschuldigen wollt – ich habe noch ein paar Dinge in die Wege zu leiten. Ich werde in einer Stunde wieder hier sein.«
»Der Totengräber und mein Sohn warten hier auf Euch. Ihr könnt sie dann mit zu Euch hinaus nehmen.«
»Sehr schön«, sagte ich. Er nickte und lächelte wieder so breit wie am Anfang.
»Wißt Ihr«, sagte er, »es ist mir eine wahre Freude, Euch behilflich zu sein. Eine noch größere ist es, Euch nun kennengelernt zu haben – wenn ich mir auch wünschte, es wäre unter für Euch angenehmeren Umständen geschehen. Ich verdanke Euch viel.«
»Ihr übertreibt«, sagte ich.
»Nein, nein«, rief er. »Seht nur, mittlerweile ist sogar die herzogliche Verwaltung auf mich aufmerksam geworden. Man hat mir und einem Zunftgenossen hier in Landshut die alleinige Ausstattung der Hochzeitsfeierlichkeiten mit Arzneien übertragen. Fünfhundert Gulden sind uns dafür avisiert, daß wir Konfekt und Tryett gegen das Podagra liefern.«
»Wogegen?« fragte ich unwillkürlich. Er lächelte nicht ohne Schadenfreude.
»Das Podagra«, sagte er. »Es verschließt den Darm und läßt das Gift nicht mehr aus dem Körper, und die Gebeine werden mürbe und schwellen an. Auch unser Herzog leidet daran; manchmal, so heißt es, kann er sich nicht einmal ohne Hilfe vom Lager wälzen. Er kommt vom üppigen und zu vielen Essen; unser Konfekt hilft, die Stoffe wieder abzuführen.« Er lächelte gemütlich. »Wenn Ihr Euch gestopft fühlt wie eine Martinigans – ein paar Zeltln und Stritzerl, und Ihr düngt den Boden wie kein zweiter.«
»Ein gutes Geschäft«, lobte ich und fragte mich unwillkürlich, ob er diesen Satz auch zur Anpreisung seiner Ware an die Käufer verwandte. Er strahlte.
»Ich habe nur von Euch gelernt.«
Ich sagte ihm irgendeine Artigkeit zur Antwort, und er schüttelte wieder meine Hand und geleitete mich zur Tür. Ich verabschiedete mich auch von seinem Sohn; im Gegensatz zum Vater hatte er harte, lange Finger und einen fast schmerzhaften Händedruck.
»Ich danke Euch für Euer Entgegenkommen«, sagte ich. Er winkte ab.
»Meinem Vater liegt viel daran, und ich will ihm ein guter Sohn sein«, sagte er einfach.
Ich ging hinaus, und die beiden schlossen die Tür hinter mir. Der Nebel hatte sich verflüchtigt, und die Sonne lag auf den Hausfassaden, ohne sie zu wärmen. Innerhalb kurzer Zeit hatte ich mehr erreicht, als ich zu hoffen gewagt hatte; aber ich gewann nicht den Eindruck, daß ich selbst das Geschehen gesteuert hatte. Ich fühlte eine eisige Beklemmung. Hatte ich mich auf etwas eingelassen, das sich von mir auch nicht steuern ließ? Daneben spürte ich den bekannten Neid auf das gegenseitige Vertrauen, das Vater und Sohn eben vor mir demonstriert hatten. Am meisten aber fühlte ich Erstaunen, daß mir der Apotheker so bereitwillig helfen wollte. Er hatte sich wie ein Freund verhalten. Ich hatte immer gedacht, neben Hanns Altdorfer keinen Freund in der Stadt zu haben; vielleicht hatte ich eine Gelegenheit versäumt. Ich stand im hellen Schein der Morgensonne und fröstelte.
Hanns Altdorfer war im Rathaus; es war nicht anders zu erwarten gewesen. Die beiden Schreiber, die er beschäftigte, hatte er für den Feiertag nach Hause gesandt, er selbst hatte sich jedoch wieder am Ort seiner Arbeit eingefunden. Ich erinnerte mich, daß er gesagt hatte, der junge Herzog habe sein Haus für die Brautkammer auserkoren und er selbst würde nun Tag und Nacht im Rathaus verbringen. Sollte ich es ihm nicht geglaubt haben, hatte ich hier nun den Beweis.
Als ich in seine Kammer eintrat, sah ich ihn ruhelos auf und ab gehen. Das dick verglaste Fenster seiner Arbeitsstube ließ einen verzerrten Blick auf die gegenüberliegende Häuserreihe zu, deren bunte Fassaden im Sonnenlicht erstrahlten, aber er sah nicht hinaus. Er hielt den Blick auf den Bretterboden gerichtet und schien seine Schritte zu zählen. Bei meinem Eintreten blickte er auf; seine Augen waren groß und vor Erregung feucht.
»Mach die Tür zu«, sagte er statt einer Begrüßung. Ich folgte seinem Wunsch, und er trat auf mich zu und zog mich in eine Ecke des Raumes, obwohl niemand im Rathaus war, der uns hätte hören können.
»Ich habe die ganze Zeit hier auf dich gewartet. Was hast du bisher erreicht?«
»Ich habe die Leiche in einem leerstehenden Lager aufgebahrt, ohne daß es jemand bemerkt hätte. Nur der Verwalter ist eingeweiht, und ihm habe ich die Geschichte aufgebunden, die ich heute morgen schon dir und dem Richter erzählte.«
»Daß sie eine Badehure aus dem Frauenhaus war?«
»Ich habe mich über die Details nicht verbreitet«, antwortete ich unwillig.
»Wie wirst du jetzt weiter vorgehen? Du kannst sie nicht ewig in deinem Haus liegen lassen.«
»Noch heute vormittag wird eine Beerdigung auf meinem Hof stattfinden. Mein Gesinde ist so gut wie vollzählig in der Messe; niemand wird etwas bemerken. Ich habe mich an einen Mann in der Stadt gewandt, der absolut vertrauenswürdig ist.« Ich verkniff mir die Bemerkung, daß ich mir über die Richtigkeit meines Tuns durchaus nicht so sicher war. Ich wollte ihn nicht noch mehr beunruhigen, und vor allem wollte ich nicht etwas heraufbereden. Dinge beim Namen zu nennen heißt, ihrem Eintreten Tür und Tor zu öffnen.
Er sah mich eine Weile schweigend an.
»Du beerdigst sie auf deinem Hof; auf dem Friedhof hinter der Holunderhecke«, sagte er sanft. Es war diese Sanftheit in seiner Stimme, die meine Seele wieder Schmerzen ließ.
»Genau dort«, erwiderte ich und bemühte mich, meine Stimme ruhig klingen zu lassen. Er antwortete nichts darauf. Vielleicht scheute er sich, noch tiefer in der Wunde zu bohren, von der er wußte, daß sie sich niemals richtig geschlossen hatte. Hinter der Holunderhecke lag das Grab meiner Frau und des toten Kindes, bei dessen Geburt sie ums Leben gekommen war.
Ich sagte: »Hat jemand daran gedacht, Doktor Federkiel zu verständigen?«
Er winkte ab. »Er ist ein Mitglied des Gefolges, das die Prinzessin in Wittenberg in Empfang genommen hat«, sagte er und lächelte schief. »Er ließ es sich nicht nehmen. Und da weder Herzog Ludwig noch der junge Georg an diesem Gefolge teilnehmen, kann es nicht schaden, wenn seine Eitelkeit wenigstens ein bißchen Glanz verbreitet. Die Peinlichkeit, daß weder der Bräutigam noch sein Vater die Braut in Empfang nehmen wollen, ist ohnehin schon groß genug, nicht wahr? Vermutlich mußte zudem dem Doktor Federkiel ein kleiner Ausgleich dafür geschaffen werden, daß nicht er, sondern der Bischof von Salzburg die Trauung vornimmt.«
Ich hob die Augenbrauen. Altdorfer fuhr fort: »Doktor Mair hat mir die Zusammenstellung des Empfangskomitees damit erklärt, daß der Herzog und sein Sohn auf der Burg alles für die Ankunft des Kaisers vorbereiten und deshalb unabkömmlich seien. Auf der anderen Seite ist es so, daß der Kaiser und sein Sohn im Zollhaus hier in der Stadt logieren werden. Nun, ich denke, er weiß, wovon er redet.«
Er seufzte und wandte sich wieder dem Grund zu, dessentwegen ich ihn aufgesucht hatte.
»Der Stellvertreter des guten Doktor Federkiel ist von den ganzen Aktivitäten heute nacht nicht einmal wach geworden«, sagte er. »Richter Girigel hat ihn mittlerweile besucht und ihm erklärt, daß wir Sicherheitsmaßnahmen für die Trauung des jungen Herzog geprobt hätten.«
»Nicht schlecht, Hanns. Nur daß wir jetzt schon eine vierte Version des nächtlichen Geschehens in Umlauf haben. Ich habe auch zwei unterschiedliche Varianten erfunden.«
Er legte die Stirn in Falten. »Hältst du es für bedenklich?« fragte er unruhig.
»Ich weiß nicht«, sagte ich ehrlich. »Vielleicht ist es ganz nützlich, mehrere verschiedene Gerüchte zu streuen, die sich gegenseitig neutralisieren können. Aber ich beginne den Überblick zu verlieren, und das halte ich für gefährlich.«
»Wir werden uns künftig aus allem heraushalten«, versprach er, »und die Angelegenheit dir überlassen.«
Ich nickte unglücklich. »So muß es wohl sein.«
Er hob die Hände halb und ließ sie wieder fallen. Als ich nichts sagte, wandte er sich ab und sah nun doch zum Fenster hinaus. Ich war mir sicher, daß er die strahlenden Häuserfassaden gegenüber kaum wahrnahm. Ich hoffte, er würde sich nicht dafür entschuldigen, daß er sich an mich gewandt hatte; er tat es nicht. Nach einem Moment trat ich neben ihn. Diejenigen Bauernkarren, die ich vor den Stadttoren getroffen hatte, waren schon längst vorbeigerumpelt, während ich noch mit dem Apotheker gesprochen hatte; jetzt kamen weitere, und eine Menge Volk zu Fuß. Alle strebten dem Neubau des Doms zu.
Ich sagte: »Das sieht beinahe aus wie der Beginn eines Bauernaufstands.«
»Du kommst zu selten in die Stadt. So ist es an jedem Feiertag; wenn nicht gerade Allerheiligen und Tanzverbot wäre, könntest du sogar noch viel mehr Volk sehen. Keine Gefahr, daß jemand eine Fahne mit dem Bundschuh schwenkt und reiche Kaufleute und Patrizier verprügelt.«
»Oder die Gäule der Adligen füttern geht«, sagte ich. Er sah mich verständnislos an, und ich mußte gegen meinen Willen lächeln.
»Gibt es nicht einen Bauernspruch, daß der Herrgott die Gäule beschützen möge, sonst würden die reichen Herren noch auf den Bauern reiten?«
Er schnaubte und wies mit dem Daumen über die Schulter zum Fenster hinaus.
»Wenn das Namensfest von Sankt Martin ansteht, wird hier eine gewaltige Kirmes abgehalten. Du kannst es dir ja einmal ansehen. Martini ist in zehn Tagen; dann tanzen sie auf der Straße und feiern bis zum Umfallen. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch weiter ausufern als üblich, mit der Ankunft der Prinzessin gleich danach. Ich habe schon gehört, daß sich das Tanzfieber bis zur Besessenheit gesteigert hat.«
»Hier in Landshut?«
»Eher drüben an der Grenze nach Brabant und Burgund, glaube ich. Unser Volk ist dafür wohl doch ein wenig zu schwerfällig. Aber manchmal habe ich schon gedacht, daß es gleich soweit sein wird und alle im Veitstanz herumspringen.«
Es belustigte mich, ihn so sprechen zu hören. Vermutlich wußte er es nicht, aber in seinen Worten war jedesmal eine Mischung aus Verachtung und Mitgefühl für die einfachen Bauersleute zu hören, wenn er auf sie zu sprechen kam, und zugleich eine Art von ungläubigem Staunen, als könne er die Drolligkeit ihrer Gebräuche niemals zur Gänze verstehen. In diesem Punkt hatte er sich nicht geändert, seit wir uns kannten.
»Wohin fahren diese Leute?« fragte ich.
»Zum Dom. Seit das Gerüst das Langhaus freigegeben hat und man den Turm in die Höhe wachsen sieht, ist er ein gewaltiger Anziehungspunkt.«
»Meister Stethaimer bekommt ein großes Publikum«, murmelte ich. Hanns Altdorfer sah mich von der Seite her an.
»Er freut sich nicht gerade darüber«, sagte er. »Nach jedem Festtag, wenn die Bauern von außerhalb auf der Baustelle herumklettern und Maulaffen feilhalten, kommt er und beklagt sich bei mir. Steinmetzarbeiten werden beschädigt, Bretter und Werkzeuge gestohlen und angeblich unschuldige Bauernmägde hinter den Handwerkerbuden verführt.«
Ich sah wieder zum Fenster hinaus. Wenn ich um den Rahmen herumspähte, konnte ich Sebastian Löws Haus erkennen; ich würde bald wieder hinübergehen müssen und den schweigsamen Totengräber zusammen mit Löws Sohn zu meinem Hof bringen. Mir wurde flau, als ich daran dachte, was danach geschehen würde: Eine rasche Untersuchung der Toten, ein heimlicher Transport in den hinteren Teil der unbebauten Fläche meines Grundstücks, eine flache Grube, in die der zerschundene Leib gesenkt wurde, ein kurzes Gebet. Ich stellte mir das Gesicht des Totengräbers vor; ich dachte es mir hager und voller Narben. Wieviel würde er dafür verlangen, daß er am Feiertag eine Leiche unter die Erde brachte und zu niemandem darüber sprach?
Als hätte Hanns Altdorfer den letzten Teil meiner Gedanken verstanden, sagte er plötzlich: »Ich soll dir im Auftrag des Kanzlers mitteilen, daß sämtliche deiner Auslagen aus der herzoglichen Truhe beglichen werden.«
»Darauf habe ich mich verlassen. Es mag sein, daß ich ein paar Bestechungsgelder zu bezahlen habe. Ich werde versuchen, nicht zu übertreiben.«
»Wenn diese Hochzeit nur die Hälfte von dem kostet, was Doktor Mair und ich bis jetzt überschlagen haben, kannst du dir ein Söldnerheer mieten und dem Papst eine Grafschaft erobern helfen, und niemandem werden die Kosten auffallen. Doktor Mair rechnet mit mindestens fünfzigtausend rheinischen und ungarischen Gulden.«
Ich wäre kein Kaufmann gewesen, wenn mich diese Zahl nicht wenigstens für den Augenblick aus meinen düsteren Gedanken gerissen hätte.
»Wieviel?« keuchte ich. »Soviel Geld besitzt die ganze niederbayrische Kaufmannszunft nicht.«
»Was glaubst du, was die Bewirtung all der Gäste kostet? Allein der Kaiser wird mit einem Gefolge von siebenhundert Pferden erwartet, und du weißt, daß er ein armer Kaiser ist. Er hat es sich zwar nicht nehmen lassen, den Boten unseres Herzogs die Zusage zu seiner persönlichen Einladung mit sechs Trompetern und vier Pfeifern bekanntzugeben, als sie in einer Herberge in Köln auf seine Erwiderung warteten, aber daraus sieht man nur, daß er gerne prätentiöser auftritt, als er es sich leisten kann.« Altdorf er lachte humorlos. »Der Markgraf von Brandenburg soll sogar mit der doppelten Menge Gefolge anreisen. Wahrscheinlich traut er dem Frieden nicht, den ihm der Herzog in der Einladung versprochen hat. Von den anderen Fürsten weiß ich noch nichts. Aber allein mit den Leuten dieser beiden Herren wird die Stadt einem Heerlager gleichen. Außerdem sollen wenigstens drei große Turniere veranstaltet werden.«
»Dem Volk werden die Augen herausfallen vor Neid.«
»Ich glaube kaum. Der Herzog hat Befehl gegeben, daß die Bürger die ganze Zeit freigehalten werden. Kein Wirt darf für Geld verköstigen, kein Metzger, kein Bäcker, kein Fischer irgend etwas verkaufen.«
»So langsam«, sagte ich, »rechnen sich die Kosten zusammen.«
»Der Herzog wird nachher ruiniert sein. Meines Wissens hat er selbst einen Teil der Mitgift für die Prinzessin in die Kosten eingerechnet. Du siehst, das Gelingen dieser Hochzeit ist auch eine Geldfrage.«
»Alles ist letztlich eine Geldfrage«, sagte ich garstig.
»Die Philosophie eines Kaufmanns«, erwiderte er mit einem leisen Hauch seines gewohnten Humors. Ich lächelte müde, und er schloß die Augen und nickte verständnisvoll.
»Hast du geschlafen seit heute morgen?«
»Mit einer heimlichen Leiche in einem Lagerraum? Und du?«
»Weder geschlafen noch gegessen«, seufzte er. »Nicht, daß ich hungrig wäre. Aber müde bin ich doch.«
»Ich werde wieder aufbrechen. Ich muß noch einer Beerdigung beiwohnen. Ich halte dich auf dem laufenden, Hanns.«
Er nahm meinen Oberarm und drückte ihn leicht.
»Ich weiß, daß es schmerzhaft ist für dich«, sagte er. »Wenn du das Gefühl hast, du störst die letzte Ruhestätte Marias, dann begrabe sie anderswo.«
»Es ist schon in Ordnung«, erwiderte ich nicht ganz ehrlich. »Mach dir keine Gedanken.«
Er geleitete mich bis zur Tür.
»Würdest du Herrn Moniwid auch verständigen?« fragte er.
Ich drehte mich nochmals zu ihm um.
»Wenn mich nicht alles täuscht, logiert seit dem letzten Sommer im Haus des Walther vom Feld ein Botschafter des polnischen Königs«, sagte ich. »Ich dachte, Moniwid sei ihm unterstellt. Wann willst du ihn informieren?«
»Überhaupt nicht, hoffe ich«, seufzte Altdorfer.
»Weshalb nicht? Schlimmer als Moniwid kann er auch nicht sein; und auf jeden Fall wird er über mehr Einfluß verfügen als jener.«
»Er hat gar keinen Einfluß«, stellte Altdorfer unwillig richtig. »Er ist ein alter Trunkenbold, der seinen Mägden unter die Röcke greift und dem Herzog auf der Tasche liegt, seit dieser ihm bei seiner Ankunft ein edles Pferd zum Geschenk machte. Doktor Mair sagte, er habe ihn noch keinen einzigen Tag nüchtern gesehen. Wir müssen uns schon an Albert Moniwid halten.«
»Das habe ich befürchtet«, sagte ich düster. »Ich kann nicht garantieren, daß ich ihn bei unserer nächsten Begegnung nicht anspringe.«
Altdorfer machte ein mißbilligendes Gesicht.
»Wir müssen uns gut mit ihm stellen, sonst setzt er sich noch über unsere Abmachung hinweg«, ermahnte er mich ernst. »Er ist ein äußerst einflußreicher und finanziell unabhängiger Mann. Man hört, daß er mit dem Troß der Prinzessin in Wittenberg eingezogen ist wie der König selbst, mit einem gewaltigen Hengst, der mit einem goldenen Tuch voller Perlen bedeckt war; sein Knappe trug ein Kleid aus derselben Machart.«
»Er hat einen unaufdringlichen Geschmack, wie mir scheint«, sagte ich boshaft. »Aber ich wollte ihn ohnehin aufsuchen und seine Erlaubnis erwirken, mit seiner Gesandtschaft zu sprechen, um mehr über die Tote zu erfahren. Ich wette, er hat sowohl gut geschlafen als auch gut gegessen und fühlt sich wohl bei dem Gedanken, wie wir uns hier abmühen.«
»Es ist eine seiner Schutzbefohlenen ermordet worden, vergiß das nicht. Ich glaube nicht, daß er die Sache auf die leichte Schulter nimmt.«
»Ach was«, sagte ich. »Er hat eine diebische Freude dabei, die Schweißtropfen auf unseren Stirnen zu zählen.«
»Du magst ihn nur nicht«, stellte Altdorfer fest.
»Sehr richtig«, sagte ich und griff nach der Tür. »Und das ist das einzige an der ganzen Geschichte, das mir kein Magendrücken verursacht.«
Sebastian Löw hatte seine Aussage, er würde sich gerne um meine Probleme bemühen, wahr gemacht; als ich wieder bei ihm vorsprach, befand sich der Totengräber bereits bei ihm. Er hatte ihn wahrscheinlich durch die Hintertür ins Haus gelassen. Der Totengräber enttäuschte mich in einer Hinsicht: Er war ein kleiner Mann mit einem runden Gesicht und einer strahlenden Stirnglatze. Was seine Schweigsamkeit anging, war er keine Enttäuschung; er nickte nur knapp zu meiner Begrüßung und äußerte weder Erstaunen noch Unmut über seinen ungewöhnlichen Auftrag. Seine hellen Augen hielten meine einen Augenblick lang ohne jede Anteilnahme fest, bevor sich ihr Blick wieder in die Ferne richtete. Die Augenwinkel selbst waren gänzlich ohne Falten. Er schien kaum jemals zu lachen. Plötzlich war ich froh, daß dieser Mann niemanden unter die Erde brachte, der mir nahestand.
Ich führte ihn und den jungen Löw zu meinem Hof zurück, gegen den beständigen Strom an Stadtbewohnern und Besuchern, die sich alle zum Martinsdom hinunter begaben. Ich hatte ein ungutes Gefühl dabei, mich mit dem Mann in der Öffentlichkeit zu zeigen, obwohl ich nicht erwartete, daß mich jemand kennen würde; der Sohn des Apothekers dagegen bewegte sich unbefangen, entweder durch sein Studium über den Dingen stehend oder sich der sozialen Fehlleistung, in Begleitung des Totengräbers gesehen zu werden, nicht bewußt. Es stellte sich jedoch heraus, daß uns niemand auch nur einen zweiten Blick schenkte. Zwischen dem Spitaler Tor und dem Blauen Turm drängten sich die Menschen um den Eingang der Heilig-Geist-Kirche. Wahrscheinlich erwarteten sie den Beginn einer Prozession, die durch die gesamte Länge der Stadt hinunter zum neuen Dom führen würde, um sich ihr anzuschließen. Wir drängten uns durch die Menge, ohne im geringsten aufzufallen. Während wir die Tore hinter uns ließen und die Grüße der Leute erwiderten, die uns außerhalb der Stadt entgegenkamen, befürchtete ich, daß wir auf Mitglieder meines Gesindes stoßen mochten; aber dann beruhigte ich mich: Selbst wenn noch einige Nachzügler unterwegs zur Stadt waren, würden sie in Erwartung der festtäglichen Aufregungen so gebannt sein, daß ich ihnen vermutlich nicht einmal auffiel – und wenn, würden sie weder aus meinem noch dem Anblick meiner Begleiter irgendeinen Verdacht schöpfen.
Unser Weg verlief schweigsam. Ich war zu angespannt, um viel zu sprechen, und Löw schien meine Verfassung zu respektieren und antwortete nur, wenn ich ihn etwas fragte. Der Totengräber marschierte stumm hinter uns her und machte keinerlei Anstalten, überhaupt etwas zu sagen. Ich fragte den jungen Mann, warum er den weiten Weg nach Innsbruck gemacht habe, um dort zu studieren, und er erklärte mir, daß Herzog Ludwig die Universität in Ingolstadt zu spät gegründet habe. Er hatte sich bereits vor fünf Jahren in Innsbruck eingeschrieben, Ludwig die Ingolstädter Universität aber erst vor drei Jahren gegründet. Ich hatte außerdem das Gefühl, daß er froh gewesen war, dadurch dem Einfluß seines Vaters ein wenig zu entkommen.
Auf meinem Hof waren nur die alten Männer und Weiber und ein paar Kleinkinder übriggeblieben. Sie saßen auf Bänken und Hackklötzen in der Sonne, die Männer mit dem Schnitzen irgendwelcher Werkzeuge, die Weiber mit Rickarbeiten beschäftigt. Sie begrüßten mich ehrerbietig, ohne unserer Gruppe besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Um das Haus herum roch es bereits nach heißem Fett und den aus Hefeteig gebackenen Wecken, die heute nachmittag und morgen an die Kinder des Gesindes und an die um Almosen für die Waisen bettelnden Klosterschwestern des nahen Konvents ausgegeben wurden. Ich hatte mich immer wie ein kleiner Junge auf die süßen Wecken und Zöpfe gefreut, die die Mägde in der vor Hitze und Feuchtigkeit brüllenden Küche zubereiteten. Seit Marias Tod war mir ihr Geschmack verleidet. Die alten Frauen nannten sie Seelenwecken und behaupteten, sie würden gebacken, um die Seelen der Toten zu bewirten, die um Allerheiligen und Allerseelen unter ihren Angehörigen weilten. Allein der Gedanke daran raubte mir das Gleichgewicht.
Ich führte die beiden Männer in das Wohngebäude.
»Wo befindet sich die Tote?« fragte der junge Löw.
»Ich bringe Euch hin. Braucht Ihr irgendeine Hilfe?« Ich schluckte, als ich daran dachte, er könne die Frage bejahen und mich darum bitten. Ich hatte kein Begehren, mich mit der Leiche zu befassen.
»Der Herr Totengräber wird mir assistieren«, sagte er. »Ihr könnt der Untersuchung selbstverständlich beiwohnen, wenn Ihr dies wünscht. Sie dauert nicht lange.«
»Vielen Dank«, erwiderte ich. »Ich ziehe es vor, hier in der Stube auf Euch zu warten.«
Er nickte, und ich brachte die beiden Männer zu der verschlossenen Tür. Meine Hände zitterten, als ich den Schlüssel herumdrehte. Noch während ich die Klinke nach unten drückte, war ich mir plötzlich sicher, daß der Raum voller Leute sein würde, die mich vorwurfsvoll anstarrten. Mein Herz klopfte wild; die Vorstellung ließ sich nicht abschütteln. Als ich hineinspähte und das Lager leer fand bis auf die verhüllte Gestalt der Toten, war ich beinahe überrascht. Das Sonnenlicht strömte jetzt ungehindert zur Fensteröffnung herein und lag auf dem Tuch, das ihre Umrisse bedeckte. Ich dachte daran, daß es den Körper unter dem Tuch nicht mehr erwärmen konnte.
»Wir haben sie dort aufgebahrt«, sagte ich rauh.
Löw und der Totengräber betraten den Raum und nickten mir zu. Ich gab dem jungen Mann den Schlüssel. »Bitte sperrt ab; ich will vermeiden, daß zufällig jemand zu Euch hineinplatzt.«
Er nickte nochmals. Ich schloß die Tür hinter mir zu und atmete tief ein. Einen Augenblick stand ich noch vor der geschlossenen Tür; das Geräusch des Schlüssels im Schloß ließ mich hochschrecken. Ich ging steifbeinig und voller Nervosität zurück zur Stube.
Die Zeit dort wurde mir lang. Ich konnte nicht verhindern, daß mein aufgewühlter Geist auf Wanderschaft ging, und mir fiel ein, daß ich so auf die Geburt meiner beiden Töchter gewartet hatte: allein in der Stube meines damals noch kleinen Stadthauses neben dem bischöflichen Palast in Augsburg. Aus dem Warten damals waren zwei aus Leibeskräften krähende junge Leben hervorgegangen; heute wartete ich darauf, daß der Tod eines anderen jungen Lebens beurkundet wurde. Der Gedanke daran brachte mir die Tote noch ein Stück näher, und die Ironie, daß sich die polnische Gräfin im Leben nicht einmal nach mir umgedreht haben würde, nahm nichts von der Grimmigkeit hinweg. Ich dachte weiter: Die Geburt meines Sohnes Daniel hatte ich ebenfalls voller Aufregung erwartet, aber es war weniger des Geburtsvorgangs wegen gewesen als aufgrund der eben entbrannten Fehde zwischen Herzog Ludwig und Markgraf Albrecht von Brandenburg; der Bischof hatte mich informiert, daß er mich als seinen Assistenten wünschte, um die Bedingungen für einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden zu verhandeln, und ich brannte vor Neugier auf diesen Auftrag. Bei der vierten Geburt schließlich, die unter meinem Dach stattfand, war ich vollkommen gelassen gewesen; es schien mir nur ein weiterer, alltäglich gewordener Vorgang zu sein und Marias Schwäche und Blässe in den letzten Wochen vor der Niederkunft lediglich ein Zeichen, daß für sie das Alter gekommen war, in dem sie keine Kinder mehr erwarten sollte. Ich hatte mich nicht weiter darum bekümmert; hätte ich es getan, vielleicht wäre alles anders gekommen. Gott straft dann, wenn man nicht darauf gefaßt ist.
Die Stubentür öffnete sich langsam, und ich sah auf und erwartete, meinen Verwalter hereinkommen zu sehen. Statt dessen stand der Totengräber auf der Schwelle.
»Würdet Ihr bitte mitkommen?« fragte er. Er hatte eine Stimme, die zu seiner Erscheinung paßte: präzise und ohne Gefühlsschwankungen. Es war nicht die Stimme, um kommendes Unheil zu verkünden, aber ich wußte dennoch, daß etwas Unvorhergesehenes geschehen war. Ich wollte aufstehen und fand im ersten Moment keine Kraft dafür.
»Was ist geschehen?« fragte ich schwach.
»Er wird es Euch mitteilen. Bitte kommt.«
Ich kroch hinter dem Tisch hervor und folgte ihm mit schweren Beinen. Was immer mir der Apothekerssohn sagen wollte, ich hatte keine Lust, es zu hören. Ich wollte, daß die Tote endlich unter die Erde gebracht wurde, damit ich wieder klar denken konnte.
Löw erwartete mich mit ernstem Gesicht. Als ich in den Lagerraum trat, schloß er die Tür hinter mir ab. Ich versuchte zu vermeiden, lange in die Richtung der Toten zu blicken; ich sah den Schimmer ihrer Haut im Sonnenlicht und das zerknüllte Tuch, das zu Füßen der Bahre auf dem Boden lag, bevor ich meine Augen auf Löws Gesicht richtete. Er hatte eine steile Falte zwischen den Augenbrauen. Ich fühlte eine leichte Übelkeit, während ich seine Auskunft erwartete. Er setzte zum Sprechen an, unterbrach sich und begann von neuem. Was er sagte, traf mich so unvorbereitet, daß ich es im ersten Augenblick nicht einmal verstand.
»Die Frau ist nicht vergewaltigt worden«, sagte er.
»Was sagt Ihr?« rief ich.
»Man hat sie nicht vergewaltigt«, wiederholte er. »Nicht in dem Sinne, den man diesem Wort gemeinhin hinterlegt. Man hat den Leichnam berührt und ihm Verletzungen zugefügt, die auf einen Koitus hindeuten, und ohne Zweifel bedeutet das die Schändung des Körpers. Aber ich wiederhole: des Körpers. Es fand kein aufgezwungener Verkehr statt, und die Frau war schon tot, bevor man sich mit ihrem Leib befaßte.«
Ich fühlte mich schwindlig; ich befürchtete, daß ich den Sinn seiner Worte nicht ganz erfaßte. Ich warf einen Blick auf den Totengräber, der mit verschränkten Armen neben uns stand, doch seine Augen waren unbeteiligt in die Ferne gerichtet.
»Wie meint Ihr das?«
Er atmete tief ein, dann stieß er den Atem aus. Mit einer brüsken Bewegung marschierte er um mich herum.
»Ich zeige es Euch«, sagte er, und zu meinem Entsetzen führte er mich zu der aufgebahrten Leiche. Ich folgte ihm willenlos. Sie war schon tot, bevor man sich mit ihrem Leib befaßte.
»Seht hier.«
Meine Blicke folgten seiner ausgestreckten Hand, die leicht über den erstarrten Körper glitt und mit kundigen Fingern auf die Stellen wies, die seine Vermutung unterstützten. Währenddessen erklärte er mir, was das, was meine Augen sahen, zu bedeuten hatte. Er war noch jung genug, um bestürzt über seine eigene Entdeckung zu sein, und er drückte sich aus diesem Grund anders aus, als er es vielleicht sonst tat, wenn er seinen Mitstudenten oder einem Mentor etwas erläutern mußte. Die ganze Zeit über befand er sich auf der anderen Seite des toten Mädchen, als wünschte er, daß mein Blick durch nichts behindert würde.
Er hatte mit einem Tuch den festgebackenen Lehm von den Stellen entfernt, die er untersucht hatte. Das Gesicht hatte nicht dazu gehört; es war noch immer verklebt und von einer mittlerweile getrockneten, käsig weißen Schicht überzogen, die der Farbe ihrer toten Haut erstaunlich ähnelte. Selbst wenn jemand Wert darauf gelegt hätte, wäre es ihm unmöglich gewesen, ihre Züge genau zu erkennen oder zu entscheiden, ob sie schön oder häßlich gewesen war. Sein Untersuchungsziel war der Leib der Toten gewesen, und was sich zwischen den Knien und dem Kopf befand, hatte er gründlich gesäubert.
»Ihr seht diese dunklen, blauroten Flecken an ihrem Hals, wo die Haut aufgeschunden und rauh wirkt? Der Mörder hat hier seine Hände angelegt und ihr den Atem abgedrückt. Es dauert eine Weile, bis der Tod auf diese Weise eintritt, selbst bei Hinrichtungen, wo der Delinquent gefesselt ist und sich nicht wehren kann. Wir dürfen annehmen, daß sie sich gewehrt hat: Der Mörder mußte sie niederhalten, und er tat es vermutlich, indem er sich auf ihren Körper kniete. Hier an den Rippen und darüber an den Brüsten ist das Fleisch bösartig gequetscht. Die Adern sind geplatzt und haben diese großen blauen und gelben Stellen verursacht, als sich das Blut in das Gewebe ergoß. An dieser Stelle hier unterhalb der Achsel ist die Haut so tief abgeschürft, daß die Rippenknochen darunter zu sehen sind – vielleicht wurde sie über einen scharfkantigen Gegenstand gewälzt, einen Stein oder dergleichen. Ich nehme an, daß es trotzdem noch einige Zeit dauerte, bis ihre Gegenwehr erlahmte. Vermutlich hat sie sich in der Agonie mehrmals auf die Zunge gebissen; daran habe ich nicht gedacht. Man könnte den Mund öffnen und …«
»Bitte nicht«, würgte ich hervor, und seine Hand zuckte zurück.
»Hier unten an den Hüftknochen ist die Haut aufgeplatzt und das Fleisch verletzt, aber man sieht keine so großen verfärbten Stellen wie die am Oberkörper, die ich Euch gezeigt habe. Sie wurde geschlagen, wahrscheinlich mit einem harten Gegenstand, aber sie war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Das Blut floß nicht mehr durch die Adern, und folglich konnte sich nur wenig in das Gewebe ergießen, als die Adern zerrissen. Das Blut an ihren Schenkeln stammte mit Sicherheit von der tiefen Aufschürfung an ihren Rippen und wurde später hier verschmiert, um den Eindruck der Vergewaltigung einer Lebenden vorzutäuschen. Das gleiche gilt für die vaginalen Verletzungen. Ich habe festgestellt, daß …«
»Hört auf«, sagte ich. »Ich habe es mittlerweile verstanden.« Er starrte mich einen Moment an, dann fuhr er fort.
»Nein, Herr Bernward. Es ist wichtig, daß Ihr alles begreift. Auch ich habe es erst nach und nach begriffen. Die Verletzungen ihres Schoßes passierten nicht nur, als das Leben schon aus ihrem Körper gewichen war; sie wurden ihr mit einem Instrument zugefügt, das mit einem männlichen Glied nur die grobe Form gemeinsam hat. Ich habe, um ganz sicher zu gehen, den Innenraum ihres Geschlechts untersucht: Ich habe erstarrtes Blut gefunden, das wahrscheinlich von den Pressungen herrührt, mit denen sich ihre Muskeln gegen die Erdrosselung wehrten, aber ich habe keinerlei Anzeichen für männlichen Samen entdeckt. Da ich davon ausgehe, daß ein Mann, der einer Frau so etwas antut, darin seine Befriedigung finden will, müßten aber Anzeichen eines Ergusses vorhanden sein. Wenn Euch das noch nicht genügt, seht Euch die Verletzungen ihres Schoßes an. Sie sprechen für sich; kein menschlicher Penis, und sei er noch so stark erigiert, könnte das zarte Gewebe dort derart zerreißen.«
»Wollt Ihr damit sagen …?«
»Ich will damit sagen, daß derjenige, der sie erdrosselt hat, weder davor noch danach Verkehr mit ihr hatte; sich aber gewaltige Mühe gab, einen solchen vorzutäuschen. «
»Weshalb sollte jemand so etwas tun?«
»Das frage ich Euch, Herr Bern ward.«
Ich sah von der Toten auf in sein blasses, verschlossenes Jungengesicht. Ein Verdacht keimte in mir auf, der so ungeheuerlich war, daß mir der Atem ausging.
»Glaubt Ihr, ich selbst wäre es gewesen?« keuchte ich. Er starrte mich weiterhin an, dann schüttelte er plötzlich den Kopf.
»Das nicht«, sagte er. »Ich habe mir Eure Hände angesehen. Sie passen nicht zu den Würgemalen an ihrem Hals. Und ich habe noch etwas entdeckt.« Er schob eine Hand vorsichtig unter den Nacken der Toten. Trotz der Leichenstarre konnte er ihren Kopf leicht hin und her bewegen.
»Das Genick ist gebrochen. Der Mörder hatte nicht genügend Kraft, sie vollends zu erwürgen, oder er hatte nicht genügend Zeit. Ich denke, er hat ihr, als sie schon halb besinnungslos war, buchstäblich den Hals umgedreht. Was den Zeitfaktor angeht, kann ich nichts dazu sagen, aber von der Statur her wärt Ihr durchaus in der Lage, einen Menschen durch Erdrosseln zu Tode zu bringen. Ihr hättet es nicht nötig gehabt, ihr noch das Genick zu brechen. Womit ich Euch nicht beleidigen will, Herr Bernward, ich will Euch nur sagen, daß ich Euch nicht für den Täter halte. Dennoch …«
»Was?«
»Dennoch scheint mir in diesem Licht die Geschichte, die Ihr erzählt habt, ein wenig fragwürdig. Ganz abgesehen davon, daß dies meine erste Hofmagd ist, deren Haut so blaß ist wie die einer Edeldame und die sich den Aufwand leistete, ihre Scham gründlich auszurasieren.«
Ich starrte ihm wortlos ins Gesicht. Mein Mund arbeitete, aber ich brachte nichts hervor. Ich fühlte, daß meine Wangen brannten. Ich konnte ihn davonschicken, ohne ihm weiter Rede und Antwort zu stehen, ich konnte ihm eine neue Lügengeschichte erzählen, ich konnte ihm die Wahrheit erzählen und ihn mit des Herzogs tiefer Geldtruhe im Rücken fürstlich bestechen; ihn und den Totengräber, der regungslos gelauscht hatte und den Blick weiterhin nach einem Ort gerichtet hatte, in dem verwaiste Jungen, die Pesttote zu den Massengräbern vor den Stadttoren schleppen, einsame alte Männer, die einen merkwürdigen Tod zu verbergen haben, und erdrosselte junge Frauen nicht vorkamen. Ich konnte mich auch entschließen, ihm zu vertrauen, was ich wohl schon von Anfang an hätte tun sollen. Ich senkte den Kopf und stützte mich hart auf die behelfsmäßige Bahre, und der Ruck ließ das Haupt der Toten leicht zur Seite fallen, bis ihre blinden Augen direkt in die meinen zu starren schienen.
»Es handelt sich um die Nichte des polnischen Königs«, sagte ich.
Ich hörte, wie der junge Löw erschreckt Atem holte; ich blickte auf und sah ihn an und den Totengräber, dessen Blick aus der Ferne zurückgekehrt war und der mich jetzt mit zusammengekniffenen Augen musterte.
»Man hat sie heute nacht ermordet aufgefunden und mich gebeten, den Fall so verschwiegen wie möglich zu klären.«
»Wer hat sie aufgefunden?« unterbrach mich der Apothekerssohn.
»Männer, die über jeden Zweifel erhaben sind«, erwiderte ich. »Genügt es Euch, wenn ich sage, daß ich ihre Namen um Eurer eigenen Sicherheit willen nicht nennen kann?«
Er schluckte und nickte heftig mit dem Kopf.
»Ich erzähle Euch dies«, fuhr ich fort und faßte sowohl den jungen Mann als auch den Totengräber scharf ins Auge, »in der Hoffnung, daß Ihr die Tragweite dieses Falles überblicken könnt. Es darf nichts davon an die Ohren des polnischen Königs dringen. Aus diesem Grunde habe ich Euch die Unwahrheit erzählt; ich wollte den Kreis der Wissenden so klein wie möglich halten, und ich wollte vermeiden, Euch in Gefahr zu bringen. Um diese Geschichte zu vertuschen, wird man vor drakonischen Maßnahmen nicht zurückschrecken. «
»Ihr braucht nicht zu drohen«, sagte der Totengräber ruhig. »Wir haben Euch verstanden.«
Ich ging nicht auf ihn ein.
»Werdet Ihr schweigen?« fragte ich die beiden Männer.
Nach einigem Zögern nickte der junge Löw. Er murmelte: »Ich sehe Sinn in Euren Worten. Und ich sehe, welche Tragödie daraus erwachsen kann.«
»Was ist mit Euch?« Ich wandte mich an den Totengräber. Er zuckte mit den Achseln.
»Ich bedauere den Tod dieser jungen Frau«, sagte er zu meinem Erstaunen. »Er war unnötig und grausam. Was für die hohen Herren auf der Burg und hier unten in der Stadt daraus für Unheil erwachsen kann, schert mich weniger, und wenn es Unfrieden und Tod bedeutet, werden jene ganz oben verschont bleiben, jene ganz unten sterben müssen und ich etwas mehr Arbeit haben als zu anderen Zeiten. Ihr seht also, daß es mich nicht bekümmern muß, was daraus wird – ich habe weder einen Vorteil, wenn dieser Mord bekannt wird, noch habe ich einen, wenn Ihr ihn unter der Decke halten könnt. Aber ganz abgesehen davon gibt es niemanden, der sich für eine Geschichte aus meinem Mund interessieren würde. Auf mein Schweigen könnt Ihr also zählen, Kaufmann.«
»Wird denn niemand nach dem Mörder suchen?« fragte der junge Löw mit jugendlich empörter Naivität.
»Er wurde bereits nach Burghausen gebracht«, log ich. Ich wollte vermeiden, daß ihn seine Neugier dazu trieb, in der Sache herumzuschnüffeln, wenn er erst seinen Schrecken überwunden hatte. Er nickte nochmals und fragte: »Wer war es?«
»Werdet Ihr es mir verübeln, wenn ich Euch den Namen verschweige?«
Er hob die Arme und lächelte beinahe.
»Nein«, sagte er. »Ich hoffe nur, man wird ihn seiner gerechten Strafe zuführen!« Er senkte den Kopf und betrachtete den Körper der jungen Frau. Ich nutzte die Gelegenheit und trat von der Bahre zurück. Ich hatte schon zuviel Zeit in unmittelbarer Gegenwart dieses Leichnams verbracht.
Nach einer Weile hob er den Kopf wieder und sagte: »Ich habe Euch mit meiner Aufdringlichkeit in Verlegenheit gebracht, Herr Bernward. Wenn ich Euch nicht die Totenurkunde aufgedrängt hätte, wäre dieses Gespräch niemals nötig gewesen.«
Ich hob die Arme und lächelte ihn schief an. Bei mir selbst dachte ich voller Grimm: Und ich hätte niemals erfahren, welche Mühe sich der Mörder gegeben hat, uns alle an der Nase herumzuführen.