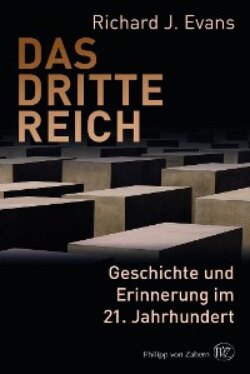Читать книгу Das Dritte Reich - Richard Evans - Страница 14
II
ОглавлениеFangen wir am besten damit an, einen Blick auf die umfangreiche Literatur zu werfen, die heute zu gesellschaftlichen Außenseitern in der Frühen Neuzeit – das heißt etwa vom Zeitalter der Reformation an bis zur Französischen Revolution und zu den Napoleonischen Kriegen – existiert. Die deutsche Gesellschaft jener Zeit war ständisch gegliedert, und Gesetz und Gewohnheit verschafften den Rechten und Pflichten der Stände Geltung. Alle Elemente der sozialen Ordnung waren getragen von der Vorstellung, dass sie – in unterschiedlichem Maße und auf unterschiedliche Weise – soziale Ehre besaßen.
Außerhalb dieses komplizierten Gefüges der „ehrlichen“ Gesellschaft jedoch stand die heterogene Gruppe der „unehrlichen Leute“, deren Außenseiterstatus im Wesentlichen fünf Ursachen hatte: Er konnte ererbt sein, er konnte mit einem Beruf verbunden sein, er konnte die Folge abweichenden, insbesondere (und vor allem bei Frauen) sexuell abweichenden Verhaltens sein, er konnte aus der Zugehörigkeit zu einer religiösen oder ethnischen Minderheit resultieren, oder er konnte aus einer strafrechtlichen Verurteilung folgen. Für die Unterscheidungen zwischen ehrlichen und unehrlichen Gruppen trug teils der Staat Sorge, aber es waren vor allem die Zünfte, die darauf bestanden, eine Vielzahl sozialer Gruppen von der Mitgliedschaft auszuschließen, indem sie diese als „infam“ bezeichneten.3
Zu den unehrlichen Leuten im frühneuzeitlichen Deutschland gehörten somit all jene, die einem Gewerbe nachgingen, das sie mit schmutzigen oder verunreinigenden Substanzen in Berührung brachte: Müller, Schäfer, Gerber, Gassenkehrer und, die unehrlichsten von allen, Abdecker oder Schinder, Maulwurffänger und Scharfrichter. Eine zweite, größere und amorphere Gruppe bestand aus fahrendem Volk, Leuten ohne festen Wohnsitz: Hausierern, „Zigeunern“, reisenden Schaustellern (Bärenhütern, Zauberkünstlern und dergleichen), Marktschreiern, Scherenschleifern, Kesselflickern und so weiter. Drittens waren Frauen betroffen, die durch sexuelles Fehlverhalten ihre Ehre verloren hatten, insbesondere Prostituierte und unverheiratete Mütter. Viertens haftete „Infamie“ auch allen Nichtchristen an, wovon im deutschen Kontext vor allem Juden betroffen waren, sowie unterworfenen sprachlich-kulturellen Gruppen wie den Wenden. Und schließlich galt, ungeachtet seines vorherigen sozialen Standes, jeder, der strafrechtlich verurteilt worden war und unter den verunreinigenden Händen des Henkers am „Schandpfahl“ gelitten hatte, ebenfalls als unehrlich.4
Die Stigmatisierung als unehrlich machte es unmöglich, in eine Zunft einzutreten, die Bürgerrechte zu erwerben, die meisten Arten von Landbesitz zu kaufen und im Allgemeinen ein anständiges Leben oberhalb der Armutsgrenze zu führen. Zunftgenossen war derart daran gelegen, sich von unehrlichen Leuten zu distanzieren, dass der geringste zufällige Körperkontakt schwere Krawalle auslösen konnte, wie etwa in Berlin im Jahr 1800. Dort hatte der Helfer eines Scharfrichters während einer öffentlichen Hinrichtung einen Handwerksgesellen unter den Schaulustigen „gepackt und vom Gerüst gestoßen ‚und einige Handwerksgesellen mit den von der Execution noch blutigen Stricken geschlagen‘“, was zu tumultartigen Szenen führte, die erst abklangen, als ein höherer und folglich äußerst ehrlicher städtischer Beamter den ehrlichen Status des Handwerksgesellen formell wiederherstellte, indem er ihm die Hand schüttelte (während er gleichzeitig die Truppen rief, nur zur Sicherheit).5 Der Beruf des Scharfrichters war in der Tat eines der wenigen unehrlichen Gewerbe, die ein anständiges Auskommen und die Anstellung eines Gehilfen ermöglichten, der die unehrlichsten Arbeiten verrichtete. Doch selbst Scharfrichter mussten im örtlichen Wirtshaus aus besonderen Krügen trinken, die niemand sonst berühren durfte. Jeder Zunftgenosse, der die Tochter eines Scharfrichters heiratete, konnte sich leicht kurzerhand aus seiner Zunft verbannt und seines Lebensunterhalts beraubt sehen.6
Die Zünfte und andere „ehrliche“ Gruppen in der städtischen und ländlichen Gesellschaft schlossen die „unehrlichen“ trotz wachsenden Widerstands vonseiten des Territorialstaates aus. Diese erachteten solche restriktiven Praktiken als schädlich für die Interessen der Mehrheit und als ursächlich für Armut und Unruhe unter den Betroffenen. Es war nicht zuletzt der Wunsch, die Macht der Zünfte zu beschneiden, der die absolutistischen Staaten des 18. Jahrhunderts antrieb, mit wiederholten öffentlichen Bekanntmachungen zu versuchen, viele der „Unehrlichen“ in die Gesellschaft zu integrieren. Der Staat der Frühen Neuzeit kümmerte sich in erster Linie deshalb um gesellschaftliche Außenseiter, um Unruhe zu unterdrücken und den Gewerbefleiß zu fördern. Andererseits bediente er sich einer Reihe repressiver Strategien gegen jene, die er für Unruhestifter oder Faulpelze hielt, wie etwa Räuber, Bettler, Bauernfänger und manches fahrende Volk, wie reisende Spielleute, „Zigeuner“, Marktschreier und Bärenhüter, aber er konnte nicht einsehen, warum hart arbeitende Gewerbe, die zum Volksvermögen beitrugen, als unehrlich gelten sollten.
Im Jahr 1731 erklärte die Reichshandwerksordnung des Heiligen Römischen Reiches sämtliche Gewerbe, ausgenommen die des Schinders oder Abdeckers und des Henkers (beide Gruppen wurden gewöhnlich in einem Atemzug genannt, häufig war der Henker auch als Abdecker tätig), offiziell für ehrlich, und 1772 wurde diese Bestimmung auch auf die letztgenannten Gruppen ausgeweitet. Im Jahr 1775 revidierte König Friedrich II. von Preußen, 1783 gefolgt von Joseph II. von Österreich, auch die bisherige Politik der versuchten Vertreibung oder Vernichtung der „Zigeuner“ grundlegend und versuchte stattdessen, ihre Integration in die Gesellschaft zu fördern. Darüber hinaus reduzierten zahlreiche gesetzliche Reformen die Zahl der mit dem Tod bestraften Vergehen drastisch, darunter fiel auch die „Sodomie“ (für die noch 1730 in Preußen ein junger Mann auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war), und entkriminalisierte faktisch eine Vielzahl von Vergehen, wie etwa Hexerei und Blasphemie. Die Ablösung christlicher Verhaltensmaßregeln durch den Rationalismus der Aufklärung führte zu den Gesetzbüchern des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, die Sanktionen gegen viele einvernehmliche Sexualakte einschließlich der Homosexualität faktisch abschafften.7
Diese Gesetze hatten, wie so viele Proklamationen aufgeklärter Monarchen, allerdings nur sehr begrenzten Einfluss auf soziale Einstellungen und Verhaltensweisen. Folglich wurden Schinder oder Abdecker und Scharfrichter auch weiterhin von der ehrbaren Gesellschaft gemieden und bildeten bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eigene Dynastien, in denen Inzucht herrschte.8 Zünfte widersetzten sich weiterhin der Obrigkeit, indem sie eine strenge Interpretation der Ehrvorstellungen durchsetzten. Überdies liefen die Erlasse des späten 18. Jahrhunderts, welche die Integration der „Zigeuner“ in die deutsche Gesellschaft verfügten, in gewisser Hinsicht lediglich auf neue Formen der Verfolgung hinaus. Sinti und Roma wurde befohlen, sich einen festen Wohnsitz zu suchen, man verbot ihnen, untereinander zu heiraten, wies sie an, ihre Kinder deutschen Bauern zur Aufzucht zu geben, und der Gebrauch ihrer eigenen Sprache war ihnen untersagt. Auch diese Maßnahmen durchzusetzen, erwies sich als unmöglich.9
Die Grenzen von Ehre und Ehrlosigkeit waren in der Frühen Neuzeit oft veränderlich und nicht klar umrissen. Gewerbe, die in manchen Gegenden als infam galten, wurden in anderen weithin als zunftfähig anerkannt. Manche Verhaltensweisen wurden mit der Zeit ehrlicher, andere unehrlicher. Ein besonders wichtiges Beispiel für Letzteres ist die Prostitution, die im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts unter zunehmender Diskriminierung und staatlicher Regulierung litt. In fast allen Fällen wurde die soziale Ächtung der unehrlichen Leute jedoch durch die Tatsache gemildert, dass sie die eine oder andere nützliche gesellschaftliche Funktion erfüllten. In einer Epoche, wo Kommunikationswege schlecht, Straßen in miserablem Zustand oder nicht vorhanden waren, Ressourcen begrenzt und Produktionsstätten oft Tages- oder Wochenreisen entfernt lagen von all den Dörfern, kleinen Städten und Gehöften, wo die überwiegende Mehrzahl der Menschen lebte, waren fahrende Leute wie Scherenschleifer, Hausierer und dergleichen ein unverzichtbarer Zweig der ländlichen Wirtschaft. Auch Abdecker oder Schinder, Müller und Schäfer kamen zwangsläufig häufig in Kontakt mit der Bevölkerung und waren allgemein als wichtig für sie anerkannt. Reisende Schausteller, Spielleute und Schauspieler, Marktschreier Quacksalber und Zahnbrecher sorgten zu Jahrmarktzeiten für Spektakel und Ablenkung.
Des Weiteren war geistige oder körperliche Behinderung alles in allem kein Grund für Ehrlosigkeit. Für „Dorftrottel“ oder „Stadtdeppen“ war das Leben zwar weder angenehm noch lang, aber im Großen und Ganzen blieben sie unbehelligt in der Obhut ihrer Familien und waren keine gesellschaftlichen Außenseiter. Heftige und störende psychische Krankheit führte wahrscheinlich zum Gewahrsam in einem Stadtgefängnis, wo auch die kleine Anzahl von Straftätern gefangen gehalten wurde, die eingesperrt und nicht ausgepeitscht, gebrandmarkt oder hingerichtet wurden. Doch selbst in schweren Fällen bemühten sich ehrliche Familien meist nach Kräften zurechtzukommen, statt zu einer so drastischen Maßnahme zu greifen. Wilhelm der Jüngere, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, etwa machte es sich zur Gewohnheit, halb nackt durch die Straßen von Celle zu laufen, den Leuten Geschenke zu machen und wild zu gestikulieren, aber erst als er seine Frau mit einer Schneiderschere angriff, willigte der herzogliche Rat ein, ihn einzuweisen. Er regierte, zu regelmäßigen Wahnsinnsanfällen neigend, noch sieben Jahre weiter bis zu seinem Tod im Jahr 1589.10
So wie Wahnsinn nur zum völligen Ausschluss führte, wenn er gefährlich wurde, so erregten fahrende Leute auch nur die erbitterte Feindschaft der Bevölkerung, wenn ihre Armut in Not umschlug und sie sich auf Betteln, Diebstahl und Räuberei verlegten. Wandergewerbe boten eine noch unsicherere Existenz als die Berufe sesshafter Leute. So war es nicht überraschend, dass die großen Räuberbanden, die während der Frühen Neuzeit vor allem bei Krieg und Aufruhr viele Gegenden Deutschlands durchstreiften, sich meist aus den Reihen gesellschaftlicher Außenseiter rekrutierten, zu denen nicht nur Vagabunden, Hausierer, Bettler und „Zigeuner“ gehörten, sondern auch arme, aber sesshafte Minderheiten wie Juden. Wenn der frühneuzeitliche Staat ländliche Gegenden nach verdächtigen Elementen, Räubern und Kriminellen absuchte, richtete er sein besonderes Augenmerk – allen gesetzlichen Neuerungen zum Trotz – auf die Wandergewerbe, wodurch er sie erneut stigmatisierte und zu ihrer Marginalisierung beitrug.11