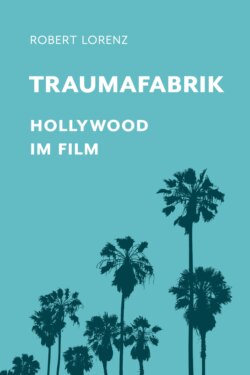Читать книгу Traumafabrik - Robert Lorenz - Страница 5
A Star Is Born (1937)
ОглавлениеEin Stern geht auf
Ein Drehbuch mit dem Vermerk „Final shooting script“ wird aufgeschlagen, die erste Szene spielt im Mondschein, in dem sich in verschneiter Landschaft mit Wolfsgeheul das „isolated farmhouse“ der Blodgetts im Hintergrund abzeichnet. Dann sieht man die dazugehörige Einstellung, eine fast märchenhafte Szenerie, irgendwo im Nirgendwo von North Dakota. Esther (Janet Gaynor) kommt gerade mit ihrem kleinen Bruder Aleck (A.W. Sweatt) aus dem Kino, aus einem Norman-Maine-Film. „He never does anything but kiss a lot of girls“, resümiert der Jüngere und die Ältere erwidert: „Norman Maine is one of the best actors in pictures.“ Sie träumt von einer Karriere als Filmstar, deren Wesen und Anforderungen sie aus Fanmagazinen zu kennen glaubt. „She’s just a silly little girl whose head has been turned by the movies“, bescheidet ihre Tante (Clara Blandick). Aus Esthers Hollywoodfantasie erwächst indes eine ernsthafte Ambition, die sie ihren skeptischen Verwandten mit ihrem kleinen Farm-Horizont an den Kopf wirft: „What’s wrong with wanting to get out and make something of myself?“
Träume, aus dem Herkunftsmilieu auszubrechen und ein Leben zu beginnen, das von dem der Eltern und Großeltern drastisch abweicht, waren die notwendige Voraussetzung, um das Elternhaus zu verlassen und den Neubeginn fernab der überkommenen Strukturen zu wagen. Aber die hinreichende Bedingung erfüllte sich erst für die Generation der 1920er und 1930er Jahre: als auch die Mittel und Infrastruktur dafür bereitstanden – erschwingliche Mobilität dank Zügen und Kraftfahrzeugen. Und im Falle von Esther Blodgett natürlich die PR-Auswüchse der Hollywoodindustrie in Gestalt der vielen Fanmagazine, die junge Menschen wie Blodgett mit einem solchen Gedanken überhaupt erst infizierten. Esther jedenfalls verbringt ihre Freizeit im Kino, studiert die Fanzeitschriften und übt sich in Imitationen von Stars à la Greta Garbo („And the other day I caught her talking to a horse with a Swedish accent“, empört sich die Tante). Ihr Weg nach Hollywood ähnelt dem Aufbruch der (wahlweise mutigen oder verzweifelten) Siedler:innen zu Frontier-Zeiten, die sich auf den langen und beschwerlichen Weg nach Westen aufmachten, in eine ungewisse, doch hoffentlich blühende Zukunft. Und deshalb findet Esther auch die Unterstützung ihrer Großmutter Lettie (May Robson). „When I wanted something better“, sagt die lebenserfahrene Frau, „I came across those plains in a prairie schooner“. Ihren Mann töteten Indianer, sie vergrub ihn und fuhr weiter. „There’ll always be a wilderness to conquer. Maybe Hollywood’s your wilderness now.“ Die Großmutter überlässt der Enkelin ihr Erspartes, damit sie mit dem Zug nach Kalifornien, nach Hollywood, reisen kann. Gerade vor dem Hintergrund der damaligen Wirtschaftskrise in den USA erinnert das entfernt an den Aufbruch der von Sandstürmen und Trockenheit gepeinigten Menschen aus dem Mittleren Westen, die in den Dreißigern, also ungefähr zur Zeit von „A Star Is Born“, sich zu Hunderttausenden nach Kalifornien aufmachten, weil ihre Felder verdorrt und ihre Böden wertlos geworden waren – ähnlich, wie die glamourösen Träume einer jungen Frau in North Dakota allmählich verblühen.
Dieser Prolog ist bereits einer der wenigen Aspekte, die „A Star Is Born“ von dem fünf Jahre zuvor erschienenen „What Price Hollywood?“ (1932) unterscheiden. Die Ähnlichkeit beider Filme war so groß, dass RKO beinahe seinen einstigen Produktionsleiter David O. Selznick verklagt hätte. Denn der inzwischen unabhängige Selznick war der Produzent von „A Star Is Born“; vielleicht auch deshalb hielt sich der „What Price Hollywood?“-Regisseur (und enge Selznick-Freund) George Cukor von dem Projekt fern und lehnte die abermalige Regie ab. Die übernahm stattdessen William „Wild Bill“ Wellman, der im Ersten Weltkrieg als waghalsiger Jagdflieger an der europäischen Westfront gekämpft hatte, gerne mal die Fäuste sprechen ließ und vor seinem Wechsel zu einem anderen Studio dem Paramount-Leiter B.P. Schulberg zum Abschied einen Haufen Pferdeexkremente auf dem Schreibtisch hinterließ. Wellman bekam später zusammen mit seinem 13 Jahre jüngeren Co-Autor Robert Carson den Oscar für die Beste Originalgeschichte – die einzige reguläre Academy-Trophäe, die „A Star Is Born“ gewann (Kameramann W. Howard Greene erhielt darüber hinaus 1938 eine Ehrenauszeichnung für die Farbfotografie, die allerdings erst im Jahr darauf, 1939, zu einer eigenen Oscarkategorie avancierte). Bei insgesamt sieben Nominierungen war dies freilich eine enttäuschende Ausbeute. Nichtsdestotrotz war „A Star Is Born“ einer der bedeutendsten Filme des Jahres 1937, nominiert als Bester Film; weitere Nominierungen gab es in den wichtigsten Bereichen: Bester Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin, Beste Regie, Bestes Drehbuch und damals noch (zum letzten Mal) Beste Regieassistenz.
Dass Wellman und Carson für die Originalgeschichte mit dem bedeutendsten Filmpreis der Welt ausgezeichnet wurden, zeigt freilich die Ungerechtigkeiten und Verrücktheiten der Filmbranche. In der Tat waren es Wellman und Carson, die ursprünglich an Selznick mit einem Konzept herantraten, wodurch das Projekt überhaupt erst angestoßen wurde und ein Fundament erhielt. Selznick hatte sich nach Stationen in drei der größten Hollywoodstudios – MGM, Paramount und RKO – mit dem Ruf des jungen, ungemein begabten Filmemachers als Independent Producer gerade unter dem Panier „Selznick International Pictures“ selbstständig gemacht und kannte Wellman gut. Im Januar 1927 hatte Wellman dem nach einem Streit mit Irving Thalberg bei MGM arbeitslos gewordenen Selznick einen neuen Job verschafft – als Assistent von B.P. Schulberg bei den Famous Players-Lasky-Studios. Außerdem war Selznicks Bruder Myron der Agent von Wellman. Für Selznick, der sich mit den wenigen Produktionen, die sein kleines Studio pro Jahr stemmen konnte, keinen Flop erlauben durfte, war ein weiterer Film über Hollywood ein unternehmerisches Wagnis; und so wird Wellmans Anteil an dem Projekt nicht zuletzt in der Überzeugungsarbeit bestanden haben, einen mitunter zögerlichen Selznick auf diesen Film einzuschwören.
Aber die Grundzüge der Carson/Wellman-Geschichte, und damit die von „A Star Is Born“, ähnelten doch sehr der Selznick-Produktion „What Price Hollywood?“, die damals ja erst ein paar Jahre zurücklag. Allerdings stammt die Story um den Abstieg des Einen parallel zum Aufstieg der Anderen ja im Kern von Adela Rogers St. Johns, die 1932 dafür auch ganz offiziell mit einer Oscarnominierung gewürdigt worden war, bei sämtlichen „A Star Is Born“-Filmen aber nicht mehr genannt wurde, der also in gewisser Weise die Urheberschaft entrissen worden war. Rogers St. Johns, die weiterhin in Selznicks Diensten stand, arbeitete neben etlichen anderen ebenfalls am „A Star Is Born“-Drehbuch mit. Letzteres hatte in seiner Urfassung im Übrigen allein Carson geschrieben. Gleichviel: Selznick hatte einst bei RKO ihr Skript gekauft, weil er wie Wellman einen Hollywoodfilm über Hollywood drehen wollte; und „A Star Is Born“ war schlicht ein zweiter Versuch, den respektablen Vorgänger in Wirkung und Umsatz zu übertreffen. Insofern ist „A Star Is Born“ mehr ein Reanimationsversuch Wellmans und Carsons denn ein originelles Projekt. Von Carson und Wellman stammte vor allem die Idee, den Weg des späteren Stars von der Peripherie nach Los Angeles zu zeigen („What Price Hollywood?“ beginnt direkt in L.A. und lässt die Herkunft seiner Protagonistin im Unklaren); und der Gedanke, aus den beiden Hauptfiguren – dem aufleuchtenden und dem verglühenden Stern – ein Liebespaar statt lediglich Freunde zu machen.
Selznick reklamierte also wohl nicht ganz zu Unrecht die Urheberschaft der Filmidee später für sich. Wellman selbst bekannte öffentlich, der Oscar gebühre eigentlich Selznick – und in der Tat soll die Statuette dann auch in Selznicks Besitz übergegangen sein. Doch auch Selznick wiederum war nicht der alleinige Anstoßgeber, da seine damalige Frau Irene – die jüngste Tochter des MGM-Moguls L.B. Mayer – ihn wohl schon bei „What Price Hollywood?“, später dann erneut bei „A Star Is Born“ hartnäckig zu einem solchen Filmprojekt über Hollywood gedrängt hatte. Wie dem auch sei: „A Star Is Born“ hat sich seither als eine Art Franchise etabliert; der Titel stammt übrigens von Selznicks Vertrautem, dem millionenschweren Unternehmer John Hay Whitney, dem der Arbeitstitel „The Stars Below“ nicht gefiel.
Ungeachtet dessen hatte Selznick gleich mehrere Motive, eine neue Variante von „What Price Hollywood?“ drehen zu lassen. Erstens konnte er das Ganze nun in Farbe präsentieren, da das Dreifach-Technicolor-Verfahren bei „What Price Hollywood?“ noch nicht verfügbar gewesen war; dies machte aus dem Film quasi automatisch etwas Besonderes, kursierten damals doch in der ganzen Filmstadt lediglich fünf Technicolor-Kameras. Neben dem technischen Update glaubte Selznick – zweitens – noch immer an das Box-Office-Potenzial der Geschichte und unternahm einen weiteren Anlauf, nachdem sein erster Film nicht einmal seine Kosten eingespielt hatte. Selznick wollte nun allen Zweifler:innen beweisen, dass Filme über Hollywood eben doch erfolgreich sein konnten. Jedenfalls hatte er das voyeuristische Potenzial erkannt, auf der einen Seite den ruhmreichen Aufstieg und auf der anderen den tragischen Abstieg eines Stars zu zeigen. Auch wollte er, drittens, all die vorgeblichen Kinostrateg:innen, die den kommerziellen Sinn des 1932er Filmfinales, des Selbstmordes, infrage gestellt hatten, eines Besseren belehren, wollte auch hier den Beweis antreten, dass tragische Enden mindestens genauso erfolgreich sein können wie Happy Ends. Und viertens war es ihm – einem mittlerweile waschechten Hollywoodianer – wichtig, den verzerrten Blick auf die glitzernde Filmstadt an der kalifornischen Küste ein wenig zu korrigieren.
„I believed that the whole world was interested in Hollywood and that the trouble with most films about Hollywood was that they gave a false picture, that they burlesqued it, or they oversentimentalized it, but that they were not true reflections of what happened in Hollywood.“ (David O. Selznick zit. nach Behlmer 2000, S. 104.)
Und hatte Selznick mit seinem Blick für Talente wie Katharine Hepburn nicht schon oft selbst Momente erlebt, in denen er sagen konnte: „A star is born“?
Jedenfalls: David O. Selznicks Mischung aus Nostalgie und Geschäftssinn hatten erst „What Price Hollywood?“ bewirkt und nun zu „A Star Is Born“ geführt. Als 1954 das gleichnamige Remake erschien, schrieb der US-amerikanische Edelkritiker Bosley Crowther in der New York Times über die 1937er Version: „probably the most affecting movie ever made about Hollywood“ (Crowther, Bosley: The Screen: ‚A Star Is Born‘ Bows, in: The New York Times, 12.10.1954.). Die Faszinationskraft dieses Films liegt vor allem in seiner geschichtlichen Aura; wie durch ein schummriges Zeit-Periskop blickt man in eine längst vergangene Epoche Hollywoods. Man muss sich das Alter dieses Films, das in den Interieurs und Lebensweisen der Menschen im Dreißigerjahre-Kalifornien gar nicht so drastisch zum Ausdruck kommt, einmal vor Augen halten: In Deutschland herrschten damals bereits seit Jahren Hitler und die Nationalsozialist:innen, steuerten auf einen neuen Weltkrieg zu; auf den Filmfestspielen von Venedig war „A Star Is Born“ für den Coppa Mussolini nominiert, Europa stand unmittelbar vor der Katastrophe. Das Kolorit dieser Zeit wirkt ungleich ferner von heute als der erstaunlich modern anmutende Selznick-Film.
Die etwas dunkler ausgeleuchteten Räume – das Hotel-Foyer oder eine Bar – könnten so auch aus den 1950er oder 1960er Jahren stammen, wirken hier aber ungleich nostalgischer. Mit „A Star Is Born“ taucht man tief ein in die elitär-exaltierte Hollywoodsphäre, vermeint ein wenig von dem Klima, der Aura, dem Esprit jener fernen Zeit und Welt zu spüren. Durch implizite Annahmen, vage Andeutungen und hastige Streifzüge vermittelt der Film mehr, als seine Bilder tatsächlich zeigen. Esther Blodgetts Weg zum Ruhm beginnt denn auch am „Grauman’s Chinese“, einem Wahrzeichen des alten Hollywood mit seiner exotischen Architektur, den betonierten Hand- und Fußabdrücken der Stars im Gehweg. Jean Harlow, Harold Lloyd, Shirley Temple oder Eddie Cantor heißen die Stars damals – auch Norman Maine hat sich dort mit dem Spruch „Good Luck“ verewigt.
Blodgetts Ankunft in Hollywood repräsentiert die Phase all der Träumer:innen, die nach Los Angeles gekommen sind in der Hoffnung auf Ruhm und Reichtum als Star eines der über die Stadt verteilten Studios. Das „Oleander Arms“, in dem Blodgett mit dem Geld ihrer Großmutter ein Zimmer mietet, ist wie später in „The Day of the Locust“ (1975) eine Heimstätte der Suchenden und Wartenden. Blodgett schreibt die Studios an, aber niemand mit ihrem Karrierestatus kommt an der Central Casting Corporation am Hollywood Boulevard vorbei; dort empfängt alle Karriereaspirant:innen eine große Tafel mit den entmutigenden Zahlen der Vergeblichkeit: 5.393 Frauen, 5.517 Männer und 1.506 Kinder haben sich als Extras eingeschrieben – das Sechzehnfache des Bedarfs. Im Büro sitzen ein halbes Dutzend Telefonistinnen, die wie verrückt unentwegt den Satz „Try later, thank you“ aufsagen, während kleine Lämpchen immer neue Anrufe ankündigen. „Every one of those little lights thought it was going to be a star“, sagt die Angestellte im Empfangsraum. Ein bisschen Hollywoodromantik wird sich nicht verkniffen, denn der Hotelbesitzer ist so gnädig, Blodgett trotz der säumigen Mietzahlungen nicht rauszuschmeißen und sie also auch nicht zur vorzeitigen Abreise zu bewegen. Im „Oleander Arms“ lernt Blodgett den Leidensgenossen Danny McGuire (Andy Devine) kennen, einen arbeitslosen Regieassistenten. Ihm verdankt sie letztlich ihre große Chance, einen Gelegenheitsjob: Sie hilft auf der Party eines Regisseurs als Kellnerin aus, einem für Hollywood typischen Umschlagplatz der Karrieren also.
Jedes Mal, wenn sie den Gästen Horsd’œuvres von ihrem Tablett anbietet, imitiert sie eine berühmte Schauspielerin – erst Greta Garbo, dann Bette Davis, schließlich Mae West. Und dann trifft sie auf Norman Maine, ihren Leinwandhelden, der reichlich betrunken aufkreuzt und mit seinen Ausfällen gerade seinem Regisseur am Set das Leben zur Hölle macht. Maine interessiert sich nicht für die übrigen Hollywoodgäste, sondern für die Kellnerin – das erinnert an die Hollywoodlegende, demnach der spätere Star Colleen Moore als Dienstmädchen auf einer Party ihrer Tante ausgeholfen habe, wo sie dann der Regisseur D.W. Griffith entdeckt haben soll. Blodgett jedenfalls lässt sich von Maine nicht abschleppen, er findet sie „lovely“ und ruft noch in derselben Nacht seinen Boss an. Die Uhr zeigt zehn vor drei, als Oliver Niles (Adolphe Menjou), der Kopf an der Spitze des Oliver Niles Studio, aus dem Tiefschlaf heraus den Anruf entgegennimmt – offenkundig eine Maine-Marotte und ein Star-Prärogativ, bei Niles sporadisch Screentests für hübsche Frauen zu arrangieren. Die Begegnung zwischen etabliertem Star und unbekannter Aspirantin, der eine besoffener Gast, die andere eine schlagfertige Kellnerin, entspricht dem Beginn von „What Price Hollywood?“.
Und wie fünf Jahre zuvor bei Constance Bennetts Mary Evans gelingen auch Janet Gaynors Esther Blodgett die Probeaufnahmen, sie wird unter Vertrag genommen. Das Studio promotet sie als „Cinderella of the Rockies“. Sie absolviert Trainings im Herabschreiten einer Treppe und geht zu einem Sprechcoach. Im Make-up-Department fragen sich die beiden Spezialisten: „Pretty small mouth, eh?“ – „Give her that Crawford smear.“ Wie später im 1954er Remake wird das ungeheuerliche Leid zahlloser Schauspielerinnen der Studio-Ära, dem Make-up-Department und den Studiomanagern ausgeliefert, humorvoll verkleidet. Doch wäre Blodgett noch lange kein Star, hätte sich für sie nicht abermals eine günstige Gelegenheit ergeben.
Ebenfalls wie in der 1954er Version sucht Niles nach einer Besetzung für die vakante weibliche Hauptrolle, in diesem Fall für Maines neuen Film, „The Enchanted Hour“. Als Maine ihm Blodgett vorschlägt, die bis dahin noch keine einzige Rolle gespielt hat, ist Niles bereits mit dem gesamten Studioverzeichnis aller Vertragsschauspielerinnen durch und mit seinem Rat am Ende. Als Niles und sein PR-Chef Matt Libby (Lionel Stander) Blodgetts Namen erfahren, reagieren sie, als müssten sie einen Mord vertuschen. „Hey, we’ll have to do something about that, right away“, sagt Niles, während Libby den Namen voll fassungsloser Verachtung wiederholt. Niles: „Well, that Blodgett’s definitely out.“ In weniger als einer Minute ist ein neuer Name gefunden: Vicki Lester. Später im Film erfahren wir auch Maines echten Namen: Alfred Hinkel. Es ist sicher kein Geheimnis, dass ein karriereförderliches Pseudonym damals, in der Studio-Ära, zum üblichen Prozedere einer Star-Werdung gehörte – wenige, wie Ingrid Bergman, verweigerten sich dem Ansinnen der Filmemacher. Fast jeder Film über Hollywood spielt mit dieser Komponente der Star-Werdung. Dass in Hollywood nicht einmal die Namen echt sind, ist Teil der Illusionsmaschinerie. Und auch die Biografie wird nach allen Regeln der Marketingkunst frisiert. Libby fragt Blodgett nach ihrer Herkunft. In Filmore, North Dakota sei sie geboren. Libby an der Schreibmaschine: „Oh no. Grace saw light of day in a mountain cabin, a trappers hut high up in the rockies.“ Ihr Vater sei ein Farmer – Libby schnarrt verächtlich und tippt weiter: „There amidst the mountain flowers, he raised another blossom. His lovely little daughter …“
Dann der Lackmustest: die Vorschau vor echten Zuschauer:innen; auf der Leinwand flackert ein Hinweistext: „You are about to see the Preview of a picture that has not been finally edited. Your opinion will be appreciated. Please mail comment cards.“ Niles und Libby lungern wie Spione vor dem Kino herum, um die Gespräche der herausströmenden Zuschauer:innen mitzuhören. Das Preview-Publikum ist begeistert, alle halten Lester für den nächsten großen Star – „That Lester kid’s a gold mine“, ruft ein Journalist Libby zu. „A star is born“, sagt Maine zu Blodgett, als sie sich unbemerkt davonstehlen.
Wie sein Vorläufer „What Price Hollywood?“ nimmt der erste „A Star Is Born“ sein Publikum mit in eine Welt, die halb Märchenland, halb Hölle ist. Seinen Namen und Teile seiner Biografie aufzugeben, ist sicherlich nicht leicht, aber erscheint vor dem Hintergrund des eigenen Wollens der Star-Aspirant:innen noch vertretbar. Einen erheblich delikateren Punkt berührt indes die Szene, in der sich die Kosmetikexperten über Esther Blodgetts Gesicht beugen und darin herumpinseln, während sie über die idealen Augenbrauen grübeln. Dieser Vorgang, in der 1954er Fassung mit beinahe masochistischen Selbstbezügen Judy Garlands leicht abgewandelt, zielt auf die schmerzhaften, nicht zuletzt entwürdigenden Gesichtsoperationen ab, denen sich unzählige Frauen in der Studio-Ära zu unterziehen hatten, wollten sie ihre Chance wahren, ein Star zu werden. Und natürlich der Star-Status selbst, der neben seinen Privilegien auch verhängnisvolle Tücken birgt: die permanente Beobachtung durch unersättliche Paparazzi, die mit ihrer Hartnäckigkeit und ihrem Instinkt auf Fehltritte des Prominenten warten, die sie anschließend in der skrupellosen Klatschpresse ausbeuten können; oder die Alkoholsucht, der Norman Maine schon lange vor seinem ersten Auftritt im Film, bereits während seiner Erfolgszeit, verfallen ist.
Norman Maine, der gestandene Star: Das ist eigentlich die zentrale Performance eines jeden „A Star Is Born“-Films, von Fredric March über James Mason und Kris Kristofferson bis hin zu Bradley Cooper – seit 1976 ist die Figur kein Schauspieler mehr, sondern Musiker; 1976 heißt er John Norman Howard, 2018 Jackson Maine. Denn „A Star Is Born“ handelt im Kern weniger vom Aufstieg als vom Abstieg. Die äußerlichen Merkmale haben sich geändert, aber die tiefe Tragik bleibt: Norman Maine zerstört sich im Verlauf der Filme selbst, sein Stern erlischt. Und das ist die Stärke der 1937er Variante: die Blicke des Fredric March, aus denen die Unsicherheit in einem eigentlich selbstbewussten Körper spricht. Gleich von seiner ersten Szene an erleben wir das ganze Spektrum des Maine’schen Alkoholismus, von Peinlichkeit bis zu Gewalt. Zwanzig Minuten vergehen bis zu seinem ersten Auftritt; mit einer Begleitung torkelt er zu seinem Platz im „Hollywood Bowl“, der großen Freilichtbühne in den Hollywood Hills, die einem antiken Theater nachempfunden ist – „he seems to have had that one extra cocktail“, kommentiert Danny, der neben Esther ein paar Reihen oberhalb von Maine sitzt. Das Publikum klatscht, als der Dirigent die Bühne betritt, aber Norman Maine denkt in diesem Moment, der Applaus gelte ihm, und reckt die Arme empor, ehe er beim Hinsetzen mit seinem Stuhl zu Boden kracht. Dem Fotografen, für den er seinen Arm um die Frau neben ihm legen soll, nimmt er erbost die Kamera ab und zertrümmert sie; es kommt zu einem Handgemenge, in das die Polizei eingreifen muss. Kurz darauf klagt Maines aktueller Regisseur dem Studioboss: „His work is beginning to interfere with his drinking.“
Als Norman Maine Esther Blodgett entdeckt, sind seine Tage als Box-Office-Held und damit als Filmstar längst gezählt. Viele Stars sind damals für die Studios notorische Troublemaker, aber Norman Maine spielt nicht mehr das nötige Geld ein, um das Management darüber hinwegsehen zu lassen. PR-Mann Libby, der berufsmäßige Troubleshooter, spricht gegenüber Niles sein Verdikt über Norman Maine: „[…] the exhibitors don’t like him, the critics don’t like him, the public don’t like him, and I don’t like him.“ Als Libby später im Film das frischgebackene Ehepaar Maine behelligt, um Exklusivaufnahmen des Glamourpaares im neuen Zuhause zu machen („Caption: Their honeymoon never ends.“), wollen die Menschen doch eigentlich nur Bilder von Vicki Lester sehen. Niles kommt dazu und setzt sich abseits der nun zur Vicki-Lester-Fotosession verdichteten PR-Aktion mit Maine unter die Palmen. Im Gespräch wird klar, dass der große Erfolg von Vicki Lesters Leinwanddebüt allein ihr und nicht Maine zugeschrieben wird. „Do you think I’m slipping?“, fragt Maine seinen Freund und Chef. „The tense is wrong“, antwortet der, „you’re not slipping, you’ve slipped.“ Man hört förmlich die Worte in Maines Bewusstsein einsickern. „My fan mail is still big“, wendet er ein; aber Niles ernüchtert ihn, dass Fotografien billiger als Tapeten und die Anfragen für Maine-Porträts folglich kein gültiger Prestigeindikator seien. Ein anderer Schauspieler, Pemberton, scheint in Maines Fußstapfen zu treten, er – nicht mehr Maine – soll im nächsten Vicki-Lester-Film die männliche Hauptrolle übernehmen. Auf den großen Filmplakaten, die „The Enchanted Hour“ bewerben, wird schon bald der Name „Norman Maine" mit dem von Vicki Lester überklebt; während die Berge an Lester-Fanpost hektisch anwachsen, landet in Maines Fach bloß noch sporadisch ein Brief; kurz darauf gibt das Niles-Studio bekannt, den Vertrag mit Norman Maine aufgelöst zu haben. „Orchids to Niles!“, jubelt die Presse. Kinos, die bereits Maine-Filme gebucht haben, werden vom Studio von ihren Obligationen entbunden – ein desaströses, unrühmliches Karriereende.
Zu Hause, in der malerischen Villa am Strand von Malibu, schlägt Maine nun die Zeit mit Wohnzimmergolf tot, während seine Frau Filme dreht. Anrufer halten ihn für Vicki Lesters Butler. Als sie von einem langen Arbeitstag im Studio zurückkommt, hat er Sandwiches vorbereitet, ein gemütlicher Abend in romantischer Zweisamkeit scheint bevorzustehen. Aber Norman Maines Zustand ist derart fragil, dass ihn die Serie an kleinen Herabstufungen allmählich zermürbt. Als dann auch noch der Paketbote an der Tür skeptisch fragt, wer er denn sei, ihn obendrein als „Mr. Lester“ adressiert, da treibt es ihn zu einem „little drink“.
Vicki Lester gelingt schließlich der ultimative Triumph: Sie gewinnt den Oscar – und damit die Anerkennung ihrer Peers, die sie gekürt haben. Vor der versammelten Academy-Gemeinschaft trägt sie einen sanften, demütigen Dank vor, als plötzlich ein lautes „Hey!“ ertönt und Norman Maine – auf den sie zuvor vergeblich an ihrem Tisch mit Niles gewartet hat – in das Zeremoniell hineinplatzt. Er wankt zum Podium, gratuliert seiner Frau und stößt dabei versehentlich eine der aufgereihten Oscarstatuetten um. „Now I wanna make a speech“, setzt er seine Blamage fort: „Gentleman of the Academy and fellow suckers“, ruft er. Und mit Blick auf seine drei Flops, die unlängst sein Karriereende besiegelt haben, verlangt er für sich einen Spezial-Oscar, „for the worst performance of the year. In fact, I want three statues. For the three worst performances of the year, because I’ve earned them!“
Die Tragik dieses Auftritts lässt sich an den Worten kaum ermessen, man muss die Szene mit Fredric March gesehen haben. Seine versoffen-unkontrollierte Verzweiflungsgestik mündet in eine unbeabsichtigte Ohrfeige für die frischgebackene Oscarpreisträgerin Vicki Lester, die herbeigeeilt ist, um ihren Ehemann und Kollegen vor weiteren Peinlichkeiten zu bewahren. Geistesgegenwärtig beordert Niles das Orchester, Musik zu spielen, und Vicki Lester schenkt ihrem Gatten trotz dieses unsäglichen Vorfalls ein Lächeln, während er nun selbst völlig schockiert innehält, die Kleidung derangiert, der Blick leer, das sprichwörtliche Häufchen Elend im Fokus der großen Academy-Aufmerksamkeit. Die beiden retten sich an den Tisch von Niles; ein Close-up zeigt jetzt einen bekümmerten Norman Maine, während im Hintergrund die Galagäste tanzen und im Vordergrund der Oscar steht – in diesem Moment mehr Mahn- als Denkmal – und Maine in der Manier eines komplett überforderten Kindes weinerlich nach einem Drink verlangt. Die Sequenz schließt damit, wie ein vom Alkohol ausgeknockter Maine zu Hause auf dem Sofa seinen Rausch ausschläft und ihm seine Frau die Schuhe auszieht – nie war der neben ihr auf dem Boden liegende Oscar bedeutungsloser als in diesem Augenblick.
Wenn der zunehmend versoffene Regisseur Max Carey in „What Price Hollywood?“ den Ausgangspunkt von Norman Maine darstellt, dann bezog sich diese Figur also zunächst auch auf die Carey-Vorlagen: den alkoholkranken Produzenten John McCormick (1893–1961), der in den Zwanzigern mit dem Star Colleen Moore verheiratet gewesen war, wohl auch auf den alkoholkranken Regisseur Marshall „Mickey“ Neilan (der sogar in „A Star Is Born“ einen Kurzauftritt hat). Als weiterer Inspiration bedient sich „A Star Is Born“ bei dem Schicksal von Frank Fay (1891–1961); der Warner-Star verschaffte seiner Frau einen Screentest – Barbara Stanwyck (1907–90) avancierte zum Superstar, Fay trank sich ins Karriereaus. Sowohl Stanwyck als auch Moore standen ungeachtet der entsetzen Öffentlichkeit lange Zeit schier unverbrüchlich zu ihren alkoholkranken Ehemännern, bis der Suff sie zur tödlichen Bedrohung für die beiden Schauspielerinnen gemacht hatte – die eine die Treppe hinunter geprügelt, die andere beinahe erwürgt.
Die entgegengesetzten Karriereverläufe der Paare McCormick/Moore und Fay/Stanwyck waren also zwei der bekanntesten Wirklichkeitsentsprechungen des fiktiven Paares Maine/Blodgett. Die konkrete Leinwandfigur des Norman Maine konturierten wiederum einzelne Persönlichkeiten, für deren mal mehr, mal weniger rapide Selbstzerstörung in der Hollywoodkolonie nur allzu viele Zeug:innen existierten. Neben den genannten McCormick, Neilan und Fay gehörte dazu nicht zuletzt der Regisseur selbst: Wellman konnte auf etliche Kontrollverluste unter Alkoholeinfluss zurückblicken. Auch mag er an seinen nur unwesentlich älteren Mentor und Förderer Bernard J. Durning (1892–1923) gedacht haben, den er während dessen heftiger Alkoholepisode während der Dreharbeiten von „The Eleventh Hour“ (1923) auf dem Regiestuhl ersetzte. Am Skript schrieb auch der junge Budd Schulberg (1914–2009) mit, der später einen Drehbuchoscar für „On the Waterfront“ (1954) gewann und dessen Vater B.P. Schulberg (1892–1957) einst mächtiger Produktionsleiter von Paramount gewesen war, bis seine phänomenale Karriere infolge des 1929er Börsencrashs und ausufernden Arbeitsstresses an Alkohol und Glücksspiel zerbrach.
All diese Quellen, aus denen Norman-Maine amalgamiert wurde, schienen indes ohnehin in einem der damals bekanntesten Schauspieler:innen überhaupt zusammenzulaufen: Wie Fredric March seinen strauchelnden Hollywoodstar spielt, erinnert an Attitüden und Redeweisen des damals noch sehr berühmten John Barrymore (1882–1942), der bereits Max Carey in „What Price Hollywood?“ inspiriert hatte. Barrymore entstammte einem Schauspielclan, die Eltern erfolgreiche Bühnendarsteller, die beiden älteren Geschwister Lionel und Ethel Stars sowohl am Broadway als auch in Hollywood. Ganz in der Tradition seiner Familie reüssierte John Barrymore im Theater und im Kino. Barrymore war ein Gigant, der Laurence Olivier seiner Generation, spielte die größten Rollen (u.a. Kapitän Ahab, Sherlock Holmes, Dr. Jekyll/Mr. Hyde), hatte die bekanntesten Leinwandpartnerinnen (u.a. Greta Garbo, Carole Lombard, Colleen Moore), aber Mitte der 1930er Jahre mochte ihn wegen seiner Trinkerei kaum mehr jemand engagieren. Zusammen mit anderen Topverdiener:innen der Dreißiger, etwa Errol Flynn, gehörte Barrymore, der neben seinen Frauen mit einem Äffchen und einem Geier zusammenlebte, zu den heftigsten und berüchtigtsten Trinker:innen von ganz Hollywood.
Wie schon bei Carey sind auch die Maine-Dialoge mit reichlich Barrymore-Sentenzen garniert. Die Sprüche, Eskapaden und Situationen des Norman Maine könnten jedenfalls eins zu eins von dem einzigartigen Bühnen- und Leinwandstar stammen – und tun es teilweise sogar. Nach schlimmen Ausfällen landet Maine in dem Entzugsheim „Liberty Hall“. Als Niles ihn dort besucht, wird Maine – der einstige Weltstar – von einem Aufpasser namens Cuddles keine Sekunde aus den Augen gelassen. „It’s positively luxurious. Hey, they even have iron bars on the windows to keep out the draft“, sagt Maine zu dem ob dieser puritanischen Umgebung merklich perplexen Niles. George Cukor hat genau diese Szene angeblich mit John Barrymore erlebt.
„A Star Is Born“ hat noch weitere Barrymore-hafte Momente in petto: Einmal liegt Maine im Anzug mit einer riesigen Champagnerflasche im Bett, ein andermal bestellt er auf einer Hollywoodparty Whisky Soda und bedeutet dem Barkeeper mit einem „Come on, come on, come on“ gegen jede Etikette, das Glas vollzumachen, ehe er kurz vor dem Rand noch „Soda“ gestattet (ebenfalls eine überlieferte Barrymore-Marotte). Als ihn seine Freundin auf ebendieser Party anherrscht, trotzt ihr Maine: „I think I shall get very drunk indeed.“ Seinen schleichenden Untergang begleitet er mit selbstironischen Kommentaren: Ob er nicht vermisst werde, auf der Party, fragt ihn die kellnernde Esther in der Küche, wo Maine ihr in Flirtlaune seine Hilfe beim Tellereinräumen anbietet. „Oh no, no, they’ll just look under the table and when they see I’m not there, they’ll forget the whole matter“, lallt er. Bei einem Boxkampf fragt er Esther, ob sie ihn heiraten wolle. Während er maskuline „Finish him!“-Schreie in Richtung Boxring ausstößt, zählt sie in liebevollem Spott seine Schwächen auf – er sei unzuverlässig, werfe sein Geld zum Fenster raus und trinke zu viel. Er fragt, ob sie ihn denn heiraten werde, wenn er all das aufgebe. „Would you do all that for me if I said I’d marry you?“, fragt sie – „Well, certainly not! I was just supposing.“ Und als sich Niles seinem Protegé Maine gegenüber um dessen Gesundheit sorgt, reicht der ihm eine kleine Automatenmünze, deren Gravur später seine Grabinschrift sein solle: „Good for amusement only“. Später wird Niles mitgeteilt, Maine sei sturzbetrunken in einem Krankenwagen mit Blaulicht den Wilshire Boulevard hinuntergerast.
Auch zwischen March und Barrymore bestehen gewisse Parallelen, die sich nicht darin erschöpfen, dass er rund zehn Jahre nach Barrymore ebenfalls Dr. Jekyll und Mr. Hyde spielte oder wie Barrymore mit Greta Garbo, Mary Astor und Norma Shearer vor der Kamera stand. (Mit Norman Maine verband March wiederum die Ehe mit einer Schauspielerin.) Auch nicht, dass March wie Barrymore vom Theater nach Hollywood gekommen oder dass seine erste Frau mit Barrymore befreundet gewesen war. Fredric March selbst war gewissermaßen ein ausgewiesener Barrymore-Experte. Er hatte 1928 mit großem Erfolg in dem Stück „The Royal Family“ eine John-Barrymore-Parodie auf den Bühnen von San Francisco und Los Angeles gespielt (Barrymore hatte angeblich im Premierenpublikum gesessen). Der verklausulierte Bühnen-Barrymore war für March ein Karrieretriumph, der ihm kurz darauf einen Vertrag bei Paramount einbrachte – die Bühne blieb für March ein Sehnsuchtsort künstlerischer Selbstverwirklichung, das Filmstudio verführte indes mit Gagen, die in der Theaterwelt unvorstellbar waren. Die Leinwandadaption unter dem Titel „The Royal Family of Broadway“ (1930) gilt als der Film, mit dem March zum Hollywoodstar avancierte.
Ohnehin weist „A Star Is Born“, wie bereits sein Vorläufer „What Price Hollywood?“ eine manchmal tragische, manchmal komische Nähe zur Wirklichkeit auf. Selznick schwor Stein und Bein, dass 95 Prozent der Dialoge dem wahren Leben in Hollywood entstammten, „straight ‚reportage‘, so to speak“ (David O. Selznick zit. nach Behlmer 2000, S. 104.). Dazu dürfte auch die Szene gehören, in der Oliver Niles seinem inzwischen rausgeschmissenen Ex-Star dem neuen Star Vicki Lester zuliebe einen Job anbietet. Als Maine fragt: „Who plays opposite me?“, und Niles ihm antwortet: „Well, it is not exactly the lead“, da zerschlagen sich für Maine ein für alle Mal die Hoffnungen auf eine Wiederkehr alter Größe. Was hilft es da, dass Niles ihm sagt: „[…] but I tell you frankly I consider your part better than the lead“ – „one of those parts that make an impression on you: They’ll be thinking about you all through the picture.“ Wer sich im Status eines Stars wähnt und so etwas hört, weiß in der Regel, dass ihn die Branche längst abgeschrieben hat. Wieder ist es Pemberton, der Maines Platz eingenommen hat. Und wieder reagiert Maine wie ein kleiner Junge, mit kindlicher Hochstapelei: Er sei bei einem anderen Studio unter Vertrag, dürfe darüber natürlich noch nichts sagen. „But it’s a big picture. It’s one of the biggest of the year … and the part! Every actor in Hollywood would give his teeth to play it.“
Sowohl „What Price Hollywood?“ als auch die „A Star Is Born“-Ahnen gehen erstaunlich aggressiv mit der massenmedialen Berichterstattung um – mit der Sensationsgier der Presse, von der nicht zuletzt Hollywood selbst profitiert. Für die Öffentlichkeit werden mutmaßlich publikumstaugliche Namen erfunden und simple Viten zu klangvoller Fantasie aufgebauscht. Der Primat der Presse scheint jedenfalls allgegenwärtig: Als Oliver Niles auf einer Party erfährt, dass Norman Maine volltrunken am Steuer einen Autounfall hatte, ist die erste Sorge des Studiobosses: „Will it be in the papers?“ Aber Troubleshooter Libby hat bereits alles gefixt, niemand wird darüber schreiben. Später stehen Esther und Norman in Niles’ Büro und teilen ihm ihre Absicht mit, heimlich heiraten zu wollen. Nichts soll zunächst an die Öffentlichkeit dringen, so ihr Wunsch. In diesem Moment platzt Libby herein: „It will be the biggest elopement this town ever saw. We’ll get a tie-up with the army and have you escorted all the way down to Yuma, by twenty of their new bombing planes.“ Libby fantasiert weiter – eine Kirche sei als Ort der Hochzeit zu abgegriffen („It’s been done.“), stattdessen schlägt er einen Strand vor: „I can visualize it. The bridesmaids in bathing suits. Twenty thousand Santa Monica school children, spelling out the word ‚love‘.“ Sie tricksen Libby dann aber aus, indem sie einfach in einer Kleinstadt außerhalb von L.A. heiraten, wo niemand sie erkennt. Als Libby sie dort doch noch aufspürt, brausen sie davon und ihr Trauzeuge McGuire sagt zu dem wütenden PR-Chef: „Well, they’ve got a right to get married haven’t they?“ Libby entgegnet: „[…] they haven’t got any right to double-cross the public.“
Lionel Stander spielt den Presseexperten des Oliver Niles Studio als knallharten Hund, mit seiner penetranten Stimme und der hohen Sprechgeschwindigkeit eine infernalische Version eines Screwballcharakters. Er erledigt für Niles die Drecksarbeit, muss die Eskapaden der Stars ausbaden und Skandale abwenden. Die fieseste Szene hat er in der Aufenthaltshalle einer Pferderennbahn. Ein trockener Norman Maine bestellt gerade zur Verwunderung des Barkeepers ein Ginger Ale und begrüßt den PR-Mann, der Scotch ordert. Nach dem Sanatoriumsaufenthalt scheint er stabil zu sein. Libby nutzt die Begegnung als Ventil seiner aufgestauten Verachtung für Norman Maine. Mit seiner schnarrenden Stimme geht er Maine an, nun, da er nichts mehr zurückzuhalten braucht:
„Say listen, I got you out of jams because I had to, it was my job, not because I was your friend. I don’t like you and I never have liked you. Nothing made me happier than to see all those cute little pranks of yours finally catch up with you and land you on your celebrated face!“
Maine verpasst ihm daraufhin einen Fausthieb ins Gesicht, Libby lässt ihn zu Boden gehen. Ein kleiner Tumult, der Maine inmitten einer Menschentraube als Loser dastehen lässt – er schleicht zur Bar zurück: doppelter Scotch, die Flasche könne gleich dableiben.
In ihrer exklusiven Malibu-Villa geht Vicki Lester auf und ab, Norman ist seit vier Tagen spurlos verschwunden. Dann klingelt das Telefon, Maine ist im Nachtgericht, festgenommen wegen Trunkenheit. Lester und Niles nehmen im Gerichtssaal Platz; die Leute, die zusammen mit Maine dem Richter vorgeführt werden, sind allesamt notorische Trunkenbolde, bemitleidenswerte Gossenexistenzen. Die Anschuldigungen werden verlesen: Maine sei betrunken mit seinem Wagen in einen Baum am Sunset Boulevard gebrettert und habe sich der Verhaftung widersetzt. „You’re nothing but an irresponsible drunk“, konstatiert der Richter (Jonathan Hale). Er brummt ihm neunzig Tage Gefängnis auf, aber Vicki Lester schreitet ein und übernimmt die Verantwortung für ihn. Während der Richter sie hinsichtlich der Konsequenzen belehrt, sieht man einen völlig aufgewühlten Maine, der sich bewusst wird, in was für eine Lage er seine Frau gerade gebracht hat und wie sie sich trotzdem für ihn einsetzt. Es ist eine der wenigen Szenen, die Fredric March berührender spielt als 17 Jahre später James Mason in der ansonsten haargenau gleichen Szene. Als Lester ihn kurz darauf am Gefängnistor abholt, sind die Paparazzi schon zur Stelle – die Titelseite der Zeitung berichtet vom „Night court drama“ – William Wellman, dem Regisseur und Drehbuchautor selbst, sei dies angeblich widerfahren.
Von seinem Bett aus hört Maine anschließend ein Gespräch zwischen seiner Frau und Niles mit. Sie will für ihn ihre Karriere aufgeben, um für ihn da sein zu können. „Then there’ll be no more … Vicki Lester“, sagt sie mit Tränen in den Augen – eine unmittelbare Anspielung auf die Beziehung von Frank Fay und Barbara Stanwyck. Nachdem Niles gegangen ist, tritt Maine ihr im Bademantel gegenüber. Sie scherzen, eine romantische Szene, großes Potenzial für ein Happy End. Aber als sie sich umarmen, weiß man durch die ergriffene Mimik des Fredric March im Close-up eigentlich sofort, dass es nicht gut ausgehen wird. Ein Gegenschnitt zeigt, wohin er blickt: auf den in das Abendrot getauchten Pazifik. Kurz bevor Vicki den Raum verlässt, ruft Norman: „Hey! Do you mind if I take just … one more look?“ – einer der zentralen Sätze des „A Star Is Born“-Kosmos („I just wanted to hear you speak again, that’s all“, sagte Max Carey kurz vor seinem Selbstmord in „What Price Hollywood?“ zu Mary Evans). Dann geht Maine hinaus – der Strand ist nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt –, schreitet hinein ins Meer und schwimmt der untergehenden Sonne entgegen, seine im Sand abgelegte Kleidung wird weggespült.
Die letzten Momente, vielmehr: die letzten Blicke des Max Carey/Norman Maine/John Norman Howard/Jackson Maine gehören stets zu den stärksten Szenen der gesamten Reihe. 1937 wirft Fredric March mit einem herzzerreißenden Gesicht des abgestürzten Sterns, der sich gegen eine Wiederkehr entschieden hat, seiner Frau (und Entdeckung) ein letztes Mal ein bescheidenes Lächeln zu. Wie auch später in der 1954er Version zeigt die Kamera auf die übersättigte Strandidylle mit den sanften Wellen – aber niemals zuvor oder danach hat das kalifornische Abendrot so intensiv, so ergreifend geleuchtet wie hier. Maines Selbstmord – die Supernova, eine Konstante aller „A Star Is Born“-Filme –, so hieß es oft, lehne sich an den Tod von John Bowers (1885–1936) an, einem Stummfilmstar, dessen Karriere mit dem Aufkommen der Talkies abrupt endete und der im Pazifik ertrank – manche sagten, er sei einfach ins Meer hineingelaufen. Der Filmhistoriker Ronald Haver hat jedoch darauf hingewiesen, dass John Bowers erst nach dem Dreh der Selbstmordszene verstarb; aber die Geschichte mit Bowers’ Tod im Pazifik als Vorlage für die Leinwand klingt eben besser – print the legend.
Als eine weitere Maine-/Suizid-Folie wird indes John Gilbert (1897–1936) gesehen, „the maddest, most lovable guy who ever lived“ (Rogers St. Johns, Adela: Love, Laughter and Tears. My Hollywood Story, New York 1978, S. 246). Der Metro-Star Gilbert hatte 1928 den lukrativsten Vertrag aller Hollywoodschauspieler, kam anschließend aber mit dem Tonfilm nicht zurecht, war Alkoholiker, heiratete eine aufstrebende Schauspielerin (Virginia Bruce), während seine Karriere in die Brüche ging, er schließlich von Clark Gable als Metro-Topstar beerbt wurde und 1936, also im unmittelbaren zeitlichen Umfeld von „A Star Is Born“, mit 38 an einem Herzinfarkt verstarb. Doch ist die Selbstmordszene viel zu sehr an diejenige aus dem Jahr 1932, in „What Price Hollywood?“ angelehnt, als dass sie mit Hollywoodtoden des Jahres 1936 in Verbindung gebracht werden müsste. Der Selbstmord des Norman Maine macht dem klassischen Hollywood-Happy-End jedenfalls einen Strich durch die Rechnung (gemäß Selznicks Realitätsanspruch) und dient zugleich als Metapher für das Selbstzerstörungspotenzial großen Talents und die Gnadenlosigkeit des Schicksals (gemäß Selznicks sentimentaler Hollywoodnostalgie).
Einen eher ironischen Wirklichkeitsbezug hat hingegen die Besetzung von Esther Blodgett/Vicki Lester mit Janet Gaynor (1906–84). Gaynor war 1929 die allererste Oscarpreisträgerin gewesen, prämiert für ihre Hauptrollen in drei Filmen – das erste und einzige Mal, dass die Academy eine Schauspielerin für mehrere Performances auszeichnete. Für „A Star Is Born“ erhielt Gaynor eine Oscarnominierung, aber als sie gecastet wurde, war Gaynors Stern bereits am Sinken, war sie im echten Leben mehr bei Maine als bei Blodgett/Lester. Selznick hatte wohl zuerst auch an die Exil-Wienerin Elisabeth Bergner (1897–1986) gedacht, aber am Ende wurde es eben Janet Gaynor, eine der besten Freundinnen von Selznicks Frau Irene.
Wie in jedem „A Star Is Born“-Film findet sich auch bei Gaynor eine ordentliche Portion biografischer Verbundenheit mit der weiblichen Hauptfigur (Constance Bennett hatte, wie gesagt, vieles ihrer „What Price Hollywood?“-Protagonistin am eigenen Leib erfahren, auch die Sängerinnen Judy Garland, Barbra Streisand und Lady Gaga konnten sich durch ihre eigene Vita in ihre Charaktere hineinfühlen – wenngleich die biografische Nähe nirgendwo sonst eine solch masochistische Nähe erreichte wie bei Garland). Wie ihr Leinwandcharakter kam auch Gaynor einst auf gut Glück nach Hollywood, um ins Filmgeschäft einzusteigen; mit hartnäckiger Geduld wartete sie auf ihre Chance, schlug sich mit diversen Jobs und kleinen Rollen durch, bis dann tatsächlich jemand sie entdeckte und förderte (respektive kommerzialisierte). Als sie Selznick besetzte, befand sich Gaynors Karriere bereits im freien Fall; sie drehte anschließend lediglich noch zwei weitere Filme, ehe sie noch einmal zwanzig Jahre später in „Bernardine“ (1957) auftrat.
Betrachtet man das Hollywoodbild in „A Star Is Born“ – einem der ultimativen Filme, die Hollywood über sich selbst gedreht hat –, so schwankt der Film bemerkenswert ambivalent zwischen schwülstiger Propaganda und schonungsloser Vivisektion, wie man sie dem eitlen, narzisstischen Hollywood gar nicht zugetraut hätte. Da ist zum Beispiel der freimütige Umgang mit dem systematischen Betrug der Öffentlichkeit durch professionelle Meinungsmacher:innen. Libbys Job besteht in der euphemistischen Manipulation von Viten und Persönlichkeitsprofilen, auch in der Vertuschung kleinerer und größerer Fehltritte der Studioangestellten – insgesamt also in der Herstellung und Verteidigung von Prominenz und Prestige. Allerdings ist Libby dann auch wieder, in klassischen, archaischen Kategorien gedacht, eine Art Bösewicht, jedenfalls die mit Abstand unsympathischste Figur im ganzen „A Star Is Born“-Universum. Als Maine gestorben ist, schnarrt Libby an einer Bar: „First drink of water he had in twenty years. How do you wire congratulations to the Pacific Ocean?“ Und Libbys PR hat wieder einmal ganze Arbeit geleistet: Der Suizid wird in den Zeitungen als Unfall dargestellt. Natürlich war das auch eine Konzession an den Production Code und das Hays Office, die Hollywood-eigene Zensurbehörde. Max Carey erschoss sich am Ende von „What Price Hollywood?“ noch in der Pre-Code-Ära, als noch niemand den freiwilligen Moralkodex der Filmindustrie sanktionierte. Als Norman Maine sich in die Wellen des Pazifik stürzte, da war jedoch klar, dass so etwas nicht mehr geduldet wurde; überdies existierte mit Will H. Hays als Präsidenten der Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA) nun auch ganz offiziell ein oberster Moralwächter, da Filme vor ihrem Erscheinen erst durch die MPPDA zertifiziert werden mussten. Hollywood hatte sich diese Selbstzensur auferlegt, um eine Gesetzgebung durch den Staat abzuwenden, sich wenigstens einen gewissen Einfluss auf die Freiheiten (und eben Einschränkungen) des Filmemachens zu bewahren. Insofern stand sogar zu befürchten, dass manche Zuschauer:innen Maines buchstäblichen Untergang in „A Star Is Born“ gar nicht als Selbstmord deuteten.
Dann gibt es noch die Einsamkeit in der Hollywoodcommunity, die bloß den Erfolg, nicht aber die Niederlage prämiert. Im Santa Anita Park, der Pferderennbahn nordöstlich von Los Angeles, grüßt Norman Maine nach seiner Rückkehr aus dem Entzugsheim drei Bekannte, die zögerlich den Gruß erwidern und denen die Begegnung mit dem gefallenen Star ohne Studiovertrag sichtlich unangenehm ist. „How I hate to run into these has-beens. They give me the creeps“, sagt einer von ihnen. Auch auf den von Hollywood selbst beförderten Starrummel wird ein kritisches Licht geworfen. Nicht nur, dass er anscheinend generell dazu beiträgt, Menschen wie Norman Maine zu zerstören; überdies wird der Verlust jeglicher Privatheit in den Fokus gerückt: Da sind zum einen die Paparazzi, die Maine belauern und im Zeitalter der massenmedialen Schlagzeilenhysterie ihr Geld mit dem Unglück anderer Menschen verdienen; und zum anderen der erbarmungslose Voyeurismus der einfachen Leute, denen Hollywood seine Märchen und Mythen verkauft. So bricht bei Maines Trauerfeier vor der Kirche ein Tumult aus, als Vicki Lester heraustritt. Die Öffentlichkeit verlangt ihren Tribut: „Come on, Vicki! Let’s see your face.“ – „Vicki, will you sign my book for me?“ Jemand stiebitzt der Witwe den Trauerhut vom Kopf. Selznick hatte Wert auf diese Szene gelegt, nach den realen Ereignissen auf der Trauerfeier des im September 1936 verstorbenen Freundes und bewunderten Kollegen Irving Thalberg, die auch an die Menschenanstürme bei Rudolph Valentinos Bestattung im Sommer 1926 erinnerten.
Wenn auch klar wird, dass Hollywood seine Abgründe hat, dass es Menschen nicht nur aufbauen, sondern desgleichen ruinieren kann, so präsentiert es sich doch immer noch als außergewöhnlicher Möglichkeitsraum und Karrierekanal, ganz im Sinne des American Dream und des Pursuit of Happiness der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung – des Rechts darauf, nach Glück und Erfolg zu streben, und des Versprechens, sie auch zu erlangen, wenn man nur tüchtig genug ist. Nahezu buchstäblich wird Esther Blodgett von der Tellerwäscherin zum oscarprämierten Superstar, nachdem sie aus der Midwest-Provinz in das verheißungsvolle Los Angeles gereist ist und nur fest genug an ihr Talent geglaubt hat, zudem dank ihrer Hartnäckigkeit so lange durchhält, bis kairoshaft die passende Gelegenheit vorbeischaut (ihre Begegnung auf einer Hollywoodparty mit Norman Maine), die sie just beim Schopf ergreift.
Und nicht zuletzt Adolphe Menjous Studiochef Oliver Niles, der sich nicht bloß mit gespielter (also kommerziell interessierter), sondern mit wahrhaftiger Fürsorge den Problemen des Ehepaares Maine annimmt, der den gestrauchelten Star in der Entzugsanstalt besucht und ihm gegen alle Gesetze des Marktes ein Rollenangebot unterbreitet – also ein resolutes Gegenbild zum Stereotyp des Produzenten als Egoist. „A Star Is Born“ malt ein ausnehmend euphemistisches Bild vom Studioboss – nicht umsonst verweisen winzige Details auf Selznick, dessen nachträglich erfundenes „O“ an den Namen Oliver erinnert und der mit seiner Handschrift die Niles-Signatur unter Blodgetts Vertrag gesetzt hat. Wird der Studiochef spätestens ab den 1950er Jahren als Tyrann, Despot und Psychopath dargestellt, sind die beiden unter Selznick auf die Leinwand gebrachten Filmemacher von 1932 und 1937 ansteigend sympathische Persönlichkeiten, in ernsten Momenten voll familiärer Empathie und Herzensgüte.
Als Niles seinen Schützling (und natürlich auch sein Investment) Maine auf dessen heftiges Trinken anspricht, bekennt sich Niles – in Tonfall und Blicken durchaus glaubwürdig – zu einem hehren Motiv. Es gehe ihm nicht ums Geld: „I’ve made lots of money with you, and I can afford to take a loss, but I hate to see you going the way of so many others.“ In einer anderen Szene, nachdem Esther und Norman dem Chef von ihren Heiratsabsichten unterrichtet und den Raum wieder verlassen haben, da bezeichnet Libby den älteren Star als „public nuisance number one“. Daraufhin stutzt ihn Niles in einer geradezu idealtypischen Manier des vorbildlichen Chefs zurecht: „Now wait a minute Libby, Norman’s all right. And if you’ll pardon my pointing, Vickie’s business is her own. It doesn’t require any comments.“ Und als Vicki Lester ihm am Set von Maines Alkoholproblemen berichtet, tröstet Niles sie und bietet sich sofort an, dem arbeitslosen Ex-Star ein Engagement zu verschaffen. Als Spiritus Rector erst von „What Price Hollywood?“, dann von „A Star Is Born“ war es kein Wunder, dass der Produzent Selznick das Bild des Filmproduzenten in diesen beiden Filmen außerordentlich beschönigte.
Die sentimentale Reinwaschung der skandalumwitterten Filmindustrie erreicht gegen Ende des Films ihren Höhepunkt, als Vicki Lester kurz davor ist, ihre Zelte in L.A. abzubrechen. Die Dienerschaft wird gerade ausbezahlt, die Wohnung ist schon fast ausgeräumt, das Zugticket gebucht, da steht plötzlich Großmutter Blodgett in der Tür und redet ihrer berühmt gewordenen Enkelin ins Gewissen: „I was proud to be the grandmother of Vicki Lester. It gave me something to live for, now, I haven’t any.“ Esther will die Stadt verlassen, will aufgeben, die Großmutter fordert Disziplin ein: „Tragedy is a test of courage. If you can meet it bravely, it will leave you bigger than it found you. If not, then you’ll have to live all your life as a coward.“ Im Film hat dies einen Anklang von Happy End: dass Esther Blodgett, die zu Beginn des Films irgendwo im klirrend kalten North Dakota von einer Hollywoodkarriere träumte, ihre Errungenschaft nun nicht achtlos wegwirft. Aber die Botschaft lautet freilich, dass Selbstmorde, Alkohol- und Drogentode in der Hollywoodcommunity letztlich von Versager:innen und Feiglingen zeugen, nicht aber von einem pathologischen System.
Kurzum: Hollywood ist ein fantastischer Ort der Verwirklichung menschlicher Träume, mit seinen düsteren Nischen vielleicht gerade deshalb auch wieder „normal“, kein Moloch aus Dekadenz und Kommerz, wie es manchmal mit seinen landesweit in den Zeitungen ausgebreiteten Geschichten von Sex, Gier und Sucht den Eindruck erweckt. Indem man sich also in aller Öffentlichkeit ein paar Fehler und Schwächen eingesteht – die Fähigkeit zu Selbstironie und Selbstkritik beweist –, gewinnt man an Glaubwürdigkeit und Ansehen, ohne in der Praxis irgendetwas ändern zu müssen.
Der Nukleus, aus dem „A Star Is Born“ seine anhaltende Faszinationskraft bezieht, ist natürlich Hollywood selbst. „… the beckoning El Dorado … Metropolis of Make-Believe in the Californian Hills“, heißt es zu Beginn des Films, im Anschluss an die kurze Heartland-Sequenz, die Esthers Abreise in Richtung Westen zeigt. Aufnahmen von entspannten Menschen mit Cocktailgläsern unter Sonnenschirmen, in Hollywoodschaukeln und auf Luftmatratzen am Pool suggerieren einen luxuriösen Alltag in der Hollywoodkolonie.
Die Dekadenz der Reichen und Schönen, die man mit Hollywood verbindet, manifestiert sich meist etwas vornehmer in den Heimstätten der Stars. Eine Szene nach den eher bescheidenen Flitterwochen im Wohnwagen zeigt ein phänomenales Grundstück, auf dem sich das frischgebackene Ehepaar Maine niedergelassen hat. Im Hintergrund sieht man eine weiße Villa, während Esther und Norman über den akkurat gemähten Rasen zu einem Teich hinunterschreiten, wo eine kleine Flotte von Schwänen ihre Eleganz zur Schau stellen. Natürlich werde man die Strandvilla in Malibu behalten, sagt Norman. Auf der anderen Seite des Anwesens erstreckt sich ein Pool von der Größe eines Hauses. Das Ganze ist eine Mischung aus mediterranem Ambiente und Hollywood’schem Größenwahn, aber eine ungemein atmosphärische Manifestation eines Teils der Dreißigerjahre-Filmstadt Los Angeles. Die Sequenz im Garten der Maines fängt die neoaristokratische Noblesse der Elite des alten Hollywood der Charlie Chaplins, Mary Pickfords und Douglas Fairbanks’ ein.
Auch hinter die Kulissen des Filmemachens blickt „A Star Is Born“, mit dem Make-up-Department, dem geräumigen Produzentenbüro, aber auch dem Set. Nachdem Maine seinem Protegé tatsächlich zu einem Screentest verholfen hat, steht Esther das erste Mal vor der Kamera. Die betriebsame Atmosphäre am Set oszilliert zwischen Bahnhofshalle und Baustelle. Der Regisseur sitzt vor der Kamera, mit Zigarette und Fedora: „This is a take. Roll ’em. Quiet! Take!“ In der Studiokantine sitzen in den Drehpausen die Indianer neben den Cowboys.
Selznick hatte klare Vorstellungen: „A Star Is Born“ sollte zwar kein düsteres Licht auf Hollywood werfen, aber sich doch echt anfühlen. Neben wahren Anekdoten und realistischen Schicksalen mussten daher vor allem die Filmlocations authentisch sein. So ließ Selznick die MGM-Kantine nachbauen und Maines Malibu-Villa möglichst zeitgenössisch einrichten. Eine Konsequenz daraus ist, dass der originale „A Star Is Born“, stärker noch als die 1954er Fassung, über ein eingebautes Sightseeing-Programm verfügt. Da ist etwa das „Cafe Trocadero“: In dem Nachtklub der Stars – einer einstigen Raststätte – am Sunset Strip überblicken Blodgett und Maine nach der Preview ihres gemeinsamen Films die leuchtende Fläche, die Los Angeles mit seiner flachen Bebauung in der Nacht ergibt. „It’s a carpet spread for you“, sagt Maine; „It’s all yours from now on, you know.“ Das „Troc“ war erst wenige Jahre vor „A Star Is Born“, 1934, eröffnet worden und die Location schlechthin, um gesehen zu werden. Das „Biltmore Hotel“ war eines der Gebäude, die Anfang der 1920er Jahre – erbaut für die seinerzeit sagenhafte Summe von zehn Millionen Dollar – Los Angeles Metropolenglanz verliehen; dort findet im Film in der glamourösen „Biltmore Bowl“, einem gigantischen Ballsaal, die achte Oscarzeremonie statt – so wie in Wirklichkeit, als ebendort am 5. März 1936 Frank Capra moderierte. Es heißt, die Oscarstatuette sei 1927 auf einer Tischdecke im „Biltmore“ entworfen worden. Die Libby-Maine Konfrontation spielt sich im Santa Anita Park ab, einer ebenfalls kürzlich (1934) eröffneten Pferderennbahn in Arcadia, ein paar Meilen nordöstlich von Los Angeles gelegen, wo all die Spielernaturen Hollywoods ihr Geld verzocken oder Pferde aus ihren eigenen Gestüten ins Rennen schicken konnten.
Und dann natürlich das bereits erwähnte „Grauman’s Chinese“, der 1927 eröffnete Kinopalast mit seiner asiatisch inspirierten Architektur, der sich als häufig frequentierte Premierenstätte für die prädestinierten Kinohits zu einer historischen Hollywoodinstitution entwickelt hat. In großen Leuchtbuchstaben steht hier „Vicki Lester“ geschrieben. Als „the girl who has won the heart of Hollywood“ wird sie angekündigt, während ihre Limousine vorfährt und sie zu Applaus aussteigt. Dann nimmt sie all ihren Mut zusammen und sagt in das international vernetzte Mikrofon die Worte, die seitdem zum „A Star Is Born“-Kanon gehören: „Hello, everybody. This is Mrs. Norman Maine!“