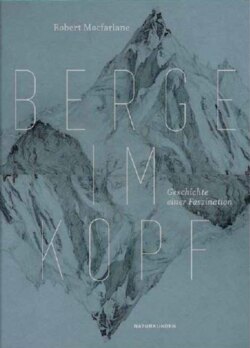Читать книгу Berge im Kopf - Robert Macfarlane - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 DAS GROSSE BUCH AUS STEIN
Оглавление»Unsere Phantasien können beeindruckt werden, wenn wir die Berge als Monumente der langsamen Arbeit gewaltiger Naturkräfte durch unzählige Jahrhunderte betrachten.«
LESLIE STEPHEN, 1871
August 1672 – Hochsommer auf dem europäischen Kontinent. In Mailand und Genua schwitzten die Bürger unter der starken europäischen Sonne. Fast 2000 Meter höher fröstelt Thomas Burnet am Simplon-Pass, einem der wichtigsten Übergänge der Alpen. Mit ihm friert der junge Graf von Wiltshire, ein Ur-Ur-Enkel von Thomas Boleyn, dem Vater der unglücklichen Anne, der zweiten Frau König Heinrichs VIII., die er hinrichten ließ. Der Junge brauchte eine Ausbildung, hatte seine Familie entschieden, und Burnet, ein anglikanischer Geistlicher mit außergewöhnlich reicher Vorstellungskraft, hat diese Aufgabe übernommen. Sie sollte zu einem zehnjährigen Bildungsurlaub von seinem Lehrstuhl am Christ’s College in Cambridge führen. Er wird zum Beschützer und Reiseleiter einer ganzen Reihe heranwachsender Aristokraten; der junge Graf ist der Erste von ihnen.
Für Burnet ist es ein Vorwand, den katholischen Kontinent zu besuchen. Die beiden werden mit ihrem mürrischen Führer und seinen wiehernden Maultieren den Simplon-Pass überqueren und danach Richtung Süden reisen, am schillernden Lago Maggiore entlang, dann durch die Obstgärten und Dörfchen der Gebirgsausläufer, schließlich über das grüne Fries der Lombardischen Ebenen bis hinab zu den blassen, erbaulichen Städten Norditaliens, die der Junge sehen muss – an erster Stelle Mailand.
Simplonpass mit Böshorn und Fletschhorn
Doch zunächst steht die Überquerung der Alpen an. Es gibt wenig, was den Simplon-Pass anziehend macht. Am höchsten Punkt des Passes steht eine rudimentäre Herberge, aber sie ist kein angenehmer Ort für eine Übernachtung. Die Kälte dort oben geht einem bis auf die Knochen, und es gibt Bären und Wölfe in der Gegend. Die Herberge selbst ist eigentlich ein Schuppen und wird bewirtschaftet von Savoyarden, Schäfern, die widerwillig auch noch die Gäste betreuen.
Trotz dieser zahlreichen Unannehmlichkeiten ist Burnet glücklich. Denn hier hat er mitten in den Bergen einen Ort entdeckt, der vollkommen anders ist als jeder andere Ort, den er kennt, und der sich so seinen Vergleichsmöglichkeiten entzieht. Für Burnet ist diese Landschaft wahrlich einzigartig auf dieser Erde. Obwohl es Sommer ist, liegt dort Schnee in hohen, vom Wind geformten und hart gefrorenen Verwehungen, denen die Sonne offenbar nichts anhaben kann. Im Sonnenlicht schimmern sie golden, im Schatten sehen sie aus wie das cremige Grauweiß von Knorpel. Felsbrocken so groß wie Gebäude liegen dort verstreut und werfen blaue Schatten. Das Geräusch fernen Donners rollt von Süden heran, doch die einzigen Blitze sind mehr als eintausend Meter unterhalb von Burnet über dem Piemont sichtbar. Er ist entzückt davon, über dem Gewitter zu sein.
Dort unten in Italien sind die berühmten Ruinen von Rom, die der junge Graf als Teil seiner Lektion über die Antike besuchen muss, weiß Burnet. Auch Burnet selbst bleibt nicht unberührt angesichts der Pracht von Roms zerstörten Tempeln und den vergoldeten, weinenden Heiligen in den Nischen der Kirchen. Aber dort oben ist etwas, das er später beschreiben wird als »diese ungeheuren Gebirgsformen« zwischen dem gigantischen Geröll der Alpen, das für Burnet letztendlich viel beeindruckender und überwältigender ist als die Ruinen von Rom. Obwohl Burnet die Berge schon wegen seines Alters als feindlich und abweisend empfinden muss, fühlt er sich auf seltsame Weise von ihnen angezogen. »Sie haben etwas Erhabenes und Würdevolles«, schrieb er nach der Überquerung des Simplon-Passes,
etwas, das den Geist zu großen Gedanken und Leidenschaft inspiriert […]. Wie all jene Dinge, die zu groß sind, um sie begreifen zu können, erfüllen und überfluten sie den Geist durch ihr Übermaß und versetzen ihn in einen angenehmen Zustand von Benommenheit und Vorstellungskraft.
Während seines zehnjährigen Aufenthalts auf dem Kontinent hat Thomas Burnet zusammen mit verschiedenen jungen Zöglingen mehrmals die Alpen und den Apennin überquert. Der mehrmalige Anblick dieser »wilden, großen, unverdauten Haufen aus Steinen und Erde« ließ in Burnet den Wunsch reifen, den Ursprung dieser fremden Landschaft verstehen zu können. Warum sind diese Felsen so weit verstreut? Und warum hatten die Berge so eine starke seelische Wirkung auf ihn? Die Berge beschäftigten Burnets Fantasie und seine Forscherinstinkte so stark, dass er befand, sich nicht mehr wohlfühlen zu können, bevor er nicht eine akzeptable Erklärung dafür gefunden habe, »wie es zu diesem Durcheinander in der Natur gekommen ist«.
Und so begann Burnet an seinem kunstvollen, apokalyptischen Meisterwerk zu arbeiten, dem ersten Buch, das den Bergen, den zeitlosesten aller Objekte, eine Vergangenheit zuschrieb. Burnet schrieb in einer Zeit, die man in Europa als bedrohlich empfand. In den Jahren 1680 und 1682 wurden ungewöhnlich grelle Kometen am Himmel beobachtet. Edmond Halley hatte bei seinen Himmelsbeobachtungen von der Spitze eines Vulkans seinen eigenen glühenden Boten ausgemacht, ihn nach sich selbst benannt und seine Rückkehr im Jahre 1759 korrekt vorausgesagt. In ganz Europa wurden Tausende von Flugblättern gedruckt, die bevorstehende Katastrophen für die zivilisierten Länder ankündigten: den Tod von Königen, die Ernte zerstörende Stürme, Dürrekatastrophen, Schiffsuntergänge, Pest und Erdbeben. In dieser von Anzeichen und Omen gesättigten Atmosphäre erschien 1681 Thomas Burnets The Sacred Theory of the Earth, das zuerst in Latein in einer bescheidenen Auflage von 25 Exemplaren erschien und eine kleine, kecke Widmung an den König trug, die auf die Dummheit seiner Majestät verwies. Burnets Buch befasste sich nicht mit zukünftigen Katastrophen, sondern mit dem größten Unglück aller Zeiten, der Sintflut. Sein Buch erschütterte den biblisch-orthodoxen Glauben an das seit Urzeiten unveränderte Antlitz der Erde, und es prägte entscheidend die Art und Weise, wie man sich damals die Berge vorstellte und sie wahrnahm. So verdanken wir es zum Teil Burnets jahrzehntelangem Nachdenken über Zerstörung, dass wir uns heute überhaupt vorstellen können, dass Landschaften eine Vergangenheit haben, eine eigene, lange Entwicklungsgeschichte.
Vor Burnet fehlte den Vorstellungen von der Erde eine vierte Dimension, die Zeit. Was, so dachte man, könnte denn beständiger sein als die Berge, und was könnte länger existieren als sie? Sie wurden von Gott in ihrer gegenwärtigen Form geschaffen und würden nun für immer und ewig so bleiben. Vor dem 18. Jahrhundert bestimmte die biblische Erzählung der Schöpfungsgeschichte, wie man sich die Vergangenheit der Erde vorzustellen hatte, und laut Bibel war die Erde erst vor relativ kurzer Zeit entstanden. Im 17. Jahrhundert gab es mehrere geniale Versuche, aus den in der Bibel enthaltenen Informationen ein Ursprungsdatum der Erde zu berechnen. Der bekannteste Versuch stammte von James Ussher, dem Erzbischof von Armagh, dessen zweifellos gewissenhafte Berechnung zum Ergebnis hatte, dass die Geburtsstunde der Erde am Montag, den 26. Oktober im Jahre 4004 vor Christus um 9 Uhr morgens war. Usshers Chronologie für die Erschaffung der Erde stammt aus dem Jahre 1650 und wurde als Fußnote noch in den englischen Bibeln des frühen 19. Jahrhunderts abgedruckt.
Daher war zu Burnets Zeit die orthodoxe christliche Vorstellung fest verankert, dass die Erde keine Geschichte habe. Man glaubte damals, dass sie nicht älter als 6000 Jahre und in dieser Zeit nicht erkennbar gealtert sei. Keine Landschaft besaß eine interessante Vergangenheit, denn die Erdoberfläche hatte immer gleich ausgesehen. Berge waren wie alles auf der Welt in jener ersten Woche der fieberhaften Schöpfung entstanden, die in der Genesis beschrieben wird. Sie wurden am dritten Tag geschaffen, also am selben Tag, an dem die Polarzonen vereist und die Tropen aufgeheizt wurden. Seither hatte sich ihr Erscheinungsbild kaum verändert, abgesehen vom kosmetischen Effekt des Flechtenwuchses und einer leichten Verwitterung. Sogar die Sintflut hatten sie ohne Folgen überstanden.
Das entsprach der damaligen allgemeinen Sichtweise. Thomas Burnet war jedoch überzeugt davon, dass der Bibeltext über die Schöpfungsgeschichte, so wie er damals verstanden wurde, das Erscheinungsbild der Welt nicht erklären konnte. Vor allem beschäftigte Burnet die Strömungstheorie der Sintflut. Er wollte wissen, wo auf der Erde denn das Wasser zu finden sein sollte für eine Sintflut, die so hoch war, dass sie, wie die Bibel beschrieb, die »höchsten Berggipfel bedecken konnte«.
Burnet berechnete, dass für eine globale Überschwemmung dieser Tiefe das Wasser »von acht Ozeanen« erforderlich gewesen wäre. Die in der Genesis beschriebenen vierzig Regentage hätten aber höchstens für einen Ozean gereicht. Nicht einmal genügend Flüssigkeit, um auch nur die Füße der meisten Berge zu benetzen. »Wohin sollen wir denn gehen, um mehr als sieben Ozeane mit Wasser zu finden, die wir noch brauchen«, fragte Burnet. Er kam zu dem Schluss, dass es, wenn es nicht genügend Wasser gegeben hatte, weniger Erde gegeben haben musste. So entwickelte er seine Theorie vom »Mundane Egg«, dem Weltenei. Demnach war die Erde sofort nach ihrer Erschaffung ein ovaler Kugelkörper mit gleichmäßigen Formen gewesen, also ein Ei. Es war makellos in seiner Erscheinung und gleichmäßig in seiner Beschaffenheit, ohne Hügel oder Täler, die seine liebliche Form unterbrochen hätten. Unter der porzellanähnlichen Oberfläche verbarg sich jedoch eine komplizierte Innenarchitektur. Das »Eigelb« im Herzen der Erde war mit Feuer gefüllt und umgeben von mehreren Ringen, die in einander steckten wie die verschiedenen Puppen einer russischen Matrjoschka. Und das »Eiweiß,« Burnet war beharrlich in der Anwendung seiner Metaphern – war demnach ein mit Wasser gefüllter Abgrund, auf dem die Erdkruste trieb. So war die Burnetsche Erde beschaffen.
Burnet führte weiter aus, dass die Oberfläche des jungen Globus bei seiner Geburt zwar makellos gewesen sei, aber nicht unantastbar. Im Laufe der Jahre wurde die Kruste von der Sonneneinstrahlung ausgetrocknet und bekam Risse und Brüche. Von unten begann das Wasser immer stärker gegen die geschwächte Kruste zu drücken, bis es dann, dem Willen des Schöpfers entsprechend, zu »dieser großen, fatalen Überschwemmung« kam, der Sintflut. Die inneren Wassermassen und Feuerschlote brachen schließlich die Erdkruste auf. Einzelne Abschnitte der Kruste fielen in den frisch aufgerissenen Abgrund und die aufbrausenden Fluten überschwemmten die restlichen Landmassen. Sie bildeten einen »großen, ohne Grenzen oder Ufer in der Luft kreisenden Ozean«, wie Burnet auf anschauliche Weise beschrieb. Die physikalischen Bestandteile der Kruste, eine Mischung aus Fels und Erde, wurden weggeschwemmt. Und als sich die Wassermassen wieder zurückzogen, hinterließen sie Chaos. In Burnets Worten: »[E]ine Welt, die in ihrem Schutt lag.«
Burnets Theorie bedeutete nichts anderes, als dass der Globus, so wie er und seine Zeitgenossen ihn kannten, nichts anderes war als »das Bild oder Abbild eines großen Untergangs« und ein sehr schlechtes Abbild noch dazu. Als Bestrafung für die Gottlosigkeit der menschlichen Rasse hatte Gott mit einem einzigen Schlag »den Rahmen der alten Welt gesprengt und auf deren Ruinen eine neue entstehen lassen, die wir nun bewohnen«. Die Berge, die chaotischsten und charismatischsten aller Landschaftsformen, waren also nicht ursprünglich von Gott erschaffen worden. Sie waren nur die Überbleibsel nach dem Rückzug der Flut, nämlich Fragmente der Erdkruste, die von den kolossalen Kräften der Flut herumgewirbelt und aufeinander getürmt worden waren. Die Berge waren folglich nichts anderes als gigantische Andenken an die menschliche Sündhaftigkeit.
Die Illustration zeigt drei aufeinanderfolgende Stadien des Absinkens der Erdkruste in den Abgrund aus Wasser [1]. Das untere und letzte Bild zeigt die Entstehung der Berge [2] und Inseln [3].
Die englische Übersetzung von Burnets Buch im Jahre 1684 löste eine ganze Reihe hastiger Veröffentlichungen aus. Viele waren irritiert von seiner Annahme, dass die Erde in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht vollkommen sei, und auch davon, dass er die konventionelle Interpretation der Heiligen Schrift infrage stellte. Sie versuchten, seine ehrwürdige Theorie zu widerlegen. Die Kontroverse führte dazu, dass sich Burnets Ideen und die Gegenargumente in intellektuellen Kreisen rasch verbreiteten. Sowohl die Verteidiger als auch die Kritiker sprachen nur noch von der »Theorie«, wenn sie sich auf The Sacred Theory of the Earth bezogen, und bei nicht genauer erläuterten Bezügen zum »Theoretiker« war stets Burnet gemeint. Stephen Jay Gould, der amerikanische Wissenschaftler, Autor und Humanist, geht davon aus, dass The Sacred Theory das am weitesten verbreitete und meistgelesene Geologiebuch des 17. Jahrhunderts war.
So kam es, dass zum ersten Mal die intellektuelle Vorstellungskraft gefragt war beim Postulieren von Thesen über die Vergangenheit der wilden Landschaften der Erde. Durch die Burnet-Kontroverse wurde die Aufmerksamkeit auf das Erscheinungsbild der Berge gelenkt. Jetzt waren sie nicht mehr nur Tapete oder Hintergrund, sondern Objekte, die verdienten, dass man sie genauer betrachtete. Wichtig ist dabei auch, dass Burnet damals dafür sorgte, dass seine Nachfolger die Berge als furchtbar und aufregend zugleich wahrnahmen: Samuel Taylor Coleridge wurde beispielsweise von Burnets Prosa so aufgewühlt, dass er vorhatte The Sacred Theory in Blankverse zu übertragen. Und die Theorien des Erhabenen von Joseph Addison und Edmund Burke waren ebenfalls von Burnets Werk geprägt. Burnet sah und vermittelte das Großartige einer Berglandschaft und legte damit den Grundstein für eine ganz neue Betrachtungsweise der Berge.
Frontispiz zur zweiten Auflage von Burnets The Sacred Theory of the Earth (1691). Die sieben Erdkugeln stehen – chronologisch im Uhrzeigersinn – für die Stadien der Erdgeschichte, so wie sie in Burnets Buch beschrieben werden.
Doch Burnet hatte wegen seiner Brillanz auch zu leiden. Cambridge hatte einen Cordon Sanitaire, einen Sperrgürtel, aufgebaut, um das Eindringen von schädlichen oder gegenläufigen Ideen zu verhindern. Burnet hatte aber mit der Infragestellung der Heiligen Schrift diese Sicherheitszone durchbrochen. Nach der Glorious Revolution (1686–1688), jenen Vorgängen, die zur Absetzung von König James II. und zur Krönung von William III. und Mary II. einschließlich der Verabschiedung der Bill of Rights führten, wurde Burnet gezwungen, seine Ämter am Hof niederzulegen und wurde bei der Vergabe des Amtes des Erzbischofs von Canterbury übergangen. Seine Reputation als Autor war aber nachhaltiger als seine vagen Verdienste als anglikanischer Geistlicher. Mit seiner These, das Antlitz der Erde müsse nicht immer gleich ausgesehen haben, löste Burnet die noch heute anhaltende Erforschung der Erdgeschichte aus. Im Vorwort seines Buches brüstet er sich damit, dass er »eine Welt wieder hervorgeholt habe, die seit Tausenden von Jahren in Vergessenheit geraten war!«. Er hatte allen Grund, sich damit zu brüsten, denn Burnet war der erste geologische Zeitreisende – ein Eroberer des entlegensten aller Länder: der fernen Vergangenheit.
Burnet hatte zwar infrage gestellt, dass die sichtbare Welt immer gleich aussah, aber er hatte nicht unterstellt, dass sie älter als jene 6000 Jahre sein könnte, die Ussher berechnet hatte. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Alter der Erde maßgeblich älter eingestuft. Einer der bedeutendsten Abweichler von der orthodoxen Übereinkunft der »jungen Erde« war der selbstbewusste französische Naturhistoriker Georges Buffon (1707–1788). In seiner umfangreichen Allgemeinen Naturgeschichte (1749–1788) skizzierte Buffon einen Überblick über die Erdgeschichte, die er in sieben Epochen aufgliederte. Er schlug vor, dass jeder Tag der Schöpfung nur eine Metapher für einen wesentlich längeren Zeitraum sei. In der Öffentlichkeit schätzte er das Alter der Erde auf 75 000 Jahre, obwohl er spürte, dass diese Zahl zu konservativ war. Nach seinem Tod fand man in seinen Notizen die Schätzung von mehreren Milliarden von Jahren.
Buffons Vorgehensweise war schlau, denn indem er jeden biblischen Tag in eine Epoche von unbestimmter Dauer verwandelte, schuf er den Raum und die Zeit, den die Geologen benötigten, um eine authentische Geschichte der Erde entwickeln und dabei gleichzeitig die Heilige Schrift respektieren zu können. Es war das Werk von Buffon und anderen Denkern wie ihm, Usshers präzise Datierung der Erdentstehung auf 4004 vor Christus als ein Totem sklavischer biblischer Auslegung zu entlarven.* Nachdem nun die Vergangenheit der Erde nicht mehr auf 6000 Jahre begrenzt wurde, war es fortan möglich, auf systematischere Weise Vermutungen aufzustellen, welche Veränderungen in größeren Zeiträumen möglich gewesen wären. Die Geologie konnte zur Wissenschaft werden und sich mit dieser neuen alten Erde selbst definieren. Und sie war dabei gleichzeitig gegen den Vorwurf der Blasphemie abgesichert.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten sich jene Denker, die sich für die Entstehungsgeschichte der Erde interessierten, in zwei Schulen mit unterschiedlichen Lehrmeinungen aufgesplittet, in die Anhänger der Kataklysmen – oder Katastrophen-Theorie und die des Aktualismus. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Geologen des späten 19. Jahrhunderts, besonders aber Charles Lyell (1979–1875), zu Übertreibungen neigten, wenn sie darauf eingingen, wie sehr sich die Anhänger der beiden Lehrmeinungen intellektuell bekämpft haben. Dabei ist von Bedeutung, dass die Fronten zwischen ihnen, trotz ihrer unterschiedlichen Ansichten, nie klar abgesteckt wurden.
Die Anhänger der Katastrophentheorie glaubten, dass die Entstehungsgeschichte der Erde von größeren geophysischen Revolutionen bestimmt war – von einer oder vielen »Götterdämmerungen« in der Vergangenheit, welche die Erde mit Wasser, Eis und Feuer heimgesucht und dabei fast jegliches Leben ausgelöscht hatten. Die Erde war demnach ein Friedhof, eine Nekropolis, in der unzählige, jetzt ausgestorbene Arten begraben sind. Hochwasser, globale Tsunamis, schwere Erdbeben, Vulkane, Kometen – Katastrophen wie diese hatten die Oberfläche der Erde erschüttert und bis zu ihrer aktuellen Form gebracht. Eine populäre Theorie des Kataklysmus über die Gebirgsbildung ging etwa davon aus, dass die Erde, die seit ihrem weißglühenden Ursprungszustand abkühlte, langsam an Volumen verlor und ihre Oberfläche in der Folge immer stärkere Falten bekam – genauso wie die Haut eines Apfels schrumpelig wird, wenn er austrocknet. Die Gebirgsmassive der Welt waren folglich nichts anderes als die Falten und Runzeln der irdischen Haut.
Die Gegentheorie zu dieser Vision von den gewalttätigen Vorfällen in der Entwicklungsgeschichte der Erde wurde von den Aktualisten propagiert. Sie hielten dagegen, dass die Erde nie von globalen Katastrophen heimgesucht worden sei. Erdbeben, Vulkane, Überflutungen, ja, zweifellos hatte es diese Phänomene in der Erdgeschichte immer wieder gegeben. Dabei handelte es sich jedoch nur um lokale Katastrophen, welche die Landschaft nur in der Umgebung zerstört und neu geordnet hatten. Gewiss war die Oberfläche der Erde drastischen Veränderungen unterworfen worden – der Beweis dafür war in jedem Gebirgsmassiv oder an jeder Küstenlinie zu erkennen. Diese Veränderung war jedoch erstaunlich langsam verlaufen durch die Zug- und Druckkräfte, die auch jetzt noch an der Erdoberfläche tätig waren.
Mit genügend Zeit, so argumentierten die Aktualisten, konnten die normalen Einsatzkräfte der Natur wie Regen, Schnee, Frost, Flüsse, Meere, Vulkane und Erdbeben die größten Effekte bewirken. Was die Anhänger des Kataklysmus also als Folge eines Unglücks betrachteten, war demnach das Ergebnis eines langsamen, andauernden Bodenkriegs. Der Grundpfeiler der Aktualismus-Theorie lautete, die Gegenwart sei der Schlüssel zur Vergangenheit. Mit anderen Worten: Man kann durch die genaue Beobachtung der gegenwärtig an der Erdoberfläche ablaufenden Prozesse Rückschlüsse auf die Geschichte der Erde ziehen. Das war eine Version der Idee vom steten Tropfen, der den Stein aushöhlt: Lass einem Fluss oder Gletscher genügend Zeit, und er wird einen Berg in zwei Hälften teilen. Zeit, viel Zeit, das war es, was die Aktualisten brauchten, damit ihre Theorien der Arbeitsprozesse aufgingen. Und so datierten sie die Entstehung der Erde viel weiter zurück, als es je zuvor in Betracht gezogen worden war.
Der berühmteste unter den frühen Aktualisten, dem gewöhnlich die Vaterschaft der »Alten Geologie« zugerechnet wird, war der Schotte James Hutton (1726–1797). Hutton besaß eine intuitive Fähigkeit, physikalische Vorgänge umzukehren und Landschaften rückwärts zu lesen. Wie alle Begründer der Geowissenschaft war Hutton ein begeisterter Wanderer und zog jahrzehntelang kreuz und quer durch das schottische Hochland, wobei er versuchte, durch eine Mischung von Induktion und Imagination die Prozesse zu erahnen, die diese Landschaften in ihren gegenwärtigen Zustand gebracht hatten. Während er mit dem Finger über den weißen Quarz strich, der die grauen Granitblöcke in den engen schottischen Glens durchzog, wurde Hutton klar, was einst beim Aufeinandertreffen dieser beiden Felsarten geschehen war: Er »sah« wie der durch unglaublich hohen Druck geschmolzene Quarz sich seinen Weg in die Schwachstellen des Muttergesteins Granit gesucht hatte. Hutton zu folgen bedeutete, in einer Welt mit einer furchterregend weit zurückreichenden Vergangenheit zu leben. John Playfair, einer seiner Kollegen und Bewunderer, beschrieb in einem berühmt gewordenen Bericht, wie er einmal zusammen mit Hutton eine geologische Fundstätte an der Küste von Berwick besuchte. Als Hutton die Bedeutung der Felsstruktur erklärte, schrieb Playfair, war ihm, als »würde der Verstand von Schwindel ergriffen, weil er so tief in den Abgrund der Zeit hinabsah«.
Zwischen 1785 und 1799 erschien Huttons Opus Magnum Theory of the Earth in drei Bänden: ein Destillat seines jahrzehntelangen Nachsinnens über die Entstehung der Landschaft. Darin stellt er die These auf, dass die Erde, so wie wir sie kennen, nur eine Momentaufnahme in einer Reihe von Zyklen unbekannter Zahl ist. Die offensichtliche Dauerhaftigkeit von Bergen und Küstenlinien sei faktisch eine Illusion, entstanden als Folge unserer winzig kleinen Lebensspanne. Wenn wir Äonen von Jahren leben würden, könnten wir nicht nur Zeugen beim Untergang der Zivilisationen werden, sondern auch bei der völligen Umgestaltung der Erdoberfläche. Wir würden sehen, wie Berge durch Erosion vollkommen abgetragen werden und wie sich unter dem Meeresspiegel neue Landmassen bilden. Erodiertes Geröll der Kontinente, das als Sedimentschicht auf dem Meeresgrund abgelagert wurde, würde durch die Hitze des Erdkerns in Gestein umgewandelt und Jahrmillionen später emporgehoben werden, um neue Kontinente und neue Gebirgsmassive zu bilden. Das war der Grund, so Hutton, dass man im Gestein auf Berggipfeln versteinerte Muscheln finden konnte. Nicht etwa, weil sie von der Sintflut dorthin gespült worden wären, sondern weil sie durch die unerbittlichen, langwierigen Prozesse der Erde vom Meeresboden bis zur Bergspitze hochgehoben wurden.
Hutton grenzte das Alter der Erde nicht ein. Seiner Vision zufolge reichte die Erdgeschichte unendlich weit in die Vergangenheit zurück und erstreckte sich unendlich weit in die Zukunft. Der Schlusssatz seines Buches sollte durch die Jahrhunderte hallen: »Das Ergebnis unserer gegenwärtigen Untersuchungen ist, dass wir keinen Hinweis auf einen Anfang haben – und keine Aussicht auf ein Ende.« Diese undefinierte Ausdehnung der Erdgeschichte war der wichtigste Beitrag der Geologie auf die Vorstellungen der Allgemeinheit.
Welchen Einfluss hatte diese geologische Revolution auf das Bild, das man sich von den Bergen machte? Nachdem die Geologen gezeigt hatten, dass die Erde Millionen von Jahren alt ist und immensen Veränderungen unterworfen war und noch immer ist, konnten die Berge nie mehr so betrachtet werden wie zuvor. Plötzlich wurde diesen Sinnbildern der Beständigkeit eine aufregende und verblüffende Wandlungsfähigkeit zugesprochen. Die Berge, die so beständig und zeitlos wirkten, hatten sich in Wirklichkeit über unzählige Jahrtausende hinweg gebildet, verformt und wieder neu gebildet. Ihr gegenwärtiges Erscheinungsbild war nur eine Phase im unendlichen Kreislauf von Erosion und Gebirgsbildung, der die Gestalt der Erde prägte.
Eine neue Generation von Bergsteigern wurde von den gespenstischen Landschaften angezogen, die sich bei der Untersuchung durch die Geologen plötzlich aufgetan hatten. »Was ich so klar wie nie zuvor erkannte«, schrieb 1780 Horace-Bénédicte de Saussure, der Genfer Naturwissenschaftler, »das war das Grundgerüst all dieser großen Berge, ihre Beziehung zueinander und deren wahre Struktur, die ich schon früher so gerne verstanden hätte.«
Die Geologie schuf einen Grund und eine Entschuldigung dafür, in die Berge zu reisen, nämlich die wissenschaftliche Untersuchung.
Ein Gefühl der Neugier, welches das natürliche Interesse weit übersteigt, bringt Reisende aus allen Teilen Europas dazu, den Montblanc aufzusuchen, den höchsten Punkt der Alten Welt, um dort die Gletscher der Umgebung zu erforschen,
stellte ein englischer Journalist 1801 fest.
Diese Orte haben seit Kurzem ein neues Maß an Interesse hervorgerufen – Geologen, Mineralogen und reine Amateure begeben sich mit Begeisterung dorthin. Und sogar Frauen werden durch das Vergnügen beim Anblick von Dingen, die völlig neu für sie sind, weitgehend für die Anstrengungen der Reise entschädigt.
»Strata Types«, das Frontispiz zu Humphry Davys Elements of Agricultural Chemistry (1813), zeigt die verschiedenen Gesteinsschichten, die die Geologie sichtbar gemacht hatte.
Die Berge anzuschauen bedeutete nun auch, in sie hineinzusehen und sich ihre Vergangenheit vorzustellen. Der englische Wissenschaftler Humphry Davy brachte es 1805 auf den Punkt:
Für denjenigen, der geologische Untersuchungen anstellt, bietet jede Bergkette erstaunliche Denkmäler der großen Veränderungen, denen der Globus unterworfen war. Die erhabensten Vermutungen werden geweckt, die Gegenwart bleibt unbeachtet, vergangene Zeitalter rücken in den Vordergrund. Und der Verstand verliert sich in Bewunderung angesichts der Gestaltung dieser großen Kraft, die jene Ordnung herbeiführte, die auf den ersten Blick nur ein wildes Durcheinander zu sein scheint.
Hier kam also eine andere Form von Schwindelgefühl zu jener bekannteren Form hinzu, die einen an einem steilen Berg überkommen kann: die, welche durch eine lange Vergangenheit hervorgerufen wird. Wie Burnet schon im Jahrhundert zuvor angedeutet hatte, war das Bergsteigen zu einer Erfahrung geworden, bei der man sich nicht nur im Raum nach oben bewegte, sondern auch rückwärts durch die Zeit.
James Hutton mag der Vater der Geologie gewesen sein, aber er war keinesfalls deren elegantester Repräsentant. Abgesehen von seinen klangvollen Schlusssätzen war Huttons Theorie in einer Prosa verfasst, die so eintönig und undurchschaubar war wie der Old Red Sandstone an der schottischen Küste, auf den er so stolz war. Es würde noch dreißig Jahre dauern und einen anderen legendären Geologen erfordern, bis die raschen Fortschritte der Geologie und die atemberaubenden Berichte darüber richtig populär werden und noch mehr Menschen in die Berge locken sollten. Noch mehr als Burnet oder sogar Hutton war der schottische Geologe Charles Lyell verantwortlich dafür, dass sich die sprachlichen Begriffe und die Vorstellungen der Geologie im 19. Jahrhundert verbreiteten.
Charles Lyell war Rechtsanwalt, bevor er zum Geologen wurde, und seine forensische Ausbildung hatte ihm zu einem Schreibstil von extremer Klarheit und Eleganz verholfen. Zwischen 1830 und 1833 veröffentlichte er die drei Bände von The Principles of Geology: an Attempt to Explain the Former Changes of the Earth’s Surface by Reference to Causes Now in Operation, ein Werk, das sorgfältig und kurzweilig die Argumente der Aktualisten darlegte, dass das Studium der Gegenwart der Schlüssel zur Vergangenheit sei. Die Principles wurden rasch zur Pflichtlektüre des Bildungsbürgertums seiner Zeit und vielfältig übersetzt. Bis 1872 wurden elf überarbeitete Ausgaben veröffentlicht.
Lyells Brillanz lag in erster Linie in seiner Zuordnung von Details. Genauso wie Charles Darwin es in seinem 1859 erschienenen Werk Über den Ursprung der Arten durch natürliche Selektion getan hatte, konnte Lyell seine Zuhörer mit einer Kombination aus unwiderlegbaren Fakten – diesbezüglich ähnelte seine Schrift dem Prozess, den sie beschrieb – und erläuternden Anekdoten für sich gewinnen. Eine große Anziehung ging auch davon aus, dass das Wissen, das Lyell in groben Zügen skizzierte, etwas Demokratisches hatte: Man benötigte keine spezielle Ausrüstung oder lange Schulung, um die Geschichte der Erde entziffern zu können, sondern nur ein Paar scharfe Augen, einige grundlegende Kenntnisse über die Prinzipien des Aktualismus sowie genügend Neugier und Mut, um über die Kante in den Abgrund der Zeit hinabzuschauen. Jeder, der diese minimalen Qualifikationen besaß, konnte die aufregendste Vorführung der Erde besuchen: die ihrer Vergangenheit.
Um uns vor Augen zu führen, wie diese neue Art der Betrachtung der Berge in der Praxis aussieht, gehen wir zurück ins Jahr 1835 und in die Stadt Valparaiso, die sich entlang der pazifischen Küste von Chile erstreckt. Der Name der Stadt bedeutet »Paradiestal« und es hätte kaum ein Name gefunden werden können, der schlechter gepasst hätte als dieser. Zum einen liegt die Stadt nicht in einem Tal, sondern auf einem schmalen, annähernd horizontalen Landstrich zwischen den Wellenkämmen des Pazifiks und dem steilen roten Felsmassiv hinter der Stadt. Und paradiesisch ist sie ganz bestimmt nicht. Der ablandige Wind, der hier ständig über die Oberfläche fegt, das steile Gelände und der salzhaltige Boden sorgen dafür, dass es keine nennenswerte Vegetation gibt. Abgesehen von den Menschen, die sich in kleinen Ansammlungen von eng aneinandergeschmiegten, niedrigen weiß-getünchten Häusern mit roten Dachziegeln in den Flussläufen und Schluchten angesiedelt haben, findet man hier wenig Leben.
An der Küste schaukeln reihenweise Ruderboote im Wasser, jederzeit einsatzbereit, um die großen Schiffe zu versorgen, die draußen in den tieferen Gewässern vor Anker liegen. Allem Anschein zum Trotz ist Valparaiso nämlich Chiles bedeutendster Überseehafen. Und über diese ganze Szene streicht die klare, trockene Sommerluft der Küste.
Am 14. August 1835 bricht Charles Darwin von hier auf dem Rücken eines Pferdes zu einem langen Ausflug ins Hinterland der Anden auf. Draußen in der Bucht ankert sein Schiff, die mit zehn Kanonen ausgestattete Brigg »Beagle«, auf der er als wissenschaftlicher Beobachter tätig ist. Während Darwin in Cambridge studierte, interessierte er sich auch für Geologie und packte, bevor er an einem wilden, stürmischen Abend im Dezember 1831 von Devonport aufbrach, um gen Süden zu segeln, den ersten Band von Lyells Principles als Lektüre für die lange Seereise nach Südamerika ein. Er überprüfte Lyells Theorien während eines Landgangs auf den Kapverdischen Inseln, und als man von der Beagle schließlich erstmals die Tiefebenen Patagoniens erblickte, war Darwins Vorstellungskraft bestens gerüstet, um die Landschaftsformen, auf die er dort stieß, mit Lyells Begriffen interpretieren zu können – und aus der aktuellen Gestalt auf eine lange Vergangenheit zu schließen. »Mir kommt es stets so vor, als ob meine Bücher zur Hälfte aus Lyells Gedanken bestehen«, schreibt er später seinem Freund Leonard Horner,
denn ich dachte immer, der große Verdienst der Principles liege darin, dass dieses Buch die ganze Denkweise veränderte und man deshalb, selbst wenn man etwas sah, das Lyell nie gesehen hatte, es doch zum Teil mit seinen Augen sah.
Als Darwin Valparaiso verlässt, reitet er zunächst einen Tag an der Küste entlang nach Norden, um die Lagerstätten von versteinerten Muscheln zu sehen, von denen ihm gesagt worden war, dass er sie besuchen müsse. Sie waren erstaunlich: lange Bänke verkalkter Mollusken, die, wie Darwin richtig ableitet, durch die langsame Bewegung der Erdkruste emporgehoben worden waren bis zu ihrem aktuellen Platz einige Meter über dem Meeresspiegel. Nachdem er die Muscheln gesehen und auch beobachtet hatte, wie eine Horde von Einheimischen mit Pickeln und Schaufeln ganze Karrenladungen davon plünderte, um daraus Kalk zu brennen, reitet Darwin landeinwärts durch das weite und fruchtbare Quillota-Tal. (»Wer auch immer Valparaiso das paradiesische Tal genannt hat, muss dabei an Quillota gedacht haben«, vermerkt er später in seinem Tagebuch.) Das Tal ist dicht bewachsen mit Olivenhainen, dazwischen stehen kleine viereckige Obstgärten mit Orangen-, Pfirsich- und Feigenbäumen, die von den Talbewohnern zurechtgestutzt wurden. An den höher gelegenen Hängen leuchten fruchtbare Weizenfelder im Licht der Sonne, und darüber erhebt sich die »Glocke von Quillota«, ein 1900 Meter hoher Berg mit angeblich großartigem Ausblick. Darwin war hierhergekommen, um diesen Berg zu besteigen.
Nachdem er eine Nacht in einer Hazienda am Fuß des Berges verbracht hat, beschafft sich Darwin einen Gaucho als Führer sowie frische Pferde und beginnt den schwierigen Aufstieg durch die Haine aus dickstämmigen Palmen und hohem Bambus, die an der Bergflanke prächtig gedeihen. Die Pfade sind nicht gut beschaffen und bei Einbruch der Nacht haben die Männer nur drei Viertel der Strecke bis zum Gipfel bewältigt. Sie stellen ihr Lager neben einer Quelle auf, und unter einem Bambushain macht der Gaucho ein Lagerfeuer, an dem er Streifen von Rindfleisch brät und für den Mate-Tee Wasser zum Kochen bringt. In der Dunkelheit tanzt der Feuerschein an der Wand aus Bambus und für einen kurzen Moment wirkt dies auf Darwin wie die Architektur einer exotischen Kathedrale, die von flackernden Flammen beleuchtet wird. Die Atmosphäre ist so klar und mondhell, die Luft so rein, dass Darwin die einzelnen Masten der Schiffe erkennen kann, die vierzig Kilometer vor Valparaiso ankern. Sie sehen aus wie kleine schwarze Striche.
Früh am nächsten Morgen steigt Darwin über die Felsböcke aus Grünschiefer hinauf zum flachen Gipfel. Von dort schaut er hinüber zu den weißen Türmen und Bastionen der Anden und hinab zu den Wunden an den Flanken der niedrigeren Hügel, welche die gefräßigen chilenischen Goldminen dort zurückgelassen hat. Die Aussicht überrascht ihn:
Wir verbrachten den Tag auf dem Gipfel, und ich habe keinen Tag mehr genossen als diesen. Die Freude über den Ausblick, der an sich schon schön war, wurde noch verstärkt durch die zahlreichen Überlegungen, die sich allein schon durch den Anblick des großen Massivs ergaben. […] Wer hegt denn keine Bewunderung für die wundersamen Kräfte, die diese Berge hochgehoben haben. Und noch mehr für die unzähligen Jahrtausende, die dafür erforderlich waren, solche Massive zu durchbrechen, abzutragen und dem Erdboden gleichzumachen? Es empfiehlt sich, in einem solchen Moment an die riesigen Sediment- und Schotterebenen Patagoniens zu denken, die, wenn man sie auf die Kordilleren häufen würde, diese um mehrere Tausend Meter anwachsen ließe. Als ich in diesem Land war, wunderte ich mich, dass eine Gebirgskette, die solche Geröllmengen liefern kann, noch immer existiert. Wir dürfen nun dieses Wunder nicht mehr bezweifeln, dass die allmächtige Zeit so gigantische Berge wie die Kordilleren zu Kies und Schlamm zernagen kann.
Aus seiner Adlerhorst-Perspektive schweifen Darwins Augen nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. Tatsächlich ist das Vergnügen beim Anblick der Landschaft, die sich unter ihm erstreckt, zweitrangig im Vergleich zu der imaginären Landschaft, die er in seiner Vorstellung sieht: die riesigen schneebedeckten Gipfel und Massive, die hier einmal existiert haben müssen, die jedoch »dank der wunderbaren geologischen Kräfte« nicht mehr da sind. Darwin blickt in Wirklichkeit mit seinem inneren Auge von einer Bergkette zur anderen, die dank Lyells Theorien erst seit Kurzem auf fantastische Weise für ihn sichtbar geworden sind.
Momente wie diese gibt es in Hülle und Fülle in Darwins Tagebüchern. Am spannendsten für die vielen Leser seines veröffentlichten Reiseberichtes The Voyage of the Beagle (seinerzeit ein Bestseller), war die Erfahrung, dass man mit Darwin nicht nur zur sturmgepeitschten Landspitze von Tierra del Fuego (»Feuerland«) und zu den silbernen Wüsten von Patagonien reisen konnte, sondern auch vor und zurück innerhalb der vor Kurzem entdeckten riesigen geologischen Zeiträume. Die Beagle war eines der ersten Schiffe, die Zeitreisen ermöglichten – ein Prototyp der »Starship Enterprise«, die von einem Gemisch aus Darwins wunderbarer Vorstellungskraft und Lyells Einblicken angetrieben wurde.
Jeder, der schon in wilden Gegenden unterwegs war, wird auf irgendeine Weise jene Tiefe der Zeit erlebt haben, die John Playfair in Berwick und Darwin in Chile empfanden. Es war früh im März als ich durch das Strath Nethy wanderte, ein langes schottisches Tal jenseits der Cairngorm Mountains. Wie alle Glens in diesem Teil der Welt bildet sein Querschnitt die Form eines abgeflachten U. Es ist so geformt, weil das Schottische Hochland bis vor rund 8000 Jahren von Gletschern bedeckt war, ebenso wie Teile von Wales und dem Norden Englands, fast ganz Nordamerikas und weite Teile von Europa. Diese Gletscher bewegten sich langsam über das Land, schliffen es ab, zermalmten es und formten es wieder neu.
Als ich an diesem Tag durch das Tal wanderte, konnte ich auf beiden Seiten in etwa zwei Drittel Höhe die Höchststandmarke des Gletschereises erkennen, markiert durch die Blöcke, die dort oben einst in einer unregelmäßigen Reihe abgelagert wurden wie Treibgut am Strand. Auch die Flanken des Tales waren seitlich eingeschnitten von Dutzenden kleinen Bachläufen. In den Millionen von Jahren seit sich der Gletscher aus dem Tal zurückgezogen hatte, haben sich die Bachläufe tief in den Granit hineingefressen durch das ständig daran nagende Regenwasser, das über dessen Flanken rann. Hat das Wasser erst einmal eine Rinne gefunden, wird diese vertieft, indem Gesteinspartikel ausgespült werden oder dazu beitragen, andere Partikel herauszulösen, bis es sich schließlich eine Rinne geschaffen hat, die dann zum Kanal wird und schließlich zum Bachbett.
Ich folgte dem Verlauf eines dieser Bäche und stieg den östlichen Abhang hoch bis zur Markierungslinie. Der Heidebewuchs darauf war wegen der schmelzenden Schneereste rutschig, und ich musste oft mit einer Hand hineingreifen, um mich abzustützen. Als ich in die Nähe der Blöcke kam, schreckte ich ein Schneehuhn auf und es flog keckernd hinauf in den weißen Himmel, von dem sich seine Silhouette abzeichnete.
Als ich die Blöcke schließlich erreichte, waren meine Finger kalt. Ich rieb sie aneinander, ging von Block zu Block talaufwärts und stellte mir dabei vor, wie das Eis die Schlucht wie eine Badewanne auffüllte. Jeder Felsblock, an dem die tagsüber gespeicherte Wärme den Schnee der Umgebung weggeschmolzen hatte, war von dunkler Erde umgeben. Ich ging weiter, bis es steiler wurde und ich zurück zum Talgrund musste. Der Pfad brachte mich in die Nähe einer frei liegenden Felsfläche von etwa zehn Quadratmetern. Ich ging hinüber und in die Hocke, um sie zu untersuchen. Die waagrecht verlaufenden Schleifspuren zeigten, dass der Fels einst vom Gletscher bearbeitet worden war, der dieses Tal geschaffen hatte, und er eine jener Stellen war, an denen der Gletscher seinen gewaltigen Bauch gerieben hatte.
Ich schaute hoch. Es hatte vor Kurzem geschneit und die Hügel, die hinter dem Tal zu sehen waren, waren unter einer dünnen Schneeschicht grau. Ihre Umrisse wirkten dadurch weicher. Auf diese Entfernung waren sie vor dem weißen Winterhimmel kaum noch zu erkennen und nur ein paar dunkle Striche deuteten ihre Konturen an. Sie erinnerten mich an Kohlezeichnungen oder chinesische Aquarelle.
Nach zwei Stunden erreichte ich den Taleingang, der im Westen bewacht wird vom kegelförmigen Stac-on-Iolaire, dem Adlerfels, und im Osten von Bynack More und Bynack Beg. Als ich zurückblickte zu den Wäldern im Norden, sah ich vielleicht in einer Entfernung von einem Kilometer – rostfarben auf weiß – ein Rudel Rotwild, das über die Flanke lief und die Beine immer dort höher hob, wo der Schnee oder die Heide tiefer wurden. Ich stand einige Minuten lang da und beobachtete die Prozession der Rehe, die einzigen Objekte in dieser Landschaft, die sich bewegten, und wurde plötzlich jäh von der Zeit fortgerissen. Vor 20 000 Jahren, im Zeitalter des Pleistozäns, lag dieser von Heide überwachsene Granit, über den die Rehe zogen, unter Millionen Kubikmetern Eis begraben. Vor 60 Millionen Jahren, als Schottland gewaltsam von Grönland und Nordamerika abgetrennt wurde, ergoss sich Basaltlava über das Land. Vor 170 Millionen Jahren driftete Schottland durch die nordischen Tropen, und dort, wo ich stand, war eine trockene rötliche Wüstenlandschaft. Und vor etwa 400 Millionen Jahren existierte in Schottland ein Gebirge mit den Ausmaßen des Himalaja, von dem nur erodierte Stummel übrig geblieben sind.
Loch Ruicht und Cairngorm
Selbst wenn man nur Grundkenntnisse der Geologie besitzt, so verleihen sie einem doch die Fähigkeit, die Landschaft mit anderen Augen zu sehen. Sie ermöglichen den Blick zurück in Zeiten, in denen sich Felsen verflüssigen und Meere versteinern, in denen Granit herumschwappt wie Haferschleim, Basalt wie Eintopf köchelt und Kalksteinschichten so leicht zusammengefaltet werden wie Wolldecken. Durch die Schauspiele der Geologie wird die Terra firma zur Terra mobilis, und wir werden gezwungen, unsere bisherigen Überzeugungen darüber, was fest ist und was nicht, zu hinterfragen. Wenn wir also dem Gestein die Macht zusprechen, die Zeit zu überdauern und ihre Tribute zurückzuweisen (durch Steinhügel, Steinplatten, Monumente, Statuen), dann stimmt das nur in Bezug auf unsere eigene Vergänglichkeit. Betrachtet man dies im Kontext des größeren geologischen Rahmens, dann ist Fels genauso dem Wandel unterworfen wie jede andere Substanz.
Vor allem aber ist die Geologie eine eindeutige Herausforderung für unser Verständnis von Zeit. Sie verursacht Schwindelgefühle beim Gedanken an das Hier und Jetzt. Die imaginäre Erfahrung dessen, was der Schriftsteller John McPhee »tiefe Zeit« nannte, also einer Zeit, deren Einheiten nicht aus Tagen, Stunden, Minuten oder Sekunden bestehen, sondern aus Millionen von Jahren, reduziert die menschliche Existenz zu einem winzigen Punkt auf der unendlichen Achse der Zeit.
Betrachtet man die Ausmaße dieser »tiefen Zeit«, dann wird man auf wunderbare und zugleich furchterregende Weise mit dem völligen Zusammenbruch der Gegenwart konfrontiert, die zum Nichts wird angesichts der vergangenen und der zukünftigen Zeiten, die viel zu ausgedehnt sind, als dass man sie sich vorstellen könnte. Und das ist sowohl ein körperlicher als auch ein geistiger Schock. Sich einzugestehen, dass der harte Fels eines Berges durch den Zahn der Zeit verletzbar ist, ist die Voraussetzung dafür, über die entsetzliche Vergänglichkeit des menschlichen Körpers nachzudenken. Die Betrachtung der Tiefe der Zeit hat aber auch etwas seltsam Erregendes. Man lernt dabei unmissverständlich, dass man nur ein winziger Punkt ist in den Weiten des Universums. Man wird aber auch mit der Erkenntnis belohnt, dass man existiert – so unwahrscheinlich einem das auch vorkommen mag, man existiert.
Die Principles of Geology von Charles Lyell und all die anderen geologischen Arbeiten, die kurz danach versuchten, es ihm gleichzutun, öffneten die Augen der Menschen des 19. Jahrhunderts für die dramatische, verborgene Vergangenheit der Erde. Die allgemeine Vorstellungskraft begann, sich mit der Ästhetik einer maßlosen Langsamkeit und mit den allmählichen Veränderungen über Epochen hinweg auseinanderzusetzen. Und welche Position man auch immer vertrat gegenüber den großen Bewegungen der geologischen Debatte oder den diversen kleinen Erschütterungen und Konflikten, die die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts beunruhigten: Das, was absolut verwunderlich und erschreckend zugleich war, das war das unbeschreibliche Alter der Erde. In knapp einem halben Jahrhundert hatte die Geologie die Erdgeschichte um Milliarden von Jahren in Richtung Vergangenheit enthüllt.
Das 17. und 18. Jahrhundert waren Zeitalter, in denen sich der Raum ausdehnte, in denen das Reich des Sichtbaren durch das Mikroskop und das Fernrohr stark vergrößert wurde. Es gibt Bilder aus dieser Zeit, die daran erinnern, wie überraschend diese plötzliche Ausdehnung des Raumes gewesen sein muss. Da wäre beispielsweise der holländische Linsenschleifer Antony van Leeuwenhoek, der 1674 in sein rudimentäres Mikroskop blickt und eine große Anzahl an Mikroorganismen erblickt, die sich in einem Wassertropfen sammeln: »Die Bewegung der meisten dieser Kleinstlebewesen im Wasser war so schnell, mal auf und ab und rundherum, dass es wunderbar anzuschauen war […].«
Oder auch Galileo Galilei, der 1609 durch sein Teleskop zum Mond hinaufschaut und als erster Mensch feststellt, dass es dort oben hohe Berge und tiefe Täler gibt. Und schließlich Blaise Pascals Mischung aus Erstaunen und Entsetzen als ihm klar wird, dass der Mensch unsicher schwankend zwischen zwei Abgründen steht: zwischen der unsichtbar winzigen Welt der Atome mit der Unendlichkeit ihrer Universen, von denen jedes einzelne aus Firmament, Planeten und »Erde« besteht, sowie dem unsichtbaren Kosmos, der zu groß ist, ihn zu überblicken, und der sich mit der Unendlichkeit seiner Universen unermesslich weit über dem nächtlichen Himmel ausbreitet.
Das 19. Jahrhundert war dann das Zeitalter, in dem die Zeit ausgedehnt wurde. Die beiden vorausgehenden Jahrhunderte hatten die sogenannte Pluralität der Welten zum Vorschein gebracht, die in den Traktaten über den Raum und über den Mikrokosmos der Atome existierten. Die Geologie des 19. Jahrhunderts zeigte dagegen die Vielzahl der Welten, die früher auf der Erde existiert hatten, jetzt aber verschwunden waren. Einige der Bewohner dieser früheren Welten sorgten dabei für mehr Aufregung als alle anderen Entdeckungen aus diesen uralten Zeiten. Das waren eine ganze Reihe monströser Kreaturen, die einst auf der Erde gelebt hatten: Mammuts, andere Säugetiere, Meeresdrachen und die Dinosaurier (wortwörtlich: »beängstigend große Echsen«), wie sie 1842 vom Paläontologen Richard Owen getauft wurden. Jahrhundertelang hatte man versteinerte Knochen und Zähne aus dem Boden geholt, aber erst im frühen 19. Jahrhundert wurde erkannt, dass einige dieser Relikte von verschiedenen ausgestorbenen Arten stammten.
»The Rocks and Antediluvian Animals«, Frontispiz aus Ebenezer Brewers Theology in Science (1860)
Der französische Naturhistoriker Georges Cuvier (1769–1832) trug mehr als jeder andere zu dieser Erkenntnis bei. Es war Cuvier, der in der Kontroverse über das Artensterben nicht nur den Beweis lieferte, sondern auch den erforderlichen konzeptionellen Rahmen dafür schuf, Dinosaurier als versteinerte Tiere betrachten zu können. Cuviers Fallbeispiel war das behaarte Mammut. Indem er den Aufbau versteinerter Knochen des Mammuts mit dem von zeitgenössischen afrikanischen und indischen Elefanten verglich, bewies er, dass die fossilen Knochen zu einer anderen Spezies gehörten. Im Jahre 1804 überraschte er seine Hörer am Institut National de Paris mit der Behauptung, dass riesige, stark behaarte Elefanten, die nicht mehr auf der Erde leben, einst Frankreich bewohnten und mit großer Wahrscheinlichkeit in Herden auch dort hindurchgestampft sind, wo sich nun die makellosen Gärten von Versailles befanden. Da Cuvier hinsichtlich seines Körperumfangs als ein durchaus gewichtiger Mann bezeichnet werden konnte, bekam er zwangsläufig bald den Spitznamen »das Mammut«.
Cuvier wurde zu Lebzeiten zu einer Berühmtheit, zum Teil wegen seines phänomenalen Gedächtnisses – er war bekannt dafür, sich an alle 19 000 Bücher in seiner Bibliothek erinnern zu können –, vor allem aber als Anatom. Während Hutton die bemerkenswerte Fähigkeit hatte, Felsen in ihre Einzelbestandteile zu zerlegen, war Cuvier derjenige, der die Großtiere Europas aus ihren versteinerten Knochen rekonstruieren konnte und in der Lage war sich vorzustellen, wie diese Biester, die einst über die Erde zogen, wohl ausgesehen hatten. Er verband überdimensionale Skelettteile durch Draht miteinander, bettete Knochenbestandteile in Zement ein und entwickelte mithilfe von Illustratoren die ersten Darstellungen von Dinosauriern. Auf viele wirkte Cuviers Arbeit mehr wie die eines Thaumaturgen, eines Wundertäters, denn als Arbeit eines Taxidermisten, eines Tierpräparators. Er hauchte nicht nur diesen Kreaturen Leben ein, sondern ganzen Epochen. – »Ist Cuvier nicht der größte Poet unseres Jahrhunderts?«, schrieb Balzac später verzückt über ihn.
Unser unsterblicher Naturalist hat ganze Welten aus gebleichten Knochen geschaffen. Er nimmt ein Stück Gips und sagt zu uns: »Seht!« Und plötzlich verwandelt sich der Stein in ein Tier; Totes wird lebendig und eine andere Welt breitet sich vor unseren Augen aus.
Angeregt durch die neue, weit verbreitete Leidenschaft für die Erde des Altertums, entwickelten sich das Sammeln von Fossilien und die Paläontologie rasch zu einer europäischen Modeerscheinung des frühen 19. Jahrhunderts. Es schien, als ob nun täglich eine neue tote Spezies entdeckt würde. Es gab Fossiliensucher, eine aktive Untergruppe von Geologen, die mit Rucksack, Hammer und weichen Bürsten überall dorthin gingen, wo Fels frei lag: an die Küste – wie etwa zu den reichhaltigen Lagerstätten des Juras am Lyme Regis, aus denen die renommierte Fossiliensucherin Mary Anning einen Ichthyosaurus und Plesiosaurus freilegte – und in Bäche, Steinbrüche und Flussbetten sowie in die Berge. Sportlich ambitionierte Fossiliensucher kletterten an Klippen über die verschiedenen Schichten und Fältchen des Gesteins hinweg und beschrieben, wie sie sich dabei fühlten, wenn sie sich so schnell durch die Zeiten bewegten und mit einer einzigen Bewegung eine neue Epoche erreichten.
Viele fossile Lagerstätten wurden von den Sammlern geplündert – die viktorianische Vorliebe, Spezies auszurotten, wurde so fast auf bereits ausgestorbene Arten übertragen. Reiche Amateure füllten ganze Räume mit ihren Fundstücken und investierten für die kleineren Exponate in spezielle Fossilienschränke: hüfthohe Schränkchen mit Reihen von ausziehbaren, verglasten Schubladen, die unter der Glasscheibe in Dutzende von streichholzschachtelgroßen Fächern unterteilt waren. In jedem dieser kleinen und sorgfältig beschriebenen Fächer lag ein Fossil: der Zahn eines Haies etwa oder der zarte Abdruck eines Farns auf einem Schieferplättchen. Kleine Friedhöfe dieser Art waren damals in Mode und standen in vielen wohlhabenden Häusern. Und die Leute kamen, um durch die Scheiben auf diese Relikte vergangener Welten zu schauen, dabei über ihre Sterblichkeit nachzudenken und über das unsägliche Alter der Erde nachzusinnen.
Diese aufflammende Begeisterung für Fossilien ist für unsere Untersuchung in doppelter Hinsicht von Bedeutung. Zum einen, weil sie die Faszination der Menschen des 19. Jahrhunderts für die vergangenen Erdzeitalter nur noch verstärkte. Fossilien seien »uralte Denkmäler der Natur, […] geschrieben in einer lebendigen Sprache«, hatte Charles Lyell völlig zu Recht in seinen Principles festgestellt, und die Paläontologie lehrte die Menschen genau wie die Geologie, wie man eine Landschaft als Geschichtsbuch liest und was sie über die Vergangenheit erzählt. Die Geologie war in der Tat während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Populärwissenschaft schlechthin. 1861 stellte die Königin von England sogar einen königlichen Mineralogen am Hof an. Geologischer Tourismus wurde zu einer wachsenden Einkommensquelle. Jene, die um 1860 vorhatten, sich auf eine geologische Reise zu begeben, konnten aus einer ganzen Reihe von Seminaren auswählen, die sie in Gesteinskunde unterrichten würde. Denjenigen, die eine persönliche Anleitung bevorzugten, bot Professor William Turl in der Green Street in London gemäß seiner Zeitungsannonce eine »individuelle Schulung für Touristen, sodass sie genügend Wissen erwerben können, um alle normalen Bestandteile der kristallinen und vulkanischen Gesteine identifizieren zu können, auf die man in den europäischen Bergen stößt«.
Die zweite wichtige Bedeutung dieser Begeisterung für Fossilien war, dass er Tausende dazu ermutigte, hinaus in die Natur zu gehen und somit eine aktive Annäherung an Felsen und Gestein förderte. In der Tat lag der Ursprung der westlichen Geologie in den Bergen und das Bergsteigen hing stets mit der Geologie zusammen. Viele der ersten Pioniere unter den Geologen wie Horace Bénédicte de Saussure oder der Schotte James David Forbes waren zugleich Pioniere unter den Bergsteigern.** Saussures vierbändiges Werk Voyages dans les Alpes (1779–1796) war sowohl ein grundlegendes Geologiebuch als auch eine der ersten Reisebeschreibungen der Wildnis. Als 1807 die Geological Society of London gegründet wurde, waren sich deren Mitglieder durchaus darüber im Klaren, dass die Auswirkungen ihrer Wissenschaft gegen die religiösen Überzeugungen der damaligen Zeit antraten. Sie wollten weder für komische Käuze noch für Bilderstürmer gehalten werden und stilisierten sich schließlich zu »Rittern des Hammers«, zu ritterlichen Männern der Wissenschaft, die auf der Suche nach Wissen in die Wildnis aufbrechen. Robert Bakewell bemerkte in seiner Introduction to Geology (1813), es sei eine »zusätzliche Empfehlung für das Studium der Geologie, dass deren Jünger dabei alpine Regionen erforschen«. Wie als Beweis dafür zeigt die erste Ausgabe der Introduction auf der zweiten Buchseite ein Bild von Bakewell, wie er glücklich zwischen den Basaltsäulen auf dem Gipfel des Cadair Idris in Wales sitzt. Die Geologie brachte den Menschen des frühen 19. Jahrhunderts nicht nur die Beschäftigung mit alten Knochen und Steinen, sondern auch eine gesundheitsfördernde Betätigung im Freien und eine romantische Sensibilität. Doch damit nicht genug, wurde die Geologie von vielen als eine Form von Geisterbeschwörung verstanden, die eine magische Reise in die Vergangenheit ermöglichte, wo man, wie es ein »Ritter des Hammers« einmal ausdrückte, auf Wunder stieß, die phänomenaler waren, als Erfundenes es je sein kann. Nach den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts, als sich die Grundzüge der klassischen Geologie in Europa und Amerika verbreiteten, wurde immer mehr Menschen bewusst, dass die Berge einen Ort darstellten, an dem man sich in den Archiven der Erde umsehen konnte – im ›Großen Buch der Steine‹, wie man es damals nannte.
Ich hatte als Junge zwei Bücher über Steine. Das eine war ein schmales Taschenbuch, ein Führer über Gesteinsarten und Kristalle, mit Beschreibungen und Fotos von Hunderten verschiedener Steine, deren klingende Namen ich vor mich hinmurmelte, bis ich sie gelernt hatte: roter und grüner Serpentin, Malachit, Basalt, Flurspat, Obsidian, Rauchquarz, Amethyst. Stundenlang suchte ich die schottische Küste ab. Nicht etwa, um dort Überbleibsel der Flut aufzuspüren – etwa eine einzelne Flip-Flop-Sandale von einem vorbeifahrenden Passagierschiff, den neonfarbenen Schwimmkörper eines Treibnetzes oder die vulkanisierte Leiche einer Qualle, obwohl das zweifellos wunderbare Fundstücke waren. Ich war dort wegen der Steine, mit denen die Strände übersät waren. Während ich mit dem Führer in der Hand knirschenden Schrittes über dieses geologische Potpourri ging, stürzte ich mich auf einen Stein nach dem anderen, sammelte sie und stopfte sie in meine Schultertragetasche aus Leinen, wo sie mit einem dumpfen oder quietschenden Geräusch aneinanderstießen. Das war wie freie Auswahl im feinsten Süßigkeitengeschäft der Welt: Ich konnte nie ganz glauben, dass ich die Steine mitnehmen durfte. Ich schleppte sie heim, legte sie in Behälter auf dem Fenstersims und sorgte mit Wasser dafür, dass sie glänzten und angenehm glatt waren.
Ich liebte die Farben der Steine und wie sie sich anfühlten – die großen flachen, die so schön warm waren, in die Hand passten wie ein Diskus und blaue oder rote Ringe hatten, die sich vom rauchgrauen Hintergrund abhoben. Oder die schweren Graniteier, die über Epochen hinweg von der Massage des Ozeans glatt geschmirgelt worden waren. Oder die Feuersteine, die aussahen wie Edelsteine, so transparent waren wie dunkles Bienenwachs und in die man so tief hineinschauen konnte wie in ein Hologramm. Aber was mich wirklich faszinierte, während ich mehr über Geologie las, war die Erkenntnis, dass jeder Stein seine eigene Geschichte hat, eine Biografie, die über mehrere Zeitalter zurückreicht. Ich war auf seltsame Weise stolz darauf, dass sich mein Leben mit jedem dieser unfassbar alten Objekte gekreuzt hatte, und dass sie wegen mir nun auf dem Fenstersims lagen und nicht mehr am Strand. Gelegentlich nahm ich zwei Steine und schlug, den einen als Hammer nutzend, auf den anderen damit ein. Ein Aufschlag war zu hören, dann entstand ein Riss, ein orangefarbener Funken sprühte, und es roch nach zerborstenem Fels. Einen kurzen Moment lang war ich erfreut darüber, dass ich das geschafft hatte, was den geologischen Kräften in Billionen von Jahren nicht gelungen war.
Dann wanderte ich über die schottischen Hügel und durch die langen Glens der Cairngorms und suchte nach Mineralien. Meine Lieblingsschätze aus den Hügeln waren die von Flüssen rund geschliffenen Brocken von Rosenquarz mit ihrer kalkhaltigen rosa-weißen Tönung und ihrer weich schimmernden Brillanz. Ich schätzte auch den schottischen Granit, der mit seinem pinkfarbenen Feldspat und den dicken Quarz-Flecken aussah wie eine geologische Leberpastete. Ich las mehr über die Geologie und begann die Grammatik der schottischen Landschaft zu verstehen, die Art, wie ihre Hauptbestandteile miteinander zusammenhingen – und auch ihre Etymologie, wie sie entstanden ist. Und ich schätzte ihre Kalligrafie, die Versalien der Täler und Berge, die komplizierten Gravuren der Ströme und Bäche und die herrlichen Serifen der Gratlinien und Talböden.
Von allen Gipfeln oder Hängen der Berge, die ich mit meiner Familie bestiegen habe, nahm mein Vater einen Stein mit und trug ihn in seinem orangen Segeltuchrucksack hinab. Er gruppierte sie zu Dutzenden und legte einen Steingarten davon an. Ich erinnere mich an einen Haufen aus Gneisklumpen, an ein schwarzes Basaltkissen, und an eine etwa ein Meter lange Platte aus Silberglimmer, so glänzend wie die Haut eines Lachses, sowie an ein Stück schwarzes Vulkangestein, in das Dutzende Quarzkörnchen eingebettet waren. Der Schönste von allen war für mich ein abgerundeter Block aus gelb-weißem Quarz, der sich so weich und zart anfühlte wie dickflüssiger Rahm.
Trilobiten
Das andere Geologiebuch, das ich als Kind besaß, war der chauvinistische Boy’s Guide to Fossils, ein Fossilienführer für Jungen. Während eines Sommers, den ich in einem Häuschen nahe der schottischen Küste verbrachte, war er mein ständiger Begleiter. Oben zwischen den Felsnasen der Klippen, wo die Sedimente mit ihren abgerundeten Kanten lagen, sammelten mein siebenjähriger Bruder und ich, der ich zwei Jahre älter bin, Belemniten, versteinerte Schalen eines tintenfischähnlichen Kopffüßlers. Sie waren spitz und hart wie Patronenhülsen. Wir suchten die Strandschicht nach Trilobiten, den Urkrebsen, ab. Ein hoffnungsloses Unterfangen wie ich heute weiß. Wir holten mit dem Messer Steinklumpen aus den Klippen und schlugen sie mit dem Hammer auf. Wir wanderten hinauf zu den Seen in den Hügeln des Hinterlands und zogen mit unseren kleinen Angeln und winzigen Fliegen Forellen aus dem Wasser: kleine, dunkle Fische, gerade mal so lang wie eine Hand, die in meiner neuerdings stark gewachsenen Fantasie aber mindestens eine Milliarde Jahre alt waren – also eher Quastenflosser denn Forellen. Abgesehen von den Belemniten fanden wir aber keine richtigen Fossilien mehr in diesem Jahr. Weder Ammoniten noch einen Ichthyosaurier. Und ganz bestimmt keinen Archaeopteryx oder gar gigantische prähistorische Haie. Unsere Erfolglosigkeit hielt mich jedoch nicht davon ab zu träumen, den Schädel eines Plesiosaurus aus einer weichen Kalkschicht zu ziehen oder in Sibirien über den Permafrost zu wandern, mit dem Zeh gegen die Spitze eines Stoßzahns zu stoßen und im Eis ein Mammut zu entdecken, das mich ängstlich von unten anstarrt.
Zwei Sommer nach diesen Ferien in Schottland reiste unsere Familie durch die Nationalparks der amerikanischen Wüstenstaaten. In Utah sahen wir die Felswände des Zion- und die Bögen des Arches-Nationalparks sowie die rosafarbenen Obelisken des Bryce Canyons, die links und rechts des Tals aufgereiht dastanden wie barocke Raketen. Ich glaube, dass es in der Nähe des Zion-Nationalparks war, wo wir an einer Tankstelle am Straßenrand hielten, um unseren großen amerikanischen Wagen mit Benzin zu füllen. Auf einer Seite des geschotterten Vorplatzes sah ich einen Mann mit einer Schirmmütze. Er saß auf einem Stuhl hinter einer Kreissäge, die auf einem Gestell befestigt war. Zu seiner Linken war eine Pyramide von rohen Steinbrocken aufeinander gehäuft wie ein Berg von Orangen. Wir gingen hinüber zu diesem Mann und ein Gespräch entwickelte sich zwischen ihm und meinem Vater. »Nimm dir einen Stein«, sagte mein Vater, als er sich zu mir umdrehte. Der Mann stand auf und schaute mir zu, während ich den Steinhaufen untersuchte. Ich fragte mich, ob das vielleicht Dracheneier waren. Ich wog einen der Steine in meiner Hand. Er fühlte sich weniger schwer an, als ich erwartet hatte, und flüsterte meiner Mutter zu, dass er leicht sei.
»Das ist ein gutes Zeichen«, sagte der Mann, nahm meinen Stein, setzte sich wieder auf den Stuhl und stellte ein Bein rechts und das andere links des Sägeblatts. »Leicht bedeutet, dass er innen Platz hat. Nimm ihn.«
Er machte die Säge an, ihre silbergrauen Zähne schienen sich zunächst in die eine, dann in die andere Richtung zu drehen und verschwammen dann zu einer einzigen unbeweglichen Schneide. Der Motor der Säge blies in rhythmischen Stößen blauen Rauch in die Luft. »Pass auf«, rief mir mein Vater über den Lärm der Säge hinweg zu. Ich fragte mich, was geschehen würde, wenn die Säge in den Schoß des Mannes fiele. Mit einem Griff senkte der Mann das Sägeblatt langsam zu meinem Felsei, das er in einer Halterung fixiert hatte. Es dauerte etwa eine Minute, bis sich die Säge kreischend durch den Stein gearbeitet hatte. Als sie durch war, machte der Mann die Säge aus und hob das Sägeblatt hoch. Der Stein fiel von der Halterung hinab in eine Decke, die unter der Säge lag und brach auseinander wie ein halbierter Apfel. Er trocknete die beiden Teile mit einem gelben Handtuch und streckte sie mir entgegen. »Du hattest Glück«, sagte er langsam. »Du hast eine gute Wahl getroffen, eine Geode. Die meisten Leute haben nicht so viel Glück wie du.« Ich hielt in jeder Hand eine Hälfte und betrachtete sie. Jede war innen hohl wie eine Höhle und an den Wänden der beiden Höhlen befanden sich unzählige blaue Kristallzähnchen. Als wir wegfuhren und die Kieselsplitter gegen das Chassis des Wagens spritzten, setzte ich die beiden Hälften wieder zu einem rauen Felsbrocken zusammen, zog sie dann erneut auseinander und war immer wieder überrascht von dem, was ich da sah.
Zwischen 1810 und 1870 wurde die Skala der »tiefen Zeit« konstruiert und beschriftet. Sie wird jedem geläufig sein, der je ein Geologiebuch aufgeschlagen hat, und die Litanei ist so wohlklingend wie der Wetterbericht für die Schifffahrt: Präkambrium. Kambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertiär, Quartär … Die geballte Macht der Sprache, die sogar mächtiger ist als die geophysikalischen Kräfte, die sie beschreibt, wurde für die geologische Vergangenheit verwendet und somit hunderte Millionen von Jahren ohne jegliche Anstrengung in einige Buchstaben zusammengepackt. Zunächst war die Geologie zwar ein Spätentwickler unter den Wissenschaften, während des 19. Jahrhunderts ging es aber erstaunlich rasch voran, indem die Zeit immer weiter rückwärts aufgerollt, benannt und etikettiert wurde. Die Zahl der populärwissenschaftlichen Geologiebücher nahm stark zu und das lesende Publikum verstand immer mehr, was die Lyriker unter den Geologen als »die Symphonie der Erde« bezeichneten – das sich wiederholende Muster von Hebung und Erosion, das Berge und Meere sowie Senken und Massive entstehen ließ. Unzählige Artikel über die Geologie und deren Erkenntnisse wurden in ganz Europa und in Amerika in Zeitschriften veröffentlicht. Jeder wurde in die Geheimnisse der Erdgeschichte eingeweiht.
»Der Wind und der Regen haben Bilderbücher geschrieben für diese Generation«, schrieb Charles Dickens 1851 für seine Zeitschrift Household Words,
Bilderbücher, aus denen sie lernen kann wie Regen entsteht, wie es zu Flut und Ebbe kommt und wie große Tiere, die längst ausgestorben sind, in uralten Zeiten auf die zerklüfteten Flanken der Felsen kamen. Je mehr wir über die Natur in all ihren Bereichen wissen, desto größer ist der Nutzen, den sie uns bietet.
So wie die Vorstellungskraft im 19. Jahrhundert durch die weite Spanne der Zeit, welche die Geologie zum Vorschein brachte, angeregt wurde, so wurde sie auch vom Konzept der geophysikalischen Kraft entfacht – jener unfassbaren Kraft, die erforderlich ist, um Sandstein zu kneten wie Teig, um Bäume in schimmernde Kohleflöze zu verwandeln und um Meerestiere in Marmorblöcke zu quetschen. Die Romantik hatte das kollektive Nervensystem des 19. Jahrhunderts darauf eingestimmt, den Exzess zu schätzen, und die vererbte Lust am Grandiosen und Gigantischen erklärt zum Teil den Enthusiasmus, mit dem die Geologie aufgenommen wurde.
In der Mitte des Jahrhunderts hatte John Ruskin viel über Geologie gelesen und begann nun seinerseits auf brillante Art über das in Zeitlupe verlaufende Drama der Gebirgsbildung zu schreiben. Die Veröffentlichung von Ruskins Old Mountain Beauty von 1856 war wie das Erscheinen von Lyells Principles im Jahre 1830 ein bedeutender Moment in der europäischen Landschaftsgeschichte. »Berge sind der Anfang und das Ende aller Naturlandschaften«, erklärte Ruskin am Anfang, und er duldete im gesamten Buch keine Kritik an dieser Feststellung. Lyell war ein Lehrer, Ruskin ein Dramaturg. Die Landschaft selbst lieferte, seinem Verständnis nach, die Geschichten ihrer Entstehung. Während er über die Natur des Granits mit seinem Gemisch aus Mineralien und Farben nachsann, träumte Ruskin von der Gewalt, die seiner Entstehung zugrunde lag: »Die verschiedenen Atome haben alle verschiedene Formen, Charaktere und Pflichten, wurden aber untrennbar miteinander verbunden durch einen feurigen oder taufenden Prozess, der sie alle gereinigt hat.« Beim Basalt erkannte er, dass dieser während eines Stadiums seiner Entstehung »die verflüssigende und ausdehnende Kraft des unterirdischen Feuers« besaß. Durch die Optik von Ruskins Prosa betrachtet, wurde die Geologie zum Krieg oder zur Apokalypse. Der Blick vom Gipfel eines Berges wurde zum Panoramablick über ein Schlachtfeld, auf dem sich feindliche Armeen von Fels, Stein und Eis epochenlang mit unglaublicher Langsamkeit und unvorstellbaren Kräften bekämpft hatten. Wenn man das liest, was Ruskin über Felsen geschrieben hat, dann wird man an die Mittel erinnert, die an ihrer Erschaffung beteiligt waren.
Zwischen 1820 und 1880 entstand auch in Amerika eine Dynastie von Landschaftskünstlern, die von den dramatischen Naturlandschaften der Vereinigten Staaten inspiriert wurden, darunter vor allem Frederick Edwin Church. Obwohl diese Künstler eindeutig vom britischen Triumvirat aus John Ruskin, William Turner und John Martin beeinflusst waren, so waren sie doch auch erfüllt vom typisch amerikanischen Wunsch, in der Darstellung der Landschaft ihrer Nation sowohl Ehrfurcht als auch Stolz auszudrücken, um das von Gott auserwählte Land zu ehren. Zu diesem Zweck erstellten sie riesige Gemälde von der amerikanischen Wildnis, oft in grellen Farben – die roten Fels-Zitadellen der Wüstenstaaten, die gebirgigen Thronsäle der Anden, die lodernden Himmel und spiegelnden Seen der Rockies oder die sprühende Großartigkeit der Niagara-Fälle. Ihre gigantischen Bilder betonten die Schwächlichkeit und Vergänglichkeit des Menschen. Oft kann man in einer Ecke der Gemälde ein oder zwei winzige Menschen erkennen, die von den wuchtigen Landschaftsporträts überragt werden. Diese Künstler waren außerdem auch in Botanik und Geologie versiert. Einige ihrer Bilder enthielten so viele landschaftliche Details, dass die Betrachter bei der ersten Ausstellung mit Operngläsern ausgerüstet wurden, damit sie die außergewöhnliche geologische Korrektheit des Gemäldes erkennen konnten – eine Erinnerung daran, wie eng verbunden die Geologie und die Darstellung der Berge waren.
Ein Ölgemälde ist ein geeignetes Medium, um die Entwicklung der Geologie wiederzugeben, da die Ölfarben quasi Landschaften in sich tragen aufgrund der Mineralien, aus denen sie bestehen. Ölfarben entstanden im 15. Jahrhundert als flämische Maler, darunter vor allem die Gebrüder van Eyck, versuchten, Leinsamenöl mit verschiedenen natürlichen Pigmenten zu vermischen. Dabei stellten sie fest, dass sie eine Substanz geschaffen hatten, die nicht nur kräftigere Farben erzeugte, sondern auch bezüglich der Trocknungsdauer besser war als die traditionelle Temperafarbe aus Ei. Viele der Pigmente, die sie mit Ölen vermischten, waren mineralischen Ursprungs. Ungebrannte Steinkohle wurde vor allem von den flämischen und holländischen Malern des 17. Jahrhunderts benutzt, um Schatten auf der Haut wiederzugeben. Schwarze Kreide und Kohle wurden für die Herstellung brauner Tinte verwendet. Die hellen Blautöne, die beispielsweise Claude Lorrain oder Nicolas Poussin verwendeten, um die Berge tief im Hintergrund darzustellen, entstanden aus Kupferkarbonaten oder Silberverbindungen. Der spezielle »schäumende« Effekt, auf den die holländischen Meister so stolz waren in ihren Darstellungen des Himmels, weil sie so auf hervorragende Weise die Konsistenz von Zirruswolken nachahmen konnten, wurde durch die Verwendung von pulverisiertem Glas und Asche hervorgerufen. Sinopia, rotes Eisenoxid, wurde benutzt, um Gesichtern und Bekleidung rötliche Töne zu verleihen oder für die ersten Skizzen eines Freskos auf Gips. Die Geologie ist also eng verbunden mit der Geschichte der Malerei. In den Ölgemälden der Landschaftsmalerei wurde die Erde dazu gezwungen, sich selbst wiederzugeben.
Eine noch engere Übereinstimmung zwischen Medium und Botschaft findet man in den »Suiseki-Steinen«, die in der T’ang und Sung-Dynastie von China populär waren. 700 Jahre bevor die Romantik die westliche Wahrnehmung von Bergen und Wildnis revolutionierte, huldigten chinesische und japanische Künstler bereits den spirituellen Qualitäten wilder Landschaften. Kuo Hsi, ein gefeierter chinesischer Maler und Verfasser von Essays aus dem 11. Jahrhundert, vertrat in seinem Essay über Landschaftsmalerei die Auffassung, dass eine wilde Landschaft »die Natur eines Menschen nährt«. Er schrieb, dass
die menschliche Natur das Getöse der staubigen Welt und die Abgeschlossenheit der menschlichen Behausungen für gewöhnlich verabscheut, während die menschliche Natur im Gegensatz dazu Dunstschleier, Nebel und die eindringlichen Stimmungen der Berge sucht.
Diese ehrwürdige östliche Wertschätzung der Wildnis erklärt die Beliebtheit der Suisekis, einzelner Steine, die durch die Kraft von Wind, Wasser und Frost in komplizierte, dynamische Formen umgewandelt wurden. Man fand sie in Höhlen, Flussläufen und Bergflanken, und sie wurden auf kleine Holzpodeste gestellt. Die Steine, die von Schülern auf dem Schreibtisch oder im Arbeitszimmer aufbewahrt wurden, so wie wir das von Briefbeschwerern kennen, wurden geschätzt, weil sie die Geschichte und die an ihrer Entstehung beteiligten Kräfte darstellten. Jedes Detail an der Oberfläche eines solchen Steines, jede Furche, Nase, Luftblase, Kante oder Perforation war ein Bericht über Äonen von Jahren. Jeder Stein war ein kleiner Kosmos im Taschenformat. Suisekis waren keine Metaphern für eine Landschaft, sie waren Landschaften. Viele dieser Steine sind noch erhalten und können in Museen besichtigt werden. Wenn man einen davon ganz aus der Nähe und lang genug betrachtet, dann verliert man jeden Maßstab, und dann können die Kringel, die Vertiefungen, die Hügel und die Täler, die die Natur in ihnen verewigt hat, groß genug wirken, um sie zu durchwandern.
Man muss hinzufügen, dass nicht jeder von den Fortschritten der Geologie im 19. Jahrhundert begeistert war. Das Gefühl, dass die Geologie genauso wie die anderen Wissenschaften auf bestimmteWeise die Menschheit verdrängt hatte, war weit verbreitet. Die wissenschaftlichen Untersuchungen und Methoden hatten auf gnadenlose und unwiderlegbare Art bewiesen, dass der Mensch nicht mehr und nicht weniger von Bedeutung ist als jede andere Anhäufung von Materie. Die Geologie hatte die Weltanschauung der Renaissance, dass der Mensch das Maß aller Dinge sei, untergraben. Die trostlose Ausdehnung der Zeit, die von der Geologie ans Licht gebracht wurde, war der überzeugendste Beweis dafür, dass die Menschheit bedeutungslos ist. Wer nachvollziehen konnte, dass Berge abgetragen werden und zu Staub zerfallen, musste zwangsläufig auch die Ungewissheit und Vergeblichkeit des menschlichen Strebens spüren. »Die Hügel sind Schatten«, schrieb der englische Lyriker Alfred Tennyson (1809–1892) in seinem Klagelied In Memoriam: »und sie fließen / von Form zu Form, und nichts bleibt. / Der feste Boden löst sich auf wie Dunst / Wie Wolken formt er sich selbst und geht dahin«. Und was das »Fließen von Form zu Form« betrifft: Die Philologie zeigte, dass die Sprache ebenso unaufhörlich Veränderungen unterworfen ist wie alles andere. Nicht einmal Worte bedeuteten noch das, was sie früher bedeuteten. Nichts war beständiger als der Wechsel.
Im Großen und Ganzen wurden die Enthüllungen der Geologie jedoch eher für inspirierend als für bedrohlich gehalten. Genauso gut wie Ruskin die Kräfte der Erde beschreiben konnte, brachte er sein Publikum dazu, eine Landschaft sowohl dahingehend zu interpretieren, was ihr fehlte als auch dahingehend, was vorhanden war – beispielsweise, an was es den Hügeln fehlte durch katastrophale Umwälzungen oder durch die unaufhörliche Arbeit der Erosion. In Ruskins Schriften erhob sich ein Berg nach dem anderen vor dem inneren Auge einer Fantasie, die alle Eventualitäten von »könnte gewesen sein« und »war einmal« in Betracht zog. Wie Shakespeares wunderbarer Prospero rief Ruskin die Geister der Vergangenheit und ließ sie über die Linien des Horizontes und über die Grate des Tages hinweg aufsteigen. Er lehrte, dass die wilde Natur lediglich eine Ruine von etwas viel Erstaunlicherem war – der Verfallszustand dessen, was er »die ersten großartigen Formen, die einst geschaffen wurden« nannte. Sogar das Matterhorn, dessen nach oben strebende Pracht Bewunderer zu Tausenden ins Tal von Zermatt zog, bezeichnete Ruskin als Skulptur, die von den wütenden Kräften der Erde aus einem einzigen Block gemeißelt und zurechtgeschnitten war. So wie John Muir später in den Vereinigten Staaten hat Ruskin seine zahlreichen Leser gelehrt, dass die geologische Vergangenheit überall erkennbar ist, wenn man nur weiß, wie man schauen muss.
John Ruskin glaubte auch, dass sich die Berge bewegen. Dies war vielleicht sogar sein bedeutendster Beitrag dazu, welche Vorstellung von den Bergen wir haben. Bevor er Old Mountain Beauty veröffentlichte, hatte Ruskin Jahre damit verbracht, die niedrigeren Wege der Alpen abzuwandern. Er fertigte dabei Skizzen an, malte, beobachtete und meditierte. Er zog damals die Schlussfolgerung, dass die willkürlich erscheinende Gezacktheit der Berggrate eine Illusion sei. Wenn man die Berge mit der gebotenen Sorgfalt und Geduld betrachtete, dann konnte man erkennen, dass die Grundform ihres Aufbaus in der Tat die Krümmung war und nicht der Winkel, wie man bei oberflächlicher Beobachtung meinen konnte. Berge waren von Natur aus gekrümmt, und Gebirgsketten geformt und angeordnet wie Wellen. »Die stille Welle der Blauen Berge« waren Wellen aus Gestein, keine Wellen aus Wasser.
Mer de Glace mit den Grandes Jorasses, Blick nach Südsüdosten
Laut Ruskin neigten Bergketten wie hydraulische Wellen dazu, sich zu bewegen. Sie waren einst von kolossalen Kräften aufgerichtet worden und wurden noch immer von ihnen bewegt. Dass man sich die Bewegung der Berge nur vorstellen, sie aber nicht beobachten konnte, war, wie James Hutton festgestellt hatte, nur eine Folge der kurzen Lebensdauer des Menschen. Berge waren nicht statisch, sondern flüssig: Steine fielen herab, und Regenwasser floss über ihre Flanken hinab. Für Ruskin war diese ewige Bewegung der Berge der Anfang und das Ende jeder Naturlandschaft. Er schrieb:
Diese trostlosen und bedrohlichen Ketten schwarzer Berge, zu denen die Menschen in allen Zeitaltern der Welt hoch geschaut haben mit Abneigung oder Entsetzen und vor denen sie zurückschreckten, als wären sie verfolgt vom ewigen Bild des Todes, sind in Wirklichkeit viel größere und wohltätigere Quellen des Lebens und des Glücks als die strahlende Fruchtbarkeit der Ebene […].
Ruskins Intuition, dass sich Berge bewegten, wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts unerwartet nachgewiesen, als sich der letzte signifikante Wandel der westlichen Vorstellungen von der Vergangenheit der Berge vollzog. Im Januar 1912 stand bei einem unter Geowissenschaftlern mittlerweile legendären Vorfall ein Deutscher namens Alfred Wegener (1880–1930) vor einem Auditorium bedeutender Geologen in Frankfurt auf und erzählte ihnen, dass sich die Kontinente bewegten. Er erklärte, dass insbesondere die Kontinente, die in erster Linie aus granitartigen Gesteinen bestehen, auf dem dichteren Basalt des Ozeanbodens schwimmen würden wie Ölflecken auf dem Wasser. Wegener informierte seine zunehmend ungläubigen Zuhörer darüber, dass 300 Millionen Jahre zuvor die gesamten Landmassen der Welt Teil eines einzigen Superkontinents gewesen wären, eines Urkontinents, den er Pangaea nannte, was »alles Land« bedeutet. Durch die Spaltkraft verschiedener geologischer Kräfte sei Pangaea in viele Teile auseinandergerissen worden. Diese Teile wären später auseinandergedriftet und über den Basalt in ihre gegenwärtigen Positionen gerutscht. Wegener argumentierte, dass die Gebirge der Welt nicht durch die Abkühlung und dadurch bedingte Faltenbildung der Erdkruste entstanden sind – eine Theorie, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder in Mode gekommen war –, sondern durch die Kollision zweier Kontinente, die sich ineinander schoben, was einen Buckel rund um die Knautschzone zur Folge hatte. So war der der tief liegende Ural, der das europäische Russland von Sibirien trennt, laut Wegener das Produkt einer früheren Kollision zwischen zwei beweglichen Kontinenten, die vor so langer Zeit geschah, dass die Folgen der Gebirgsbildung in der Knautschzone zum Großteil durch Erosion bereits wieder abgeflacht wurde.
Sehen Sie sich zum Beweis den Globus an, sagte Wegener. Schauen Sie sich die Verteilung der Kontinente an. Wenn Sie diese ein wenig bewegen, dann passen sie ineinander wie die Teile eines Puzzles. Schieben Sie Südamerika auf Afrika zu, dann schließt dessen östliche Küste perfekt an die Umrisse des westlichen Afrikas an. Und wenn Sie Zentralamerika um die Elfenbeinküste legen und Nordamerika an den oberen Teil Afrikas, dann haben Sie schon den halben Superkontinent. Er erklärte, dass dieser Trick auch bei Indiens westlicher Küstenregion funktioniert, die sich eng ans spitze Horn von Afrika schmiegt, genauso wie Madagaskar perfekt zurückrutscht ins einst abgerissene Stück an der Südostküste von Afrika.
Alfred Wegeners Rekonstruktionen der Erdkarte nach der Verschiebungstheorie für drei Zeiten
Wegener hatte noch besseres Beweismaterial, um seine Behauptung zu stützen. Er hatte jahrelang in den umfangreichen Fossilienarchiven der Universität Marburg gearbeitet und dabei festgestellt, dass genau an jenen Zonen in den Felsschichten identische Fossilienarten gefunden worden waren, von denen er annahm, dass sie einst zusammengehört hatten: Beispielsweise stimmten an der Westküste Afrikas und der Ostküste Brasiliens die Kohleablagerungen und die Fossilien überein. »Es ist so, wie wenn wir die zerrissenen Teile einer Zeitung zusammensetzen, indem wir ihre Ecken aneinanderfügen und dann prüfen, ob die Zeilenübergänge stimmen«, schrieb er. »Wenn sie das tun, dann bleibt nur der Schluss, dass die Teile tatsächlich so zusammengehörten.«
Wegener war nicht der Erste, der darauf hinwies, dass die Kontinente miteinander verbunden waren. Im 17. Jahrhundert hatte sich der Kartograf Ortelius schon Notizen über das Puzzlespiel der Kontinente gemacht und angenommen, dass sie einmal miteinander verbunden gewesen waren, durch heftige Überflutungen und Erdbeben, dann aber auseinandergebrochen wären. Man glaubte ihm nicht. Auch der unendlich scharfsinnige Francis Bacon erwähnte 1620 in seinem Novum Organum, dass die Kontinente zusammenpassen würden, »wie wenn sie aus der gleichen Form ausgeschnitten worden wären«, scheint aber nicht weiter darüber nachgedacht zu haben. Und 1858 schrieb ein Franko-Amerikaner namens Antonio Snider-Pellegrini eine ganze Abhandlung, Creation and its Mysteries Revealed, um aufzuzeigen wie die Kontinente einst zusammengefügt waren.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es jedoch kein Umfeld für einen so radikalen Wandel der geologischen Theorie, schlicht keine andere wissenschaftliche Erkenntnis, die zu dieser Theorie passte. Ein Grundpfeiler der Geologie des 19. Jahrhunderts waren nämlich die enormen Landbrücken, von denen man glaubte, dass sie einst die Kontinente der Welt miteinander verbunden haben, dann aber ins Meer gestürzt wären. Diese Landbrücken erklärten die Existenz derselben Spezies auf verschiedenen Landmassen, was viel plausibler erschien als Kontinente, die sich bewegten.
Daher argumentierte Wegener 1912 gegen den Kern der damals vorherrschenden Weisheit. Wenn seine Theorie stimmte, dann würde er damit viele der grundlegenden Annahmen der Geologie des 19. Jahrhunderts für nichtig erklären. Noch schlimmer war, dass Wegener ein fachfremder Eindringling war, der von seinem Hauptforschungsgebiet, der Meteorologie, in die Jagdgründe der Geologen gewechselt hatte. Wegener war ursprünglich ein Pionier der Wetterballon-Forschung und ein Grönlandspezialist, der mehrere erfolgreiche und eine fatale Forschungs-Expedition in die Arktis geleitet hatte. Wie konnte ein Wettermann annehmen, er könne mit einem einzigen Streich die komplexen und wunderbaren Gebäude der Geologie des 19. Jahrhunderts zum Einsturz bringen?
Wie bei Burnet viele Jahre zuvor formierte sich gegen Wegeners Theorie sofort eine wortgewaltige Opposition: »Was für ein verdammter Blödsinn«, formulierte der Präsident der Amerikanischen Philosophischen Gesellschaft eloquent. Aber Wegener war ein stoischer Visionär und blieb unbewegt angesichts dieser frühen Feindseligkeiten. Im Jahre 1915 veröffentlichte er Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, eine sorgfältige Erklärung seiner Theorie und damit gewissermaßen eine ebenso apokalyptische Umdeutung der Vorstellungen der Erdgeschichte wie zuvor Burnets The Sacred Theory of the Earth oder Huttons The Theory of the Earth.
Zwischen 1915 und 1929 überarbeitete Wegener seine Entstehung der Kontinente und Ozeane dreimal, um neue Erkenntnisse der Geologie mit einzubeziehen. Vom geologischen Establishment wurde er nach wie vor ignoriert.
Im Jahre 1930 leitete er eine weitere Grönland-Expedition. Drei Tage nach seinem 50. Geburtstag gerieten er und sein Team in einen Schneesturm, in dem die Temperaturen bis auf minus 50 Grad Celsius fielen. Wegener wurde im Whiteout von seinen Kameraden getrennt und erfror einsam in der arktischen Wildnis. Seine Kollegen fanden seinen Körper als der Sturm nachließ. Sie bestatteten ihn in einem Mausoleum aus Eisblöcken, auf dessen Spitze sie ein sechs Meter hohes Eisenkreuz setzten. Innerhalb von einem Jahr war das Gebilde samt Inhalt im Inneren des Gletschers, auf dem es stand, verschwunden – eine Form von Begräbnis, die zweifellos Wegeners Zustimmung gefunden hätte.
Erst beim Aufkommen der sogenannten Neuen Geologie in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts wurde erkannt, dass Wegener zumindest zur Hälfte recht gehabt hatte. Als die Fortschritte der Tauchkugel-Technik eine systematischere Untersuchung des Meeresbodens ermöglichten, wurde entdeckt, dass sich die Kontinente tatsächlich bewegt hatten und von einem riesigen Ur-Kontinent weggedriftet waren. Aber die Kontinente waren nicht, wie Wegener dachte, unabhängige Einheiten, die auf einem Basaltmeer drifteten wie Eisberge im Wasser. Es stellte sich nämlich heraus, dass sich die Oberfläche des Globus aus rund zwanzig Krustensegmenten oder Platten zusammensetzt. Die Kontinente waren nur jene Teile der Platten, die hoch genug waren, aus dem Meer herauszuragen.
Diese Platten bekamen von den Neuen Geologen ihre Namen. Es gab fortan die Afrikanische Platte, die Cocosplatte, die Nordamerikanische Platte, die Antarktische Platte, die Juan-de-Fuca-Platte, die Australische Platte, die Arabische Platte und die unzerbrechlich wirkenden China-Platten. Diese Platten bewegen sich miteinander, indem sie von Konvektionsströmen oder von Zellen im halbflüssigen Mantel der Erde angetrieben und von ihrem Eigengewicht geschoben werden. Wo ihre Kanten unter dem Meer aufeinandertreffen, bildet sich entweder ein mittelozeanischer Rücken oder eine Subduktionszone. Beim mittelozeanischen Rücken werden die Kanten der beiden Platten durch ständige Aktivität im Mantel auseinandergeschoben. Magma steigt in diesem neu gebildeten Graben auf, kühlt ab und bildet Meeresbodenbasalt. Die mittelozeanischen Rücken sind höher als der sie umgebende Meeresboden, vergleichbar in etwa mit der Naht auf einem Kricketball. Im Gegensatz dazu bildet sich eine Subduktionszone, wenn die Kanten zweier Platten aufeinandertreffen und die weniger elastische Platte unter die andere geschoben wird. Dort wird das Gestein der untergeschobenen Platte in den Erdmantel hineingedrückt, wo es schmilzt, in flüssiger Form blubbernd aufsteigt und extrem heiße Risse in der Kruste verursacht. Diese Subduktionszonen bilden die ozeanischen Gräben: den Aleutengraben, den Javagraben, den Marianengraben. Am Grunde dieser Gräben – der Marianengraben ist tiefer als der Mount Everest hoch ist – herrscht ein so gewaltiger atmosphärischer Druck, dass ein menschlicher Körper dort sofort auf die Größe einer Dose komprimiert werden würde.
Alfred Wegeners Grab, Grönland
Die meisten Gebirgsmassive der Welt entstanden durch Berührungen und Kollisionen der Kontinentalplatten. Die Alpen wurden beispielsweise dadurch hochgeschoben, dass die Adriatische Platte, auf der Italien sitzt, in die Eurasische Platte geschoben wurde. Die ältesten Berge sind jetzt diejenigen, die am niedrigsten sind, da die Erosion Zeit gehabt hat, sie zu verkleinern. Der stumpfe, abgerubbelte Rücken des Urals spricht beispielsweise für ein hohes Alter, genauso wie die runden Formen der Cairngorms in Schottland. Vielleicht ist es eine Überraschung, dass das Himalaja-Gebirge zu den jüngsten gehört. Es bildete sich erst vor 65 Millionen von Jahren, als die Indische Platte nordwärts zog und langsam an die Eurasische Platte stieß, sich darunter schob und sie dann 8800 Meter in die Höhe drückte. Ein Jüngling verglichen mit den altehrwürdigen Massiven ist der Himalaja mit scharfen, punktartigen Kämmen anstatt der kahlen und abgetragenen Glatzen der älteren Gebirge. Und wie ein Jüngling wächst er noch. Der Everest, der erst vor etwa 200 000 Jahren zum höchsten Berg der Welt wurde, schießt um etwa 5 frühreife Millimeter pro Jahr in die Höhe. In einer Million Jahren, was in geologischen Begriffen einem Lidschlag gleichkommt, könnte der Berg seine Höhe also fast verdoppelt haben. Das wird natürlich nicht geschehen, da die Schwerkraft ein solches Gebilde nicht tolerieren würde. Irgendetwas muss nachgeben: Entweder würde der Berg unter seinem Eigengewicht zusammenbrechen oder in einem der gewaltigen Erdbeben zerbersten, die alle paar Jahrhunderte im Himalaja wüten.
Viele Jahre bin ich nun schon in die Berge gegangen und habe mich über die Tiefe der Zeit gewundert. Als ich an einem sonnigen Tag einmal den glimmerreichen Ben Lawers in Schottland bestieg, fand ich auf halbem Weg ein flaches, viereckiges Stück Sedimentgestein, dessen Rückseite von Moos und Gras überwuchert war. Als ich zurücktrat und den Block von der Seite betrachtete, konnte ich sehen, dass er aus zahllosen dünnen Schichten aus grauem Fels bestand, von denen keine dicker war als ein Blatt. Ich berechnete, dass jede Schicht 10 000 Jahren entsprach. Hier waren also hundert Jahrhunderte in 3 Millimeter dickem Gestein komprimiert worden.
Zwischen zwei dieser grauen Schichten entdeckte ich eine zarte silberne. Ich hackte mit der Schaufel meines Wanderpickels in den Stein und versuchte die Schichten auseinander zu stemmen. Der Block brach auf, und es gelang mir, meine Finger unter die schwere Deckelschicht zu schieben. Ich hob sie an, und da glänzte zwischen zwei grauen Schichten eine etwa 1 Quadratmeter große Schicht silbernen Glimmers in der Sonne – wahrscheinlich das erste Sonnenlicht, das seit Millionen von Jahren darauf fiel. Es war wie das Öffnen einer Schatzkiste, die bis zum Rand mit Silber gefüllt ist oder wie das Öffnen eines Buches, in dem man einen Spiegel findet, oder wie das Öffnen einer Falltüre, um darunter einen Abgrund der Zeit zu entdecken, der so schwindelerregend tief ist, dass man Kopf voraus hätte hineinfallen können.
*Wie der britische Journalist und Autor Simon Winchester vor Kurzem feststellte, glauben laut einer Umfrage von 1991 noch immer rund 100 Millionen Amerikaner daran, dass Gott irgendwann in den letzten 10 000 Jahren den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Erde etwa 5 Milliarden Jahre alt ist und dass die ersten Menschen vor rund 2 Millionen Jahren in Erscheinung getreten sind.
**Die Geologie blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein eine treibende Kraft beim Bergsteigen – die ersten drei Everest-Expeditionen von 1921, 1922 und 1924 wurden zum Teil als wissenschaftliche Expeditionen finanziert und zielten darauf ab, geologische und botanische Studienergebnisse aus der Everest-Region zurückzubringen.