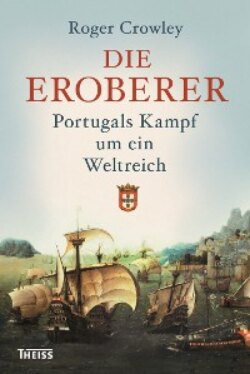Читать книгу Die Eroberer - Roger Crowley - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|49|3 Vasco da Gama Oktober 1495 – März 1498
ОглавлениеDer neue König hatte ein messianisches Schicksal geerbt, das weit in das portugiesische Königshaus Avis zurückreichte. Der am Tag des Fronleichnamsfestes geborene und auf den erlauchten Namen Emmanuel, „Gott mit uns“, getaufte Thronfolger sprach seiner Krönung geradezu mystische Bedeutung zu. Er war 26 Jahre alt, hatte ein rundes Gesicht und überproportional lange Arme, die bis zu den Knien reichten, so dass er ein bisschen wie ein Affe aussah. Außergewöhnliche Umstände waren erforderlich gewesen, damit er letztlich den Thron bestieg, nicht zuletzt der mysteriöse Reitunfall, bei dem Johanns Sohn Afonso umgekommen war, und der Mord an seinem Bruder Diogo von Johanns eigener Hand. Emmanuel wertete seine Königsherrschaft als Zeichen, dass er von Gott auserwählt sei.
In den letzten Jahren des Jahrhunderts, mit dem Nahen des 1500. Jahrestages der Geburt Christi, breiteten sich in ganz Europa apokalyptische Strömungen aus, und insbesondere auf der Iberischen Halbinsel, wo die Vertreibung sowohl der Muslime als auch der Juden aus Spanien als ein Zeichen gewertet worden war. Derart gestimmt, glaubte Manuel und wurde in seinem Glauben auch darin bestärkt, dass er dazu ausersehen war, Außergewöhnliches zu vollbringen: zur Ausrottung des Islam und der weltweiten Verbreitung des Christentums unter einem Alleinherrscher.
„Unter allen westlichen Fürsten Europas“, schrieb der Seefahrer Duarte Pacheco Pereira, „wollte Gott lediglich Eure Hoheit auswählen“.1 Und dass gerade das winzige Portugal zu großen Taten fähig sei, wurde wiederum mit einem Bibelvers gerechtfertigt: „Aber viele, die da sind die Ersten, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein.“2
|50|
König Manuel I. als Weltherrscher mit dem Wahlspruch: „[Wir wenden uns] zu Gott im Himmel, aber zu Dir auf Erden“. Zu seiner Linken prangt das königliche Wappen mit den fünf Schilden und zur Rechten die Armillarsphäre, das mystische Symbol für die portugiesische Welterforschung.
Der Indien-Plan, der in den unruhigen Jahren der ausgehenden Herrschaft Johanns in den Hintergrund getreten war, wurde zum Hauptventil für diese Träume. Manuel glaubte, er habe den Mantel seines Großonkels Heinrich, „des Seefahrers“, geerbt. Seit dem Fall Konstantinopels 1453 fühlte sich das christliche Europa immer stärker bedrängt. Die islamische Welt umgehen, sich mit dem Priesterkönig Johannes und den gerüchteweise existierenden christlichen Gemeinden Indiens verbünden, die Kontrolle über den Gewürzhandel übernehmen und den Reichtum vernichten, der den Mamluken in Kairo so große Macht verlieh – von den ersten Monaten seiner Herrschaft an existierte im Keim bereits eine überaus ambitionierte geostrategische Vision, die im Laufe der Zeit die Portugiesen um die ganze Welt jagen sollte. Wenn sie auch im Geiste eines Kreuzzugs entworfen wurde, so hatte sie durchaus eine materielle Dimension: Manuel wollte nicht nur den Mamluken das Handelsmonopol entreißen, |51|sondern auch die Venezianer als Handelszentrum für die Luxusgüter des Orients ablösen. Das Unterfangen hatte gleichzeitig einen imperialen, religiösen und wirtschaftlichen Aspekt. In diesem Geist fing er an, die Expedition zusammenzustellen, die Indien erreichen sollte – einen in Anbetracht fehlender genauer Kenntnisse damals nur vage beschriebenen Raum, der in der europäischen Vorstellung den ganzen Indischen Ozean und alle Gebiete, wo Gewürze wachsen mochten, umfasste.
Die Idee wurde keineswegs von allen gebilligt. Als Manuel im Dezember 1495, wenige Wochen nach seiner Krönung, eine Ratsversammlung einberief, stieß er auf heftigen Widerstand seitens des Adels, der unter König Johann heftig gelitten hatte und der in einer so fernen Unternehmung wenig Ruhm und große Gefahren sah, verglichen mit der leichten Beute eines Kreuzzuges in Marokko. Manuel erwies sich während seiner Herrschaft von Zeit zu Zeit als wankelmütig und unentschlossen, aber er konnte auch gebieterisch auftreten. Er bezeichnete es als eine ererbte Pflicht, die Entdeckungen weiterzuverfolgen, und berief sich auf seine göttliche Mission, um alle Einwände vom Tisch zu wischen.
Und indem er all jenen, die Schwierigkeiten voraussahen, falls Indien entdeckt werden sollte, den vorrangigen Grund nannte, dass Gott, in dessen Hände er die Angelegenheit lege, die Mittel für das Wohlergehen des Königreichs [Portugal] beschaffen werde, beschloss der König schließlich, die Entdeckung fortzuführen; und als er sich später in Estremoz aufhielt, ernannte er Vasco da Gama, einen Edelmann seines Hofstaats, zum Oberkapitän [der Titel des Oberbefehlshabers] der Schiffe, die er dorthin senden würde.3
Allem Anschein nach war Vasco da Gama ursprünglich nur zweite Wahl für dieses Abenteuer. Manuel forderte zuerst dessen älteren Bruder Paulo auf, der wegen seiner angeschlagenen Gesundheit ablehnte, aber einwilligte, unter Vascos Kommando dennoch an der Reise teilzunehmen. Vasco da Gama, „ein unverheirateter Mann und in einem Alter, das ihn dazu befähigte, die Prüfungen einer solchen Reise zu überstehen“,4 war damals bereits über dreißig. Der Beginn seiner Berufskarriere, sowie seine Erfahrung und die Gründe für die Wahl sind noch heute mehr oder weniger im Dunkeln. Vor |52|dem Jahr 1496 wird sein Name nur in wenigen Quellen genannt; seine seefahrerischen Kenntnisse sind weitgehend unbekannt. Er stammte aus dem niederen Adel des Hafenortes Sines, südlich von Lissabon, und dürfte eine gewisse Erfahrung als Seeräuber vor der marokkanischen Küste gehabt haben. Was immer er war oder gewesen war, wurde in der Folge, ähnlich wie das Leben des Christoph Kolumbus’, vom Mythos überdeckt. Offenbar war er aufbrausend. Zum Zeitpunkt seiner Ernennung lief gegen ihn noch eine Anklage wegen Schlägerei. Sein starrsinniger Charakter sollte auf der bevorstehenden Reise voll zur Entfaltung kommen: unversöhnlich und getränkt von einem kreuzfahrerischen Hass auf den Islam, ausdauernd und unempfindlich gegen die Entbehrungen eines Lebens auf hoher See, aber ohne jede Geduld für diplomatische Höflichkeiten. Er wurde beschrieben als „wagemutig in der Tat, streng in seinen Befehlen und sehr furchterregend in seinem Zorn“.5 Gama war vermutlich eher für das Kommandieren der Männer und für |53|das Verhandeln mit den unbekannten Königen des Orients auserwählt worden als für das Führen der Schiffe.
Vasco da Gama
In den 1490er-Jahren hatte die Erkundung der afrikanischen Küste Lissabon in eine Stadt voller Geschäftigkeit und Erwartungen verwandelt. Das Entladen exotischer Produkte auf den sanft ansteigenden Ufern des Tejo (Gewürze, Sklaven, Papageien, Zucker) schürte die Sehnsucht nach neuen Welten jenseits der Mole. Im Jahr 1500 waren schätzungsweise 15 Prozent der Bevölkerung Schwarze aus Guinea – in der Stadt lebten mehr Sklaven als in irgendeiner anderen Stadt Europas. Lissabon war exotisch, dynamisch, farbenprächtig und zielstrebig, „größer als Nürnberg und viel reicher an Bevölkerung“, befand der deutsche Universalgelehrte Hieronymus Münzer, der im Jahr 1494 hierherkam.6 Die Stadt war eine Vorreiterin, was neue Ideen zur Kosmographie und Navigation, zur Gestalt der Welt und ihrer Abbildung auf Karten betraf. Nach der Vertreibung aus Spanien im Jahr 1492 bereicherte eine Welle jüdischer Einwanderer, darunter viele Gebildete und Unternehmer, das dynamische Treiben der Stadt. Auch wenn ihre willkommene Aufnahme nicht von langer Dauer war, bescherten sie dem Land einen bemerkenswerten Fundus an Wissen. Unter den Flüchtlingen waren der jüdische Astronom und Mathematiker Abraham Zacuto, dessen Erfindung eines Astrolabiums für die Seefahrt und von Planetentafeln zur Bestimmung der Position von Himmelskörpern die Navigation auf hoher See revolutionieren sollten.
Für Münzer war Lissabon eine Stadt voller Wunder. Hier sah er eine beeindruckende Synagoge mit zehn riesigen Kerzenleuchtern mit jeweils 50 oder 60 Kerzen; den Leib eines Krokodils, der als Trophäe im Chor einer Kirche hing; den Schnabel eines Pelikans und die gewaltige gezackte Säge eines Schwertfisches; mysteriöse, übergroße Bambusrohre von den Kanarischen Inseln (die auch Kolumbus inspiziert und als Beweis für Ländereien im fernen Westen gewertet hatte). Er bekam auch „eine riesige und außerordentlich gut angefertigte goldene Karte“ zu sehen, „mit einem Durchmesser von 14 Handbreit“7 – es handelte sich um Fra Mauros Karte aus dem Jahr 1459, die auf der Burg der Stadt ausgestellt wurde. Er traf sich mit Seefahrern, die ihm haarsträubende Geschichten vom Überlebenskampf und Entkommen zu erzählen wussten, und sprach mit |54|einer Gruppe deutscher Kanonengießer und Artilleristen, die beim König hohes Ansehen genossen.
Die Fülle an Produkten, die im Hafen zum Verkauf angeboten wurden, verblüffte ihn: Berge von Hafer, Walnüssen, Zitronen und Mandeln, riesige Mengen an Sardinen und Thunfisch zum Export in den ganzen Mittelmeerraum. Er besuchte auch die Büros, die den Import von Waren aus dieser neuen Welt beaufsichtigten, wo er einen Blick auf den Handel aus Afrika erhaschte: gefärbte Stoffe aus Tunis, Teppiche, Metallbecken, Kupferkessel, bunte Glasperlen und von der Küste Guineas große Packen scharfen Pfeffers, „von dem man uns eine Menge gab“, die Stoßzähne von Elefanten und schwarze Sklaven.8
Was Münzer zu sehen bekam, war nicht nur der Einblick in eine exotische Welt jenseits der Erdkrümmung, sondern die industrielle Infrastruktur des Schiffbaus, die seefahrerische Voraussicht und die Einrichtungen der Arsenale, die Portugal seine Effizienz auf See verschafften. Er sah
eine gigantische Werkstatt mit vielen Essen, wo sie Anker, Kolubrinen [Kanonen] und dergleichen herstellten, und alles, was man für die hohe See braucht. Es standen so viele geschwärzte Arbeiter rund um die Essen, dass wir meinten, wir befänden uns unter den Zyklopen in der Höhle des Vulcanus. Danach sahen wir in vier weiteren Gebäuden unzählige sehr große und ausgezeichnete Kolubrinen, und außerdem Katapulte, Wurfspieße, Schilde, Brustharnische, Mörser, Handfeuerwaffen, Bogen, Lanzen – alle wohlgefertigt und in großer Menge vorhanden … und was für riesige Mengen an Blei, Kupfer, Salpeter und Schwefel!9
Die Fähigkeit, hochwertige Kanonen aus Bronze herzustellen, und die effektiven Einsatztechniken auf See waren vermutlich von dem tatkräftigen König Johann entwickelt worden, zu dessen Forscherdrang und weitreichenden Interessen auch praktische Experimente mit der Schiffsartillerie zählten. Er hatte den Einsatz großer Bombarden auf Karavellen verfügt und führte Testschüsse aus, um die wirkungsvollsten Einschläge auf den Decks der Zielschiffe herauszufinden. Der Trick bestand darin, die Geschütze horizontal auf Wasserhöhe abzufeuern; wenn sie höher abgefeuert wurden, war |55|die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kugeln über das Ziel hinausschossen. In manchen Fällen, wenn die Geschütze tief genug unten im Bug aufgestellt wurden, gelang es, die Kanonenkugeln von der Wasseroberfläche abprallen zu lassen und so ihre Reichweite zu erhöhen. Die Portugiesen entwickelten ferner sogenannte berços, leichte Hinterladerkanonen aus Bronze, die auf den Booten der Schiffe transportiert werden konnten und gegenüber den herkömmlichen Vorderladern den Vorteil einer höheren Feuergeschwindigkeit hatten – bis zu 20 Schuss in der Stunde. Die Überlegenheit der Artillerie, die durch die Anwerbung deutscher und flämischer Kanonengießer noch gesteigert wurde, sollte sich bei den kommenden Ereignissen als entscheidender Vorteil erweisen.
Die geplante Expedition hatte eine eher bescheidene Größe, war aber sorgfältig vorbereitet. Sie stützte sich auf einen jahrzehntelangen Zuwachs an Wissen. Das Geschick und Wissen, das man im Laufe der Jahre im Schiffbau, in der Navigation und der Vorsorge für Atlantikreisen erworben hatte, floss nunmehr in den Bau zweier robuster Schiffe ein; und Manuel konnte dabei auf die praktische Erfahrung einer talentierten Handwerkergeneration zurückgreifen. Die Karavelle war der Akteur und das Werkzeug aller Entdeckungsreisen. Sie war ideal für das Erkunden tropischer Flüsse und für das Vorankämpfen entlang der afrikanischen Küste gegen den Wind, aber sie war furchtbar unbequem auf langen Reisen über schwere See. Die Umrundung des Kaps durch Dias hatte die Grenzen ihrer Möglichkeiten aufgezeigt: Die Besatzung wollte auf keinen Fall noch weiter.
Bartolomeu Dias wurde beauftragt, den Bau zweier robuster Karacken zu entwerfen und zu beaufsichtigen – jener Segelschiffe, die die Portugiesen nau nannten –, welche die Reise anführen sollten. Die Aufgabe war klar: Die Schiffe mussten so widerstandsfähig sein, dass sie der tosenden See des südlichen Atlantiks standhielten; so geräumig, dass sie die Besatzungen besser als die Decks einer Karavelle unterbringen und versorgen konnten; und dabei so klein, dass sie in Untiefen und Häfen manövrierfähig blieben. Die Schiffe, die am Ufer im Bau waren, ihr Skelett von hölzernen Gerüsten eingekeilt, hatten einen rundlichen Rumpf, hohe Seitenwände, ein hohes Achterdeck und drei Masten; dennoch hatten sie einen geringen |56|Tiefgang und waren nicht überdimensioniert. Sie waren etwa 24 Meter lang und hatten ein Gewicht von 100 bis 120 Tonnen. Mit ihren Rahsegeln waren sie bei Gegenwind nicht so manövrierfähig wie andere Schiffstypen; zum Ausgleich dafür hielten sie besser dem unberechenbaren Tosen unbekannter Meere stand. Ein Versorgungsschiff, das in der Nähe des Kaps aufgegeben werden sollte, wurde ebenfalls gebaut.
Der Bau von Karacken in der Werft von Lissabon. Eine Karavelle liegt gestrandet in der Bildmitte auf der rechten Bildhälfte.
Offenbar wurden weder beim Bau noch bei der Ausstattung dieser Schiffe oder der Anwerbung und Bezahlung der Besatzungen Kosten gescheut. „Sie wurden von hervorragenden Meistern und Handwerkern gebaut, mit starken Nägeln und Holz“, erinnerte sich der Seefahrer Duarte Pacheco Pereira:
… jedes Schiff hatte drei Sätze von Segeln und Ankern und drei oder vier Mal so viel Takelage wie üblich. Die Dauben der Fässer und Tonnen für Wein, Wasser, Essig und Öl wurden mit vielen Eisenringen verstärkt. Die |57|Vorräte an Brot, Wein, Mehl, Fleisch, Gemüse, Arzneimitteln und auch an Waffen und Munition waren ebenfalls mehr als das, was für so eine Reise gebraucht wurde. Die besten und erfahrensten Piloten und Seefahrer in Portugal wurden auf diese Reise ausgesandt, und sie erhielten, neben anderen Vergünstigungen, einen höheren Sold als Seeleute in irgendeinem anderen Land. Auf den wenigen Schiffen dieser Expedition wurde so viel Geld ausgegeben, dass ich hier nicht näher ins Detail gehen möchte, weil ich fürchte, dass man mir nicht glauben werde.10
Die Fässer, die über die Landungsbrücken an den Ufern der Werft gerollt wurden, enthielten ausreichend Proviant für drei Jahre. Gama erhielt 2000 Goldcrusados für das Unternehmen, eine gewaltige Summe; und sein Bruder Paulo ebenso viel. Die Heuer der Seeleute wurde erhöht, und ein Teil davon wurde im Voraus ausgezahlt, um ihre Familien zu unterstützen. Womöglich verbarg sich dahinter die Erkenntnis, dass viele von ihnen nicht zurückkehren würden. Kein Detail wurde ausgelassen. Die Schiffe hatten die besten damals erhältlichen Navigationshilfen an Bord: Lote ebenso wie Stundengläser, Astrolabien und Karten auf dem neuesten Stand – möglicherweise auch Kopien der unlängst gedruckten Planetentafeln von Abraham Zacuto, um nach dem Sonnenstand den Breitengrad zu bestimmen. Zwanzig Geschütze wurden an Bord gehievt, große Bombarden ebenso wie berços, die kleineren Hinterladerkanonen, sowie ein reicher Vorrat an Schießpulver, das gegen die Meeresluft dicht versiegelt wurde, und Unmengen an Kanonenkugeln. Die erfahrenen Handwerker (Zimmerleute, Kalfaterer, Schmiede und Küfer), die für die Sicherheit der Schiffe sorgen sollten, wurden paarweise angeheuert, für den Fall, dass einer von ihnen umkam. Es gab auch Dolmetscher, die Bantu und Arabisch sprachen, Musiker, um die Seemannslieder zu begleiten und die Fanfaren zu blasen; Kanoniere, Soldaten und gelernte Matrosen, unterstützt vom sogenannten „Deckfutter“. Dazu zählten afrikanische Sklaven, Waisen, konvertierte Juden und verurteilte Sträflinge, die man für schwere Hilfsarbeiten angeheuert hatte: das Einholen der Taue, das Lichten der Anker und Reffen der Segel, das Leerpumpen der Bilgen. Insbesondere auf die Verurteilten konnte man gegebenenfalls ohne Weiteres verzichten; man hatte sie eigens zu dem Zweck aus dem |58|Gefängnis entlassen, um sie für erste Erkundungen an nicht kartierten und potenziell feindlichen Küsten an Land zu setzen. Geistliche reisten ebenfalls mit, um die Gebete anzuführen und die Seelen der Toten mit einem christlichen Begräbnis dem Meer anzuvertrauen.
Insgesamt hatte die Expedition vier Schiffe: die beiden Karacken, getauft auf die Namen der Erzengel São Gabriel und São Rafael, nach einem Schwur, den König Johann vor seinem Tod abgelegt hatte; mit ihnen fuhr eine Karavelle, die Bérrio, und das Versorgungsschiff mit 200 Tonnen. Gama verließ sich auf Seeleute, die er kannte, und Verwandte, denen er trauen konnte, um die Wahrscheinlichkeit einer Meuterei in einer sorgfältig vorbereiteten Expedition möglichst gering zu halten. Dazu zählten sein Bruder Paulo, der Kapitän der Rafael, und zwei Vettern Gamas. Seine Piloten und befehlshabenden Seeleute waren die erfahrensten ihrer Zeit. Unter ihnen fanden sich Pêro de Alenquer und Nicholas Coelho, die zusammen mit Bartolomeu Dias das Kap umrundet hatten, sowie Dias’ Bruder Diogo. Ein anderer Pilot, Pêro Escobar, dessen Name bei den Yellala-Fällen eingehauen ist, war unter Diogo Cão Lotse gewesen. Auch Bartolomeu Dias sollte die Expedition auf einem Schiff mit Kurs nach Guinea während der ersten Etappe der Reise begleiten.
Die Ausgaben für diesen bescheidenen, spekulativen, aber äußerst kostspieligen Vorstoß ins Unbekannte wurden mit Hilfe des Goldes von der Küste Guineas gedeckt – sowie einem Glücksfall: Im Jahr 1496 war die Vertreibung der Juden, die sich weigerten, zum Christentum überzutreten, der Brautpreis für Manuels Heirat mit Prinzessin Isabella von Spanien gewesen. Deren Güter und Besitz verschafften dem Königshaus nunmehr unerwartete Mittel.
Mitte Sommer des Jahres 1497 war die Expedition endlich bereit; auf den Segeln prangte das rote Kreuz des Ordens der Christusritter, die Fässer waren an Bord gerollt, die schwere Artillerie in Position gebracht, die Besatzungen komplettiert. Die Flottille lief vom Stapel und ging bei Restelo, einem Fischerdorf flussabwärts von Lissabon, vor Anker. In der drückenden Hitze hatte sich Manuel auf |59|sein Bergschloss bei Montemor-o-Novo, rund hundert Kilometer landeinwärts, zurückgezogen, und dorthin begaben sich Vasco da Gama und seine Kapitäne, um ihre letzten Anweisungen und den rituellen Segen vom König zu empfangen. Auf Knien wurde Gama feierlich das Oberkommando über die Expedition verliehen und ein Seidenbanner überreicht, das ebenfalls mit dem Kreuz des Christusordens verziert war. Er erhielt seine Instruktionen: christliche Könige in Indien in einer Stadt namens Calicut zu suchen, denen er einen auf Arabisch und Portugiesisch geschriebenen Brief überreichen sollte, und einen Handel mit Gewürzen und „den orientalischen Schätzen“ in die Wege zu leiten, „die von Schriftstellern der Antike so hoch gerühmt worden waren, aber solche Großmächte wie Venedig, Genua und Florenz hervorgebracht hatten“.11 Ein weiterer Brief war an den Priesterkönig Johannes adressiert. Die Mission war heilig und zugleich säkular, Obertöne eines Kreuzzugs vermischten sich mit wirtschaftlicher Rivalität.
Das Dorf Restelo am Ufer des Tejo außerhalb der Stadtmauern war seit der Zeit Heinrichs des Seefahrers der traditionelle Ausgangspunkt für die portugiesischen Seereisen; das sanft ansteigende Ufer bot eine breite Bühne für die religiösen Zeremonien und emotionalen Rituale der Abreise: „ein Ort der Tränen für jene, die gehen, der Freude für jene, die zurückkehren“.12 Auf dem darüberliegenden Hügel, der den weiten Bogen des Tejo überragte, der nach Westen ins offene Meer führte, stand Heinrichs Kapelle, gewidmet der Santa Maria de Belém, der „Heiligen Jungfrau von Bethlehem“, eigens zu dem Zweck, abreisenden Seeleuten die Sakramente zu spenden. Die ganze Besatzung, zwischen 148 und 166 Mann, verbrachte dort die heiße Sommernacht vor der Abreise mit Gebet und Wachen.
8. Juli 1497: Ein Samstag. Der Beginn der Mission, das „so viele Jahrhunderte lang verborgene“ Indien wiederzuentdecken.13 Der Tag, der der Heiligen Jungfrau Maria gewidmet war, war von den Astrologen des Hofes als verheißungsvoll für die Abfahrt auserkoren worden. Einen Monat zuvor hatte der Papst König Manuel dauerhafte |61|Besitzrechte auf Ländereien gewährt, die von den Ungläubigen erobert wurden und auf die keine anderen christlichen Könige bereits Anspruch erhoben. Die Menschen strömten in Scharen aus Lissabon, um ihre Freunde und Verwandten zu verabschieden. Gama führte seine Männer in einer frommen Prozession, die von den Priestern und Mönchen des Christusordens inszeniert wurde, aus der Kapelle zum Strand. Die Seefahrer trugen ärmellose Tuniken und hielten brennende Kerzen in der Hand. Die Priester gingen hinter ihnen und stimmten einen Wechselgesang an, und die Menschen fielen zur Antwort ein. Als die Prozession den Rand des Wassers erreichte, verstummte die Menge. Alle knieten nieder, um die Beichte abzulegen und die Absolution gemäß der päpstlichen Bulle zu empfangen, die seinerzeit Heinrich für jene erhalten hatte, die „bei dieser Entdeckung und Eroberung“ sterben sollten.14 Laut João de Barros weinten „bei dieser Zeremonie alle“.15
Rekonstruktion der São Gabriel
Anschließend wurden die Männer in kleinen Booten zu den Schiffen übergesetzt. Die Segel wurden unter dem rhythmischen Schlagen der Zimbeln gesetzt, die Schiffe legten ab, und das königliche Banner wehte auf Gamas Flaggschiff, der Gabriel. Dazu reckten die Seeleute ihre Fäuste in den Himmel und skandierten die traditionellen Rufe – „Sichere Fahrt!“ Das Ertönen der Pfeifen der Flottille wurde vom Wind verweht, die beiden Karacken an der Spitze, mit den wunderschön bemalten Galionsfiguren der Erzengel Gabriel und Rafael unter dem Bugspriet. Die Menschen wateten ins Wasser, um einen letzten Blick auf ihre Geliebten jenseits der immer größer werdenden Kluft zu erhaschen. „Und während die eine Gruppe zurück aufs Land blickte, die andere aufs Meer, aber alle gleichermaßen von ihren Tränen und dem Gedanken an die lange Reise vereinnahmt waren, blieben sie so stehen, bis die Schiffe fern vom Hafen waren.“16 Die Schiffe glitten den Tejo hinab, passierten die Mündung, wo sie zum ersten Mal die Strömung des Ozeans spürten.
Unterdessen schickte sich auf der Rafael ein Mann, dessen Identität nie eindeutig geklärt wurde, an, Notizen zu machen. Der anonyme Schreiber beginnt sein knappes Tagebuch, den einzigen Augenzeugenbericht für alle folgenden Ereignisse, mit einer abrupten Wendung:
|62|Im Namen Gottes des Herrn! Amen!
Im Jahr 1497 entsandte König Manuel, der erste dieses Namens in Portugal, vier Schiffe auf Entdeckungsfahrt und auf die Suche nach Gewürzen …
An einem Sonnabend, am 8. Juli 1497, verließen wir Rastello [Restelo]. Möge uns Gott der Herr eine gute Fahrt verleihen! Amen!17
Wenn ein Ziel, nämlich die Suche nach Gewürzen, klar war, so lässt doch das merkwürdigerweise intransitiv gebrauchte Verb descobrir, „entdecken“, das nicht durch ein Objekt näher bezeichnet wurde, darauf schließen, wie sehr dieses Unterfangen ein Sprung ins Ungewisse war.
Bei den günstigen Winden entlang der afrikanischen Küste kamen schon nach einer Woche die Kanarischen Inseln in Sicht. Mit Blick auf die zu erwartenden Wetterbedingungen hatte Gama Befehl erteilt, dass die Schiffe, falls sie getrennt werden sollten, sich auf den Kapverdischen Inseln, tausend Meilen weiter südlich, wieder treffen sollten. In der folgenden Nacht verirrte sich die Rafael im Nebel. Als der Nebel am nächsten Tag aufriss, war von den anderen Schiffen nichts zu sehen. Sie segelte weiter. Am 22. Juli, als die Rafael die verstreuten vorgelagerten Inseln der Kapverdischen Inseln erblickte und die anderen Schiffe in Sicht kamen, fehlte nunmehr die Gabriel mit ihrem Oberbefehlshaber. Niedergeschlagen saßen sie dort vier Tage lang in einer Flaute fest. Als die Gabriel am 26. Juli gesichtet wurde, brach sich in der ganzen Flotte die Erleichterung Bahn. „Am Abend konnten wir uns mit ihm verständigen und gaben unserer Freude durch viele Böllerschüsse und Trompetensignale Ausdruck.“18 Eine gewisse Nervosität kennzeichnete die ersten Tage der Expedition. Auf der Kapverdischen Insel Santiago blieben die Seefahrer eine Woche, reparierten Masten und luden Fleisch, Holz und so viel Wasser, wie sie in ihren Fässern lagern konnten, für die bevorstehende Ozeanreise an Bord.
„Donnerstag, den 3. August, verließen wir den Hafen in östlicher Richtung“, notierte der anonyme Schreiber routinemäßig.19 Dabei war die Flottille im Begriff, ein Manöver auszuführen, für das es keinen bekannten Präzedenzfall und nur äußerst vage Quellen gab. Rund 700 Meilen südlich der Kapverdischen Inseln, etwa sieben Breitengrade vom Äquator, drehten die Gabriel und die folgenden |63|Schiffe, statt den vertrauten Konturen der afrikanischen Küste in die Kalmenzone vor Guinea zu folgen, die Ruder nach Südwesten und fuhren in einem großen Bogen in die Mitte des Atlantiks. Das Land war verschwunden. Die Schiffe, die flott weiter ins Ungewisse segelten, wurden von der Weite des Ozeans geschluckt. Die Segel ächzten im salzigen Wind.
Gamas Kurs folgte der jeder Intuition widersprechenden Wahrheit, die Bartolomeu Dias neun Jahr zuvor erkannt hatte: dass man, um Afrika zu umrunden, in den Ozean hinauslaufen und westliche Winde einfangen musste, welche die Schiffe am Kap vorbeiführen würden. Aber der Bogen der Gabriel kam einer enormen Ausweitung des vorherigen Experiments gleich. Es liegt auf der Hand, dass portugiesische Seefahrer gegen Ende des Jahrhunderts wohl bereits eine klare Vorstellung von den Winden im Südatlantik hatten, aber wie sie dieses Wissen über den südwestlichen Quadranten des Meeres erwarben, ist bis heute unbekannt. Die Annahme, dass in dem Intervall seit Dias’ Rückkehr geheime Erkundungsfahrten durchgeführt worden waren, ist reine Spekulation; es muss andere Gründe dafür gegeben haben, dass die Portugiesen so zuversichtlich die Schiffe dem weiten Ozean anvertrauten, indem sie sich bei der Bestimmung der Position auf die Navigation nach dem Sonnenstand richteten. Wenn diese Aussicht extrem beängstigend war, so enthält das emotionslose Tagebuch doch keinerlei Hinweis darauf. Am 22. August erblickten sie Reiher-ähnliche Vögel, die nach Süd-Südosten flogen, „als wollten sie Land erreichen“,20 aber zu der Zeit befanden sie sich 800 Leguas, über 2000 Meilen, weit auf offener See. Mit Hilfe der Namenstage der Heiligen wahrten sie ein Gefühl für die verstreichende Zeit; ansonsten bestand ihre Welt aus dem endlosen Meer und Himmel, Sonne und Wind. Weitere zwei Monate vergingen, ehe der Tagebuchschreiber etwas erblickte, das er für Wert hielt zu dokumentieren und das darauf schließen ließ, dass sie nicht in einer endlosen Leere verloren waren: „Am Vorabend von St. Simon und Juda – es war ein Freitag, der 27. Oktober – sahen wir viele Wale.“21
Noch ehe die Piloten das Ruder nach Südwesten umgelegt hatten, bekamen die Schiffe die Naturgewalt des Meeres zu spüren. 600 Meilen südlich von Santiago brach auf der Gabriel die Rahe des Hauptsegels: |64|„Wir mussten zwei Tage und eine Nacht unter Focksegel und kleinem Hauptsegel lavieren.“22 Die Ausdauer der Besatzungen wurde mit Sicherheit bis zum Äußersten auf die Probe gestellt: vier Stunden Wache, vier Stunden Ruhe, Tag und Nacht, wobei die Zeit vom Stundenglas gemessen und von den Schiffsjungen verkündet wurde: „Wachablösung, die Zeit läuft.“23 Die ungelernten Arbeiten – das Auspumpen der Bilgen, das Reffen der Segel, Einholen von Tauen, Deck schrubben – waren Sache der Verurteilten und Enteigneten. Die Männer bekamen eine unausgewogene Kost aus Schiffszwieback, Fleisch, Öl und Essig, Bohnen und gesalzenem Fisch zu essen – dazu frischen Fisch, wenn es ihnen gelang, welchen zu fangen. Die Qualität der Lebensmittel wurde immer schlechter, als sich die Tage dahinzogen, der Zwieback wurmiger, die Ratten hungriger – obwohl es üblich war, dass Schiffe auch Katzen und manchmal Wiesel an Bord nahmen, um die Population der Nagetiere zumindest in Grenzen zu halten. Die vermutlich einzige warme Mahlzeit am Tag wurde, wenn die Bedingungen es zuließen, in einer Sandkiste gekocht. Nicht die Lebensmittel wurden knapp, sondern das Trinkwasser. Im Laufe der Reise wurde es immer fauliger und musste mit Essig gemischt werden. Als die Fässer sich leerten, wurden sie mit Salzwasser aufgefüllt, damit die Schiffe im Gleichgewicht blieben.
Die Obersten der Schiffe, die Kapitäne und Offiziere, die Abzeichen ihrer Ämter trugen (eine Pfeife an einer Goldkette, Umhänge aus schwarzem Samt), aßen und schliefen in ihren privaten Kabinen, die übrigen nach ihrem Status: erfahrene Matrosen im Vorderdeck, Soldaten unter der Brücke. Wenn es auch in den Kabinen nachts stank, so war es für die Verurteilten und Geächteten noch schlimmer. Auf Deck zitterten sie unter Ziegenfellen oder Wachstüchern, als die Schiffe südlich des Äquators in kältere Gefilde kamen. Alle schliefen auf Strohmatten in den vor Salz steif gewordenen Kleidern, die bei regnerischem Wetter nie trockneten. Die Wachstuchdecken erfüllten eine zusätzliche Funktion als Leichentuch, wenn man die Verstorbenen in die Tiefe werfen musste. Ihre Notdurft verrichteten die Männer in Eimern oder einfach über die Reling, je nach Seegang. Kein Mensch wusch sich. Die Tagesroutine wurde geprägt vom Aufrufen der Wache, den Mahlzeiten, notwendigen |65|Reparaturen und den üblichen Morgen- und Abendgebeten. Bei stürmischem Wetter waren die Seeleute für gewöhnlich in der Luft und hingen über einer tosenden See in der Takelage, richteten die Segel aus, holten sie ein oder setzten einige Meter Segeltuch und spürten wie Peitschenhiebe den Regen und den Wind. Wenn die Schiffe gut fuhren und die See ruhig war, gaben sich die Männer den Freizeitvergnügungen hin. Das Kartenspiel, das rasch zu Streit führen konnte, war ausdrücklich verboten. Die Männer angelten, holten ein wenig Schlaf nach, lasen (sofern sie es konnten), sangen und tanzten zur Flöte und Trommel oder hörten zu, wie der Priester aus dem Leben der Heiligen vorlas. Gelegentlich wurden zur Feier der Namenstage einiger Heiliger Prozessionen über das Deck veranstaltet, und die Messe wurde ohne Eucharistie abgehalten aus Angst, dass der Kelch umkippen und der Inhalt entweiht werden könnte. Die Aufgabe der Musiker war es, die Besatzung zu unterhalten und die Moral aufzurichten.
Die Männer waren immer ausgezehrter, durstig, litten unter Schlafmangel und waren von der Seekrankheit geschwächt. Wer das harte Leben an Bord eines Schiffes nicht gewohnt war, erlag der Ruhr und dem Fieber. Außerdem spürte die ganze Besatzung, fast unbemerkt, trotz des ganzen Trockenobstes, der Zwiebeln und Bohnen, die anfangs ihren Speiseplan bereichert hatten, bevor sie ungenießbar geworden waren, das schleichende, aber unaufhaltsame Fortschreiten der Seefahrerkrankheit. Ohne ausreichende Zufuhr von Vitamin C stellen sich nach 68 Tagen die ersten Symptome ein; die ersten Toten sind nach 84 Tagen zu beklagen; nach 111 Tagen rafft der Skorbut eine ganze Schiffsbesatzung dahin. Für Gamas Männer lief die Zeit.
Ungeachtet der Unbill der See – der heißen Tage am Äquator, der immer kälteren und wilderen Gewässer im Süden – legten die Schiffe täglich im Durchschnitt rund 45 Seemeilen zurück. Auf einem Breitengrad um 20 Grad Süd spürten die Steuermänner den Antrieb verschiedener Winde, drehten den Bug nach Südosten und jagten wiederum in Richtung Afrika, in der Hoffnung, das Kap zu umrunden. |66|Am Samstag, dem 4. November, nimmt der lakonische Tagebuchschreiber wiederum den Stift zur Hand, wobei er über die zurückliegende Reise kaum ein Wort verliert: „Sonnabend … hatten wir in einer Tiefe von 110 Faden Grund und um neun Uhr sichteten wir Land. Wir schlossen uns näher zusammen, und als wir unsere Galakleider angelegt hatten, begrüßten wir den Oberbefehlshaber mit Böllerschüssen und schmückten die Schiffe mit Fahnen und Standarten.“24 Selbst aus diesen knappen Worten wird spürbar, wie die aufgestaute Emotion sich Luft machte. Sie hatten inzwischen drei Monate lang, 93 Tage, kein Land gesehen, waren rund 4500 Meilen über das offene Meer gesegelt und hatten durchgehalten. Das war eine bemerkenswerte Großtat der Navigation. Kolumbus’ Überquerung des Atlantiks zu den Bahamas dauerte lediglich 37 Tage.
In Wirklichkeit befanden sich die Portugiesen noch vor dem Kap, sie gingen in einer weiten Bucht 125 Meilen nordwestlich davon an Land. Die Landung bot Gelegenheit für sorgfältige Reparaturen: das Säubern der Schiffe, Flicken der Segel und der Rahstangen, ferner für die Jagd nach Fleisch und das Aufnehmen von Wasser. Allem Anschein nach waren sie zum ersten Mal imstande, das Astrolabium aufzustellen, das auf dem schwankenden Deck eines Schiffes unbrauchbar war, und konnten den Breitengrad genau ablesen. Es kam zu angespannten Begegnungen mit Einheimischen, „dunkelbraunen“ Männern, laut dem Tagebuchschreiber, die überrascht feststellten, dass „ihre Hunde, deren sie viele haben, denen in Portugal [gleichen] und bellen wie diese“.25 Sie ergriffen einen Mann, brachten ihn auf das Schiff und gaben ihm zu essen. Doch die hiesige Sprache erwies sich als unverständlich für die Dolmetscher: „Sie sprechen, als hätten sie einen Schluckauf.“26 Es handelte sich um die Khoikhoi, ein Hirtenvolk im Südwesten Afrikas, das die Europäer später in einer Anspielung auf den Klang ihrer Sprache Hottentotten nennen sollten. Anfangs war die Kommunikation durchaus friedlich – der Tagebuchschreiber erwarb gar „eine von den Scheiden, die sie über dem Geschlechtsteil tragen“27 –, aber das Ganze endete mit einem Hinterhalt, in dem Vasco da Gama leicht von einem Speer verwundet wurde. „Dies alles geschah nur, weil wir diese Leute für ungefährlich hielten, unfähig einer Zornesregung, und deshalb unbewaffnet an Land gegangen waren.“28 |67|Womöglich war dies ein entscheidender Moment für die ganze Expedition. Künftig sollten sämtliche Landungen unter allen Vorsichtsmaßnahmen und schwer bewaffnet erfolgen. Die Portugiesen neigten seit dieser Begegnung dazu, bei der geringsten Provokation das Feuer zu eröffnen.
Es dauerte sechs Tage und mehrere Anläufe, bis die Schiffe sich bei stürmischem Wetter um das Kap der Guten Hoffnung herumkämpften. Als sie wiederum in der Bucht der Rinderherden – nunmehr umbenannt in St. Brás – landeten, wo Dias neun Jahre zuvor gewesen war, stellten sie demonstrativ ihre Macht zur Schau: Brustharnische, gespannte Armbrüste, Drehbassen in den Ruderbooten, um bei den Einheimischen, die gekommen waren, um sie neugierig zu betrachten, „den Eindruck zu erwecken, wir wollten ihnen etwas tun, obgleich wir gar nicht die Absicht hatten“.29 Dem gegenseitigen Unverständnis in diesen Begegnungen, das schon viele frühere Treffen entlang der westafrikanischen Küste geprägt hatte, standen faszinierende Momente der Humanität jenseits aller Barrieren von Kultur und Sprache gegenüber. Hier fingen die Portugiesen an, Waren aus dem Versorgungsschiff umzuladen, das sie anschließend am Strand verbrannten.
Am 2. Dezember kam eine große Zahl Einheimischer, etwa 200, zum Strand.
Sie brachten ungefähr ein Dutzend Ochsen und Kühe und vier oder fünf Schafe mit. Sobald wir sie erblickten, gingen wir an Land. Da begannen sie, auf vier oder fünf Flöten zu spielen; die einen bliesen hohe Töne, andere tiefe. Für Neger, die nicht sehr musikalisch sind, brachten sie eine ganz schöne Musik zustande. Dazu tanzten sie in ihrer Art. Der Oberbefehlshaber gab nun Befehl, die Trompeten zu blasen, und wir tanzten auf unseren Schiffen, der Oberbefehlshaber mitten unter uns.30
Afrikaner und Europäer waren vorübergehend durch Rhythmus und Melodie vereint, aber das gegenseitige Misstrauen blieb. Es endete wenige Tage später damit, dass die Portugiesen, die einen Hinterhalt fürchteten, von den Ruderbooten aus ihre berços abfeuerten, um die Hirten zu zerstreuen. Bei ihrem letzten Blick auf die Bucht, als sie weitersegelten, sahen sie, wie die Khoikhoi den Wappenpfeiler |68|und das Kreuz zerstörten, das sie soeben errichtet hatten. Um ihrem Ärger Luft zu machen, jagten die Schiffe mit ihren Kanonen im Vorüberfahren eine Kolonie Seehunde und Pinguine in die Luft.
Die Flottille zahlte einen hohen Preis dafür, dass sie das Kap nicht in einem großen Bogen umrundet hatte. Die Schiffe wurden zeitweilig durch einen Sturm getrennt; am 15. Dezember kämpften sie sich gegen die herrschende Strömung an Dias’ letztem Wappenpfeiler vorbei. Doch bis zum 20. waren sie wiederum dorthin zurückgeworfen worden. Hier hatten sich Dias’ Männer geweigert weiterzusegeln. Aber Gamas Schiffe wurden aus diesem Küstenlabyrinth durch einen mächtigen Rückenwind befreit, der sie rasch vorantrieb. „Hinfort gefiel es Gott in Seiner Güte, dass wir wieder vorwärts kamen. Wir wurden nicht mehr zurückgetrieben“, dokumentierte der Tagebuchschreiber voller Erleichterung. „Gebe der Himmel, dass es so bleiben möge.“31
Doch die mühsame Umrundung Afrikas hatte sowohl die Männer als auch die Schiffe arg mitgenommen. Der Großmast der Rafael brach unterhalb der Spitze; dann verlor sie einen Anker. Das Trinkwasser ging zur Neige. Pro Mann wurde nur noch ein Drittel Liter täglich ausgegeben, und ihr Durst wurde gewiss nicht dadurch gelindert, dass das Essen in Meerwasser gekocht wurde. Der Skorbut dezimierte allmählich die Besatzungen. Sie brauchten dringend die Ruhepause eines friedlichen Landgangs.
Am 11. Januar 1498 erreichten sie einen kleinen Fluss. Sofort merkten sie, dass sie eine andere Welt betreten hatten. Die Scharen hochgewachsener Menschen, die kamen, um sie zu begrüßen, glichen überhaupt nicht den Khoikhoi. Sie hatten keine Angst und empfingen sie gastfreundlich. Es handelte sich um Bantu-Stämme, mit denen die Dolmetscher kommunizieren konnten. Wasser wurde an Bord geholt, aber der Aufenthalt konnte nicht verlängert werden, weil der Wind günstig stand. Am 22. Januar erreichten sie eine flache, dicht bewaldete Küste und das Delta eines viel breiteren Stroms, in dem Krokodile und Flusspferde lauerten. „Schwarze und wohlgebaute“ Menschen kamen in Einbäumen heran, um sie anzuschauen und Handel zu treiben, auch wenn einige ihrer Besucher im Tagebuch als „sehr hochmütig“ beschrieben werden, weil „nichts, was man ihnen gab, von ihnen sonderlich geachtet wurde“.32
|69|Zu der Zeit war der Skorbut bereits weit fortgeschritten, und viele Männer der Besatzung waren in einem furchtbaren Zustand. Ihre Hände, Füße und Beine waren unförmig angeschwollen; ihr blutiges und vereitertes Zahnfleisch wucherte über die Zähne, als wolle es sie verschlingen, so dass sie nichts zu sich nehmen konnten. Der Geruch aus ihrem Mund wurde unerträglich. Die ersten Männer starben. Paulo da Gama tröstete unablässig die Kranken und Sterbenden und behandelte sie mit seinen eigenen medizinischen Vorräten. Was die ganze Expedition vor der Vernichtung rettete, waren jedoch weder die Fürsorge Paulos noch die gesunde Luft, wie manche glaubten, sondern die rein zufällig reichlich wachsenden Früchte an den Ufern des Sambesi.
Einen Monat lang blieben sie vor dem gewaltigen Delta vor Anker. Sie kielholten die Schiffe, reparierten den Mast der Rafael, füllten die Wasserfässer wieder auf und erholten sich von den Strapazen der See. Als sie abfuhren, errichteten sie eine Säule, die dem Heiligen Rafael gewidmet war, und tauften den Sambesi den Fluss der guten Vorzeichen. Die Luft, die Wärme und die vergleichsweise hohe Kultiviertheit der einheimischen Bevölkerung weckte ein Gefühl der Erwartung. Nach sieben Monaten auf See hatten sie die Schwelle des Indischen Ozeans erreicht.
Die Schiffe, die am 24. Februar ablegten, befanden sich bald in der Straße von Moçambique, dem breiten Wasserweg zwischen der Ostküste Afrikas und der Insel Madagaskar, deren Wirbel und Strömungen für Segelschiffe eine ernstzunehmende Gefahr waren. Die Hitze nahm zu; der Himmel und das Meer waren leuchtend blau; an Land waren ein Saum grüner Bäume, weißer Sand und die Brandung zu sehen. Da sie sich vor Untiefen in Acht nehmen mussten, segelten sie nur bei Tag. Nachts gingen sie vor Anker. Sie kamen ungehindert voran, bis sie am 2. März eine große Bucht erblickten. Die leichte Karavelle Bérrio, die die Tiefe testete, irrte sich im Kanal und lief auf eine Sandbank auf. Als Coelho, der Pilot, das Schiff wieder freibekam und vor Anker ging, bemerkten sie eine Delegation von Männern in Einbäumen, die sich von einer nahe gelegenen |70|Insel unter dem Lärm von Blechtrompeten näherten. „Sie luden uns ein, weiter in die Bucht hineinzufahren, und boten sich an, uns auf Wunsch in den Hafen zu bringen. Einige kamen auf unsere Schiffe, aßen und tranken mit uns. Als sie genug hatten, fuhren sie wieder davon.“33 Der Hafen hieß, wie sie nun erfuhren, Moçambique, und die Kommunikationssprache war Arabisch. Sie hatten die muslimische Welt betreten. Nunmehr sollten ihre Aktivitäten eine neue Wendung nehmen.