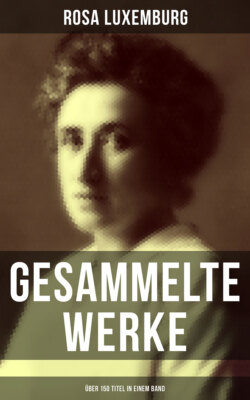Читать книгу Gesammelte Werke (Über 150 Titel in einem Band) - Rosa Luxemburg - Страница 60
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFußnoten:
1 K. Marx. Das Kapital. Bd. I, 4. Auf., 1890, S. 529. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 591.
2 In dieser Darstellung nehmen wir Mehrwert als identisch mit Profit an, was ja für die Gesamtproduktion, auf die es weiter allein ankommt, zutrifft. Auch sehen wir von der Spaltung des Mehrwerts in seine Einzelteile: Unternehmensgewinn, Kapitalzins, Rente, ab, da sie für das Problem der Reproduktion zunächst belanglos ist.
3 Das Kapital. Bd. II. 2 Aufl., 1893. S. 332. [Karl Marx. Das Kapital. Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 359.]
4 Siehe Analyse du Tableau économique. In Journal de l'Agriculture, du Commerce et des Finances, hrsg. von Du Pont 1766; S. 305 ff der Onckenschen Ausgabe der "Œvres de Quesnay". Quesnay bemerkt ausdrücklich, daß die von ihm geschilderte Zirkulation zwei Bedingungen zur Voraussetzung hat: einen ungehinderten Handelsverkehr und ein System von Steuern, die nur auf die Rente gelegt sind: "Mais ces données ont des conditions sine quabus non, elles supposent que la liberté du commerce soutient le débit de productions à un bon prix ... elles supposent d'ailleurs que le cultivateur n'ait à payer directement ou indirectement d'autre charges que le revenu, dont une partie, par exemple les deux septièmes, doit former le revenu du souverain." (l.c. S. 311.)
5 Adam Smith: Natur und Ursache des Volkswohlstandes. Übersetzung von Loewenthal. Band I, 2. Aufl. S. 53.
6 l.c., S. 291/292.
7 l.c., S. 95
8 Über Rodbertus mit seinem spezifischen Begriff des "Nationalkapitals" weiter unten im zweiten Abschnitt.
9 J. B. Say: Traité d'économie politique. 8. Aufl. 2 Buch, Kapitel V, Paris 1876, S. 376.
10 Es ist übrigens zu bemerken, daß Mirabeau in seinen "Explicacions" zum "Tableau" an einer Stelle ausdrücklich das fixe Kapital der sterilen Klasse erwähnt: "Les avances primitives de cette classe pour établissement de manufactures, pour instruments, machines, moulins, forges et autres usines ... 2.000.000 l." Tableau économique avec ses Explications, 1760, S. 82.) In seinem sinnverwirrenden Entwurf des Tableau selbst zieht freilich auch Mirabeau dieses fixe Kapital der sterilen Klasse nicht in Anrechnung.
11 Smith formuliert denn auch ganz allgemein : "Der Wert (nicht der "Mehrwert", wie Herr Loewenthal willkürlich übersetzt - R. L.), welchen die Arbeiter den Arbeitsstoffen hinzufügen, zerfällt somit hierbei in zwei Teile, in einen, der ihre Arbeitslöhne bestreitet und in einen andern, welcher den Gewinn ihres Arbeitgebers auf das gesamte für Stoffe und Löhne vorgestreckte Kapital darstellt." (Adam Smith: l.c., Bd. I, S. 51) Im Original: "The value which the workmen add to the materials, therefore, resolves itself in the case into two parts, of which the one pays their wages, the other the profits of their employer upon the whole stock of materials and wages which he advanced." (Wealth of Nations, hrsg. von MacCulloch, 1828, Bd. I, S. 83.) Und im zweiten Buch, Kapitel III, speziell über die Industriearbeit: "Dir Arbeit eines Fabrikarbeiters (fügt) dem Werte der von ihm verarbeiteten Rohstoffe den seines eigenen Unterhalts und des Gewinns seines Brotherrn hinzu; die eines Dienstboten dagegen erhöht den Wert von nichts. Obgleich der Fabrikarbeiter den Arbeitslohn von seinem Brotherrn vorgestreckt erhält, verursacht er diesem in Wirklichkeit doch keine Kosten, da er sie ihm in der Regel zuzüglich eines Gewinnes durch den erhöhten Wert des bearbeiteten Gegenstandes wiedererstattet." (l.c., Bd. I., S. 541.)
12 "Die zur landwirtschaftlichen Arbeit verwendeten Menschen ... reproduzieren mithin nicht nur, wie die Fabrikarbeiter, einem ihrem eigenen Verbrauche oder dem sie beschäftigenden Kapitale samt dem Gewinne des Kapitalisten gleichen Wert, sondern einen viel größeren. Außer dem Kapitale des Pächters samt seinem ganzen Gewinne reproduzieren sie auch regelmäßig die Rente für den Grundbesitzer." (l.c., Bd. I., S. 377)
13 l.c. Bd. I., S. 342. Freilich verwandelt Smith schon in dem darauffolgenden Satz das Kapital ganz in Löhne, in variables Kapital: "That part of the annual produce of the land and labour of any country which replaces capital, never is immediately imployed so maintain any but productive hands. It pays the wages of productive labour only. That which is immediately destined for constituting a revenue, either as profit or as rent, may maintain indifferently either productive hands." (Ausgabe MacCulloch, Bd. II., S. 98)
14 l.c., Bd. I., S. 292.
15 l.c., Bd. I., S. 292.
16 l.c., Bd. I., S. 294.
17 l.c., Bd. I., S. 294.
18 Siehe Das Kapital, Bd. II, S. 351 [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Bd. 24. S. 376/377.]
19 A. Smith: l.c., Bd. I, S. 376.
20 Siehe R. Luxemburg. In: Die Neue Zeit, 18. Jg., Zweiter Band, S.184. [Rosa Luxemburg: Zurück auf Adam Smith! In: Rosa Luxemburg: Gesammelte Werke, Bd. 1, Erster Halbbd., Berlin 1972, S. 735.]
21 Wir lassen hier außer Betracht, daß bei Smith auch die umgekehrte Auffassung dazwischenläuft, wonach sich nicht der Preis der Waren in v + m auflöst, sondern der Wert der Waren aus v + m zusammensetzt! Dieses Quidproquo ist wichtiger für die Smithsche Werttheorie als in dem Zusammenhang, in dem und hier seine Formel v + m interessiert.
22 Wir sprechen hier wie im folgenden der Einfachheit halber und im Sinne des gewohnten Sprachgebrauchs immer von jährlicher Produktion, was meist nur für die Landwirtschaft stimmt. Die industrielle Produktionsperiode und der Kapitalumschlag brauchen sich mit dem Jahreswechsel gar nicht zu decken.
23 Die Arbeitsteilung zwischen geistiger und materieller Arbeit braucht in einer planmäßig geregelten, auf Gemeineigentum der Produktionsmittel basierten Gesellschaft nicht an besondere Kategorien der Bevölkerung geknüpft zu sein. Sie wird sich aber jederzeit in dem Vorhandensein einer gewissen Anzahl geistig Tätiger äußern, die materiell erhalten werden müssen, wobei die Individuen diese verschiedenen Funktionen abwechselnd ausüben mögen.
24 "Wenn man von gesellschaftlicher Betrachtungsweise spricht, also das gesellschaftliche Gesamtprodukt betrachtet, welches sowohl die Reproduktion des gesellschaftlichen Kapitals wie die individuelle Konsumtion einschließt, so muß man nicht in die von Proudhon der bürgerlichen Ökonomie nachgemachte Manier verfallen und die Sache so betrachten, als wenn eine Gesellschaft kapitalistischer Produktionsweise, en bloc, als Totalität betrachtet, diesen ihren spezifischen, historisch ökonomischen Charakter verlöre. Umgekehrt. Man hat es dann mit dem Gesamtkapitalisten zu tun. Das Gesamtkapital erscheint als das Aktienkapital aller einzelnen Kapitalisten zusammen. Dies Aktiengesellschaft hat das mit vielen anderen Aktiengesellschaften gemein, das jeder weiß, was er hineinsetzt, aber nicht, was er herauszieht." (Das Kapital, Bd. II, S. 409.) [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band In: Karl Marx/Friedrich Engels Werke, Bd. 24. S. 431.]
25 Siehe Das Kapital, Bd. II, S. 371. [Karl Marx: Das Kapital. Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 396.]
26 Siehe Das Kapital, Bd. II, S. 443-445. [Karl Marx: Das Kapital. Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 463-465.] Vgl. auch über die Notwendigkeit der erweiterten Reproduktion vom Standpunkt des Assekuranzfonds im allgemeinen, l.c. S. 148. [Karl Marx: Das Kapital. Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 178.]
27 Theorien, l.c. S. 248. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 481/482.]
28 In seiner siebenten Bemerkung zum "Tableau" sagt Quesnay, nachdem er gegen die merkantilistische Theorie vom Geld, das mit Reichtum identisch sei, polemisiert hat: "La masse d'argent ne peut accroître dans une nation qu'autant que cette reproduction elle-même s'y accroît; autrement, l'accroissement de la masse d'argent ne pourrait se faire qu'au préjudice de la reproduction annuelle des richesses ... Ce n'est pas par le plus ou le moins d'argent qu'on doit juger de l'opulence des États; aussi estime-t-on qu'un pécule, égal au revenu de propriétaires des terres, est beaucoup plus que suffisant pour une nation agricole où la circulation se fait régulièrement et où le commerce s'exerce avec confiance et en pleine liberté." (Analyse du Tableau économique, Ausgabe Oncken, S. 324/325.)
29 Marx nimmt (siehe Das Kapital, Bd. II. S. 391) [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 414/415.] für diesen Austausch nur Geldausgabe seitens der Kapitalisten II als Ausgangspunkt an. An dem Schlußergebnis der Zirkulation ändert dies nichts, wie F. Engels in der Fußnote richtig bemerkt, aber als Voraussetzung der gesellschaftlichen Zirkulation ist die Annahme nicht exakt; richtiger die Darstellung bei Marx selbst (siehe l.c. S. 374). [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 398/399.]
30 Das Kapital, Bd. II. S. 446. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 466.]
31 Das Kapital, Bd. II. S. 448. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 468.]
32 Das Kapital, Bd. II. S. 466. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 486.]
33 "Die Voraussetzung der einfachen Reproduktion, daß I (v + m) = II c sei, ist nicht nur unverträglich mit der kapitalistischen Produktion, was übrigens nicht ausschließt, daß im industriellen Zyklus von 10-11 Jahren ein Jahr oft geringer Gesamtreproduktion hat als das vorhergehende, also nicht einmal einfache Reproduktion stattfindet im Verhältnis zum vorhergehenden Jahr. Sondern auch bei dem natürlichen jährlichen Wachstum der Bevölkerung könnte einfache Reproduktion nur insofern stattfinden, als von den 1.500, die den Gesamtmehrwert repräsentieren, eine entsprechend größre Zahl unproduktiver Dienstleute mitzehrten. Akkumulation von Kapital, also wirkliche kapitalistische Produktion wäre dagegen hierbei unmöglich." (Das Kapital, Bd. II, S. 497.) [Karl Marx: Das Kapital. Zweiter Band. In Karl Marx/Friedrich Engel: Werke, Bd. 24, S. 515.]
34 "Die spezifisch kapitalistische Produktionsweise, die ihr entsprechende Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, der dadurch verursachte Wechsel in der organischen Zusammensetzung des Kapitals halten nicht nur Schritt mit dem Fortschritt der Akkumulation oder dem Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums. Sir schreiten ungleich schneller, weil die einfache Akkumulation oder die absolute Ausdehnung des Gesamtkapitals von der Zentralisation seiner individuellen Elemente und die technische Umwälzung des Zusatzkapitals von technischer Umwälzung des Originalkapitals begleitet sind. Mit dem Fortgang der Akkumulation wandelt sich also das Verhältnis von konstantem zu variablem Kapitalteil, wenn ursprünglich 1:1, in 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 usw., so daß, wie das Kapital wächst, statt 1/2 seines Gesamtwerts progressiv nur 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 usw. in Arbeitskraft dagegen 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 usw. in Produktionsmittel umgesetzt wird. Da die Nachfrage nach Arbeit nicht durch den Umfang des Gesamtkapitals, sondern durch den seines variablen Bestandteils bestimmt ist, fällt sie also progressiv mir dem Wachstum des Gesamtkapitals, statt, wie vorhin unterstellt, verhältnismäßig mit ihm zu wachsen. Sie fällt relativ zur Größe des Gesamtkapitals und in beschleunigter Progression mit dem Wachstum dieser Größe. Mit dem Wachstum des Gesamtkapitals wächst zwar auch sein variabler Bestandteil oder die ihm einverleibte Arbeitskraft, aber in beständig abnehmender Proportion. Die Zwischenpausen, worin die Akkumulation als bloße Erweiterung der Produktion auf gegebner technischer Grundlage wirkt, verkürzen sich. Nicht nur wird eine in wachsender Progression beschleunigte Akkumulation des Gesamtkapitals erheischt, um eine zusätzliche Arbeiterzahl von gegebner Größe zu absorbieren oder selbst, wegen der beständigen Metamorphose des alten Kapitals, die bereits funktionierende zu beschäftigen. Ihrerseits schlägt diese wachsende Akkumulation und Zentralisation selbst wieder in eine Quelle neuer Wechsel der Zusammensetzung des Kapitals oder abermalig beschleunigter Abnahme seines variablen Bestandteils, verglichen mit dem konstanten." (Das Kapital, Bd. I, S. 593.) [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23. S. 657/658.]
35 "Der charakteristische Lebenslauf der modernen Industrie, die Form eines durch kleinere Schwankungen unterbrochenen zehnjährigen Zyklus von Perioden mittlerer Lebendigkeit, Produktion unter Hochdruck, Krise und Stagnation, beruht auf der beständigen Bildung, größern oder geringeres Absorption und Wiederbildung der industriellen Reservearmee oder Übervölkerung. Ihrerseits rekrutieren die Wechselfälle des industriellen Zyklus die Übervölkerung und werden zu einem ihrer energischsten Reproduktionsagentien." (Das Kapital, Bd. I, S. 594.) [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 661.]
36 Das Kapital, Bd. I, S. 543. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 606/607.]
37 l.c., S. 544. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 607.]
38 Siehe Das Kapital, Bd. II, S. 487-490. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 505-509.]
39 Das Kapital, Bd. II, S. 488. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 507.]
40 Das Kapital, Bd. II, S. 489. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 508.]
41 Siehe Das Kapital, Bd. II, S. 491. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 509.]
42 Das Kapital, Bd. II, S. 346. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 372.]
43 Das Kapital, Bd. II, S. 432. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 453/454.]
44 Das Kapital, Bd. I, S. 544. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 607.]
45 l.c., 544. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 607.]
46 Wir sehen hier von Fällen ab, wo ein Teil des Produkts, z.B. Kohle in den Kohlengruben, direkt ohne Austausch in den Produktionsprozeß wieder eingehen kann. Es sind dies im Ganzen der kapitalistischen Produktion Ausnahmefälle. Vgl. Marx: Theorien über den Mehrwert, Bd. II, Teil 2, S. 255 ff. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 486 ff.]
47 Das Kapital, Bd. II, S. 409. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 431.]
48 Das Kapital, Bd. II, S. 465. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 485.]
49 Das Kapital, Bd. II, S. 466-468. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 486-487.]
50 Das Kapital, Bd. II, S. 469. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 488-489.]
51 Das Kapital, Bd. II, S. 473. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 492-493.]
52 l.c., S. 476. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 495.]
53 l.c., S. 476. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 495.]
54 Das Kapital, Bd. II, S. 477. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 496.]
55 Das Kapital, Bd. II, S. 478. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 497/498.]
56 Das Kapital, Bd. II, S. 480. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 499.]
57 Das Kapital, Bd. II, S. 482. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 500/501.]
58 Das Kapital, Bd. II, S. 484. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 503.]
59 Das Kapital, Bd. II, S. 485. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 503/504.]
60 Das Kapital, Bd. II, S. 486. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 504.]
61 Das Kapital, Bd. II, S. 487. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 505.]
62 Das Kapital, Bd. II, S. 492. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 510.]
63 Das Kapital, Bd. II, S. 499. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 517.]
64 Das Kapital, Bd. II, S. 466. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 486.]
65 Das Kapital, Bd. II, S. 304. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 332.]
66 Das Kapital, Bd. II, S. 306. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 334.]
67 Das Kapital, Bd. II, S. 308. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 335.]
68 Das Kapital, Bd. II, S. 309. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 337.]
69 Das Kapital, Bd. II, S. 318. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 346.]
70 Das Kapital, Bd. II, S. 322. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 349.]
71 Siehe z.B. Das Kapital, Bd. II, S. 343, 424 u. 431. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 369, 445/446 u. 452.]
72 Der Auszug aus diesem interessanten Dokument befindet sich in einer Besprechung der Schrift: Observations on the Injurious Consequences of the Restrictions upon Foreign Commerce. By a Member of the late Parliament, London 1820. Dieser freihändlerische Aufsatz malt überhaupt die Lage der Arbeiter in England in den düstersten Farben. Er führt unter anderem folgende Tatsachen an: "The manufacturing classes in Great Britain - have been suddenly reduced from affluence and prosperity to the extreme of poverty and misery. In one of the debates in the late Session of Parliament, it was stated, that the wages of weavers of Glasgow and its vicinity, which, when higher, had averaged about 25 s. or 27 s. a week, had been reduced in 1816 to 10 s.; and in 1819 to the wretched pittance of 5 s. 6 d. or 6 s. They have not since been materially augmented." In Lancashire schwankten die Wochenlöhne der Weber nach demselben Zeugnis zwischen 6 und 12 Schilling bei 15stündiger Arbeitszeit, während "halbverhungerte Kinder" für 2 oder 3 Shilling die Woche 12 bis 16 Stunden täglich arbeiteten. das Elend in Yorkshire war womöglich noch größer. In bezug auf die Adresse der Nottinghamer Strumpfwirker sagt der Verfasser, daß er die Verhältnisse selbst untersucht hätte und zu dem Schlusse gelangt wäre, daß die Erklärungen der Arbeiter nicht im geringsten übertrieben waren. (The Edinburgh Review, Mai 1820, S. 331 ff.)
73 J. C. L. Sismonde de Sismondi: Neue Grundsätze der politischen Ökonomie. Übersetzt von Robert Prager, Berlin 1901, Bd. I, S. XIII
74 l.c., Bd. II, S. 358.
75 l.c., Bd. I, S. XIX.
76 "En faisant cette opération, le cultivateur changeait une partie de son revenu en un capital; et c'est en effet toujours ainsi qu'un capital nouveau se forme." (Nouveaux principes ..., 2. Aufl., Bd. I, S. 88.)
77 Wladimir Iljin: Ökonomische Studien und Artikel, Petersburg 1899. [W. I. Lenin: Zur Charakteristik der ökonomischen Romantik. In: Werke, Bd. 2, S. 121-264.]
78 Der Artikel in der "Edinburgh Review" war eigentlich gegen Owen gerichtet. Auf 24 Druckseiten zieht er scharf gegen die vier Schriften zu Felde: A New View of Society, or Essay on the Pronciole Formation of the Human Character; Obsevations on the Effect of the Manufacturing System; Two Memorials on Behalf of the Working Classes, presented to the Governments of America and Europe; endlich Three Tracts, and an Account of Public Proceedings relative to the Employment of the Poor. Der Anonymus sucht Owen haarklein nachzuweisen, daß seine Reformideen nicht im geringsten auf die wirklichen Ursachen der Misere des englischen Proletariats zurückgreifen, denn diese wirklichen Ursachen seien: der Übergang zur Bebauung unfruchtbarerer Ländereien (die Ricardosche Grundrententheorie!), die Kornzölle und die hohen Steuern, die den Pächter wie den Fabrikanten bedrücken. Also Freihandel und laissez faire - das ist Alpha und Omega! Bei ungehinderter Akkumulation wird jeder Zuwachs der Produktion für sich selbst einen Zuwachs der Nachfrage schaffen. Hier wird Owen unter Hinweisen auf Say und James Mill einer "völligen Ignoranz" geziehen: "In his reasonings, as well as in his plans, Mr. Owen shows himself profoundly ignorant of all the laws which regulate the production and distribution of wealth." Und von Owen kommt der Verfasser auch auf Sismondi, wobei er die Kontroverse selbst wie folgt formuliert: "He (Owen) conceives that when competition is unchecked by any artificial regulations, and industry permitted to flow in its natural channels, the use of machinery may increase the supply of the several articles of wealth beyond the demand for them, and by creating an excess of all commodities, throw the working classes out of employment. This is the position which we hold to be fundamentally erroneous; and as it is strongly insisted on by the celebrated Mr. de Sismondi in his 'Nouveaux principes d'économie politique', we must entreat the indulgence of our readers while we endeavour to point out its fallacy, and to demonstrate, that the power of consuming necessarily increases with every increase in the power of producing." (Edinburg Review, Oktober 1819, S. 470.)
79 Der Titel des Aufsatzes lautet im Original: "Examen de cette question: Le pouvoir de consommer s'accroît-il toujours dans la société avec le pouvoir de produire?" Es war unmöglich, Rossis "Annalen" zu erlangen, der Aufsatz ist aber von Sismondi in seiner zweiten Auflage der "Nouveaux principes" ganz aufgenommen.
80 l.c., S. 470
81 Die Leipziger Büchermesse Sismundis als Mikrokosmos des kapitalistischen Weltmarkts feierte übrigens nach fünfundfünfzig Jahren eine fröhliche Auferstehung - in dem wissenschaftlichen "System" Eugen Dührings. Und wenn Engels in seiner kritischen Stäupung des unglücklichen Universalgenies diesen Einfall damit erklärt, Dühring zeige sich darin als "echter deutscher Literatus", daß er sich wirkliche industrielle Krisen an eingebildeten Krisen auf dem Leipziger Büchermarkt, den Sturm auf der See am Sturm im Glase Wasser klarzumachen sucht, so hat der große Denker auch hier wieder, wie in so vielen von Engels nachgewiesenen Fällen, einfach eine stille Anleihe bei einem anderen gemacht.
82 Berberei ist die alte Bezeichnung für das vornehmlich von Berbern bewohnte Nordwest-Afrika.
83 Es ist bezeichnend, daß, als Ricardo 1819 ins Parlament gewählt worden war, er, der damals schon das größte Ansehen wegen seiner ökonomischen Schriften genoß, an einen Freund schrieb: "Sie werden wissen, daß ich im Hause der Gemeinen sitze. Ich fürchte, daß ich da nicht viel nützen werde. Ich habe es zweimal versucht zu sprechen, aber ich sprach mit größter Beklommenheit, und ich verzweifle daran, ob ich je die Angst überwinden werde, die mich befällt, wenn ich den Ton meiner Stimme höre." Dergleichen "Beklommenheit" war dem Schwätzer Culloch völlig unbekannt.
84 Sismondi erzählt uns über diese Diskussion: Monsieur Ricardo, dont la mort récente an profondément affligé, non pas seulement sa famille et ses amis, mais tous ceux qu'il a éclairés par ses lumières, tous ceux qu'il a échauffés par ses nobles sentiments, s'arrêta, quelques jours à Genève dans la dernière année de sa vie. Nous discutâmes ensemble, à deux on trois reprises, cette question fondamentale sur laquelles nous étions en opposition. Il apporta à son examen l'urbanité, la bonne foi, l'amour de la vérité qui le distinguaient, et une clarté laquelle ses disciples eux-mêmes ne se seraient pas entendus, accoutumés qu'ils étaient aux efforts d'abstraction qu'il exigeait d'eux dans le cabinet." Der Aufsatz " Sur la balance" ist abgedruckt in der 2. Ausgabe den "Nouveaux principes", Bd. II. 5. 408.
85 Buch IV, Kap. IV: Der kaufmännische Reichtum folgt dem Wachstum des Einkommens.
86 Nouveaux principes, 2. Aufl. S. 416.
87 Wenn deshalb Herr Tugan-Baranowski im Interesse des von ihm verfochtenen Standpunkts Say-Ricardo die Kontroverse zwischen Sismondi und Ricardo zu berichten weiß, daß Sismondi gezwungen wäre "die Richtigkeit der von ihm angefochtenen Lehre anzuerkennen und seinem Gegner alle nötigen Zugeständnisse zu machen", daß Sismondi "seine eigene Theorie, die bis jetzt so viele Anhänger findet, preisgegeben habe" und daß "der Sieg in dieses Kontroverse auf Seiten Ricardos wäre" (Studien zur Theorie und Geschichte des Handelskrisen in England, 1901, S. 176), so ist das eine solche - sagen wir - Leichtfertigkeit des Urteils, wie wir davon in einem ernsten wissenschaftlichen Werk nicht viel Beispiele kennen.
88 "L'argent ne remplit qu'un office passager dans ce double échange. Les échanges terminés, il se trouve qu'on a payé des produits avec des produits. En conséquence quand une nation a trop de produits dans un genre, le moyen de les écouler est d'en créer d'un autre genre." (J. B. Say: Traité d'économie politique, Bd. I, Paris 1803, S. 154.)
89 In Wirklichkeit gehörte Say auch hier nur die pretentiöse und dogmatische Fixierung des von anderen ausgesprochenen Gedankens. Wie Bergmann in seiner "Geschichte der Krisentheorien" (Stuttgart 1895) darauf aufmerksam macht, finden sich bereits ganz ähnliche Äußerungen über die Identität zwischen Angebot und Nachfrage sowie über das natürliche Gleichgewicht beider bereits bei Josiah Tucker (1752), bei Turgot in dessen Anmerkungen zur französischen Ausgabe des Tuckerschen Pamphlets, bei Quesnay, Du Pont de Nemours und anderen. Trotzdem nimmt der "Jammermensch" Say, wie ihn Marx einmal nennt, die Ehre der großen Entdeckung der "théorie des débouches" als Oberharmoniker für sich in Anspruch und vergleicht sein Werk bescheiden mit der Entdeckung der Theorie der Wärme, des Hebels und der schiefen Ebene (Siehe seine Einleitung und sein Sachregister zur 6. Auflage seines "Traité", 1841: "C'est la théorie des échanges et des débouches - telle qu'elle est développée dans cet ouvrage - qui changera la politique du monde.'' S. 51 u. 616.) James Mill entwickelt dieselben Standpunkt in seinem 1808 erschienenen "Commerce defended". Marx nennt ihn den eigentlichen Vater der Theorie von dem natürlichen Gleichgewicht zwischen Produktion und Absatz.
90 Revue encyclopédique, Bd. XXIII, Juli 1824, S. 20.
91 l.c., S. 21.
92 l.c., S. 29. Say klagt Sismondi als den Erzfeind der bürgerlichen Gesellschaft in folgender pathetischen Deklamation an: "C'est contre l'organisation moderne de la société; organisation qui, en dépouillant l'homme qui travaille de toute autre propriété que celle de ses bras, ne lui donne aucune garantie contre une concurrence dirigée à son préjudice. Quoi! parce que la société garantit à toute espèce d'entrepreneur la libre disposition de ses capitaux, c'est à dire de sa propriété elle dépouille l'homme qui travaille! Je le répète: rien de plus dangéreux que de vues qui conduisent à régler l'usage des propriétés." Denn "les bras et les facultés" - "sont aussi des propriétés"!
93 Marx streift in seiner Geschichte der Opposition gegen die Ricardosche Schule und deren Auflösung Sismondi nur ganz kurz. Er sagt an einer Stelle : "Ich schließe Sismondi hier aus meiner historischen Übersicht aus, weil die Kritik seiner Ansichten in einen Teil gehört, den ich nur erst nach dieser Schrift behandeln kann, die reale Bewegung des Kapitals (Konkurrenz und Kredit)." (Theorien über den Mehrwert, Bd. III. S. 52.) [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Dritter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.3, S. 46.] Etwas weiter widmet Marx jedoch, im Zusammenhang mit Malthus, auch Sismondi einen allerdings in seinen großen Zügen erschöpfenden Passus: "Sismondi hat das tiefe Gefühl, daß die kapitalistische Produktion sich widerspricht; daß ihre Formen - ihre Produktionsverhältnisse - einerseits zur ungezügelten Entwicklung der Produktivkraft und des Reichtums spornen; daß diese Verhältnisse andrerseits bedingte sind, deren Widersprüche von Gebrauchswert und Tauschwert, Ware und Geld, Kauf und Verkauf, Produktion und Konsumtion, Kapital und Lohnarbeit etc. um so größre Dimensionen annehmen, je weiter sich die Produktivkraft entwickelt. Er fühlt namentlich den Grundwiderspruch: Ungefesselte Entwicklung der Produktivkraft und Vermehrung des Reichtums, der zugleich aus Waren besteht, versilbert werden muß, einerseits; andrerseits als Grundlage Einschränkung der Masse der Produzenten auf die necessaries. Hence sind bei ihm die Krisen nicht wie bei Ric(ardo) Zufälle, sondern wesentliche Ausbrüche der immanenten Widersprüche auf großer Stufenleiter und zu bestimmten Perioden. Er schwankt nun beständig: Sollen die Produktivkräfte von Staats wegen gefesselt werden, um sie den Produktionsverhältnissen adäquat zu machen, oder die Produktionsverhältnisse, um sie den Produktivkräften adäquat tu machen? Er flüchtet sich dabei oft in die Vergangenheit; wird laudator temporis acti oder möchte auch durch andre Regelung der Revenue im Verhältnis zum Kapital oder der Distribution im Verhältnis zur Produktion die Widersprüche bändigen, nicht begreifend, daß die Distributionsverhältnisse nur die Produktionsverhältnisse sub alia specie sind. Er beurteilt die Widersprüche der bürgerlichen Produktion schlagend, aber er begreift sie nicht und begreift daher auch nicht den Prozeß ihrer Auflösung. (Wie sollte er das auch, wo diese Produktion erst in ihrer Bildung begriffen war? - R. L.) Was aber bei ihm zugrunde liegt, ist in der Tat die Ahnung, daß den im Schoß der kapitalistischen Gesellschaft entwickelten Produktivkräften, materiellen und sozialen Bedingungen der Schöpfung des Reichtums, neue Formen der Aneignung dieses Reichtums entsprechen müssen; daß die bürgerlichen Formen nur transitorische und widerspruchsvolle sind, in denen der Reichtum immer nur eine gegensätzliche Existenz erhält und überall zugleich als sein Gegenteil auftritt. Es ist Reichtum, der immer die Armut zur Voraussetzung hat und sich nur entwickelt, indem er sie entwickelt." (l.c., S. 55.) [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Dritter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.3, S. 50/51.] Im "Elend der Philosophie" führt Marx Sismondi an einiger Stellen gegen Proudhon an, äußert sich aber über ihn selbst nur im folgenden kurzen Satz: "Diejenigen, welche, wie Sismondi, zur richtigen Proportionalität der Produktion zurückkehren und dabei die gegenwärtigen Grundlagen der Gesellschaft erhalten wollen, sind reaktionär, da sie, um konsequent zu sein, auch alle anderen Bedingungen der Industrie früherer Zeiten zurückzuführen bestrebt sein müssen." [Karl Marx: Das Elend der Philosophie. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 4, S. 97.] In "Zur Kritik der politischen Ökonomie" wird Sismondi zweimal kurz erwähnt; einmal wird er als der letzte Klassiker der bürgerlichen Ökonomie in Frankreich in Parallele mit Ricardo in England gestellt, an einer anderen Stelle wird hervorgehoben, daß Sismondi gegen Ricardo den spezifisch gesellschaftlichen Charakter der wertschaffenden Arbeit betonte. Im Kommunistischen Manifest endlich wird Sismondi als das Haupt des kleinbürgerlichen Sozialismus genannt.
94 Vgl. Marx: Theorien über den Mehrwert, Bd. III, S. 1-29, wo die Malthussche Wert- und Profittheorie eingebend analysiert ist. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Dritter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke. Bd. 26.3, S. 7-38.]
95 Malthus: Definitions in Political Economy, 1827, S. 51.
96 l.c., S. 64.
97 "I suppose they are afraid of the imputation of thinking that wealth consists in money. But though it is certainly true that wealth does not consist in money, it is equally true that money is a most powerful agent in the distribution of wealth, and those who, in a country where all exchanges are practically effected by money, continue the attempt to explain the principles of demand and supply, and the variations of wages and profits, by referring chiefly to hats, shoes, corn, suits of clothing, &c, must of necessity fail." (l.c. S. 60, Fußnote.)
98 Die Kirchmannsche Beweisführung ist bei Rodbertus sehr ausführlich wörtlich zitiert. Ein vollständiges Exemplar der "Demokratischen Blätter" mit dem Originalaufsatz ist nach der Versicherung der Herausgeber Rodbertus' nicht zu erlangen.
99 Carl Rodbertus-Jagetzow: Schriften, Berlin 1899, Bd. III, S. 172-174 u. 184.
100 l.c., Bd. II, S. 104/105.
101 l.c., Bd. I, S. 99.
102 l.c., Bd. I, S. 175.
103 l.c., Bd. I, S. 176.
104 l.c., Bd. II, S. 65.
105 l.c., Bd. I, S. 182-184.
106 l.c., Bd. II, S. 72.
107 Vgl. l.c., Bd. IV, S. 225
108 l.c., Bd. III, S. 110 u. 111.
109 l.c., Bd. III, S. 108.
110 l.c., Bd. I, S. 62.
111 l.c., Bd. IV, S. 226.
112 l.c., Bd. III, S. 186.
113 l.c., Bd. IV, S. 233. Es ist in diesem Zusammenhang interessant zu sehen wie Rodbertus unbeschadet seiner ethischen Polterei über das Los der unglücklichen arbeitenden Klassen in der Praxis als ein äußerst nüchterner und realistisch denkender Prophet der kapitalistischen Kolonialpolitik im Sinne und Geiste der heutigen "Alldeutschen" auftrat. "Von hier" schreibt er in der Fußnote zum angeführten Passus, "mag man einen raschen Blick auf die Wichtigkeit der Erschließung Asiens, namentlich Chinas und Japans, dieser reichsten Märkte der Welt, sowie der Erhaltung Indiens unter englischer Herrschaft werfen. Die soziale Frage gewinnt dadurch Zeit (der donnernde Rächer der Ausgebeuteten verrät hier naiv den Nutznießern der Ausbeutung das Mittel, wie sie ihren "törichten und verbrecherischen Irrtum", ihre "unmoralische" Auffassung, ihre "schreiende Ungerechtigkeit" möglichst lange koservieren können! - R. L.) denn, (diese philosophische Resignation ist unvergleichlich - R. L.) der Gegenwart gebricht es zu ihrer Lösung an Uneigennützigkeit und sittlichem Ernst, ebensosehr als an Einsicht. Ein volkswirtschaftlicher Vorteil ist nun allerdings kein genügender Rechtstitel zu gewaltsamem Einschreiten. Allein andererseits ist auch die strikte Anwendung des modernen Natur- und Völkerrechts auf alle Nationen der Erde, sie mögen einer Kulturstufe angehören, welcher sie wollen, unhaltbar. (Wer denkt da nicht an dir Worte Dorinens im Molièreschen "Tartuffe": "Le ciel défend, de vraie, certains contentements, mais il y avec lui des accomodements." - R. L.) Unser Völkerrecht ist ein Produkt der christlich-ethischen Kultur und kann, weil alles Recht auf Gegenseitigkeit beruht, deshalb auch nur ein Maß für die Beziehungen zu Nationen sein, die dieser selben Kultur angehören. Seine Anwendung über diese Grenze hinaus ist natur- und völkerrechtliche Sentimentalität, von der die indischen Greuel uns geheilt haben werden. Vielmehr sollte das christliche Europa etwas von dem Gefühl in sich aufnehmen, das die Griechen und Römer bewog, alle anderen Völker der Erde als Barbaren zu betrachten. Dann würde auch in den neueren europäischen Nationen wieder jener weltgeschichtliche Trieb wach werden, der die Alten drängte, ihre heimische Kultur über den Orbis terrarum zu verbreiten. Sie würden in gemeinsamer Aktion Asien der Geschichte zurückerobern. Und an diese Gemeinsamkeit würden sich die größten sozialen Fortschritte knüpfen, die feste Begründung des europäischen Friedens, die Reduktion der Armeen, eine Kolonisation Asiens im altrömischen Stil, mit andern Worten, eine wahrhafte Solidarität der Interessen auf allen gesellschaftlichen Lebensgebieten." Der Prophet der Ausgebeuteten und Unterdrückten wird hier bei den Visionen der kapitalistischen Kolonialexpansion beinah zum Dichter. Und dieser poetische Schwung will um so mehr gewürdigt werden, als die "christlich-ethische Kultur" sich just damals mit solchen Ruhmestaten bedeckte wie den Opiumkriegen gegen China und den "indischen Greul" - nämlich den Greul der Engländer bei der blutigen Unterdrückung des Sepoyaufstandes. In seinem "Zweiten socialen Brief", im Jahre 1850, meinte Rodbertus zwar, wenn der Gesellschaft "die sittliche Kraft" zur Lösung der sozialen Frage, d.h. zur Änderung der Verteilung des Reichtums fehlen sollte, würde die Geschichte "wieder die Peitsche der Revolution über sie schwingen müssen". (l.c., Bd. II, S. 83.) Acht Jahre später zieht er als braver Preuße vor, die Peitsche der christlich-ethischen Kolonialpolitik über die Eingeborenen der Kolonialländer zu schwingen. Es ist auch nur folgerichtig, daß der "eigentliche Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus in Deutschland" auch ein warmer Anhänger des Militarismus und seine Phrase von der "Reduktion der Armeen" nur als eine Licentia poetica im Redeschwall zu nehmen war. In seinem "Zur Beleuchtung der Socialen Frage", 2. Teil, 1. Heft, führt er aus, daß "die ganze nationale Steuerlast immerfort nach unten gravitiert, bald in Steigerung der Preise der Lohngüter, bald in dem Druck auf den Geldarbeitslohn", wobei die allgemeine Militärpflicht, "unter den Gesichtspunkt einer Staatslast gebracht, bei den arbeitenden Klassen nicht einmal einer Steuer, sondern gleich einer mehrjährigen Konfiskation des ganzen Einkommens gleichkommt." Dem fügt er schleunig hinzu: "Um keinem Mißverständnis ausgesetzt zu sein, bemerke ich, daß ich ein entschiedener Anhänger unserer heutigen Militärverfassung (also der preußischen Militärverfassung der Konterevolution - R. L.) bin, so drückend sie auch für die arbeitenden Klassen sein mag und so hoch die finanziellen Opfer scheinbar sind, die den besitzenden Klassen dafür abverlangt werden." (l.c., Bd. III, S. 34) Nein, Schnock ist entschieden kein Löwe!
114 Siehe l.c., Bd. III, S. 182.
115 l.c., Bd. IV, S. 231.
116 l.c., Bd. I, S. 59.
117 l.c., Bd. III, S. 176.
118 l.c., Bd. I, S. 53 u. 57.
119 l.c., Bd. I, S. 206.
120 l.c., Bd. I, S. 19.
121 l.c., Bd. II, S. 110.
122 l.c., Bd. II, S. 144.
123 l.c., Bd. II, S. 146.
124 l.c., Bd. II, S. 155.
125 l.c., Bd. II, S. 233.
126 l.c., Bd. II, S. 226.
127 l.c., Bd. II, S. 156.
128 l.c., Bd. I, S. 240.
129 l.c., Bd. II, S. 25.
130 l.c., Bd. I, S. 250.
131 l.c., Bd. I, S. 295. Auch hier käute Rodbertus sein Leben lang nur die Ideen wieder, die er schon 1842 in seinem "Zur Erkenntniß [unserer staatswirthschaftlichen Zustände]" ausgesprochen hatte: "Indessen ist man für den heutigen Zustand selbst so weit gegangen, nicht bloß den Arbeitslohn, sondern selbst Renten und Profit zu den Kosten des Guts zu rechnen. Diese Ansicht verdient daher eine ausführliche Widerlegung. Ihr liegt zweierlei zum Grunde: a) eine schiefe Vorstellung von Kapital, in welcher man den Arbeitslohn in gleicher Weise zum Kapital rechnet wie Material und Werkzeuge, während er doch nur mit Renten und Profit auf gleicher Linie steht; b) eine Verwechselung der Kosten des Guts mit den Auslagen des Unternehmers oder den Kosten des Betriebs." (Zur Erkenntniß, Neubrandenburg und Friedland 1842, S. 14.)
132 l.c., Bd. I, S. 304. Genauso bereits in "Zur Erkenntniß [unserer staatswirthschaftlichen Zustände]": "Man muß ... das Kapital im engeren oder eigentlichen Sinne von dem Kapital im weiteren Sinne oder Unternehmungsfonds unterscheiden. Jener umfaßt den wirklichen Vorrat von Werkzeugen und Material, dieser den ganzen nach den heutigen Verhältnissen der Teilung der Arbeit zur Unternehmung eines Betriebes notwendigen Fonds. - Jener ist das zur Produktion absolut notwendige Kapital, dieser hat nur durch die heutigen Verhältnisse eine solche relative Notwendigkeit. Jener Teil ist daher das Kaital im engeren und eigentlichen Sinne allein, und nur mit ihm fällt der Begriff des Nationalkapitals zusammen." (l.c.; S. 23 u. 24.)
133 l.c., Bd. I, S. 292.
134 l.c., Bd. II, S. 136.
135 l.c., Bd. II, S. 225.
136 l.c., Bd. I, S. 61.
137 Übrigens ist ihm das schlimmste Denkmal von seinen postumen Herausgebern gesetzt worden. Diese gelehrten Herren, Professor Wagner, Dr. Kozak, Moritz Wirth und wie sie alle heißen, die sich in den Vorreden zu seinen Nachlaßbänden wie ein Haufen ungebärdiger Diener im Vorzimmer zanken, ihren persönlichen Tratsch und ihre Eifersüchteleien austragen und einander coram publico beschimpfen, haben dabei nicht einmal die elementarste Sorgfalt und Pietät aufgebracht, um das Entstehungsdatum der einzelnen vorgefundenen Manuskripte Rodbertus' festzustellen. Sie haben sich z.B. erst von Mehring belehren lassen müssen, daß das älteste aufgefundene Manuskript von Rodbertus nicht aus dem Jahre 1837, wie Professor Wagner souverän beschlossen hatte, sondern frühestens aus dem Jahre 1839 stammen könne, sintemalen darin gleich in den ersten Zeilen von geschichtlichen Ereignissen aus der Chartistenbewegung die Rede ist, die in das Jahr 1839 gehören, was zu wissen für einen Professur der Nationalökonomie sozusagen Pflicht war. Professor Wagner, der in den Vorreden zu Rodbertus mit seiner Wichtigtuerei und seiner schrecklich "besetzten Zeit" alle Augenblicke lästig wird und der überhaupt nur mit seinen "Fachkollegen" über die Köpfe des übrigen Menschenpöbel spricht, hat die elegante Lektion Mehrings vor versammelten Fachkollegen als großer Mann schweigend hingenommen. Professor Diehl aber hat ebenso schweigend im "Handwörterbuch der Staatswissenschaften" das Datum 1837 einfach auf 1839 korrigiert, ohne auch nur mit einer Silbe den Lesern zu verraten, wann und von wem ihm die Erleuchtung ward. Die Krone bildet jedoch die wohl "fürs Volk" bestimmte "neue wohlfeile Ausgabe" bei Puttkammer und Mühlbrecht aus dem Jahre 1899, die einige der sich zankenden Herren Herausgeber friedlich vereinigt, ihren Zank aber in den Vorreden mit aufgenommen hat, eine Ausgabe, wo z.B. aus dem früheren wagnerschen Band II nunmehr Band I gemacht worden ist, man aber Wagner trotzdem in der Einleitung zu Band III ruhig weiter von "Band II" fortwährend reden läßt, wo der "Erste sociale Brief" in Band III, der zweit und dritte in Band II und der vierte in Band I geraten ist, wo überhaupt die Reihenfolge der "Socialen Briefe", "Kontroversen", Teile "Zur Beleuchtung [der Socialen Frage]" und Bände, chronologische und logische Zusammenhänge, Datum der Herausgaben und Datum der Entstehung der Schriften ein undurchdringlicheres Chaos darstellen als die Schichtungen der Erdrinde nach mehrmaligen vulkanischen Ausbrüchen und wo - im Jahre 1899 - wohl aus Pietät für Professor Wagner das Datum der ältesten Schrift Rodbertus' auf 1837 beibehalten worden ist, trotzdem Mehrings Belehrung bereits 1894 erfolgt war! Man vergleiche damit des Marxschen Nachlaß in den Ausgaben von Mehring und Kautsky bei Dietz, und man wird sehen, wie sich in scheinbar so äußerlichen Dingen tiefere Zusammenhänge spiegeln. So wird das wissenschaftliche Erbe der Meister des klassenbewußten Proletariats gepflegt und so wird von des offiziellen Gelehrten der Bourgeoisie das Erbe eines Mannes vertrödelt, der nach ihrer eigenen interessierten Legende ein erstklassiges Genie war! Suum cuique - war der Wahlspruch Rodbertus'.
138 Vaterländische Memoiren, 1883, V, Zeitgenössische Rundschau, S. 4.
139 l.c., S. 10.
140 l.c., S. 14.
141 Umrisse der theoretischen Nationalökonomie, Petersburg, 1895, S. 157 ff.
142 Militarismus und Kapitalismus. In: Russische Gedanke, 1889, Bd. IX, S. 78.
143 l.c., S. 80.
144 l.c., S. 83. Vgl. Umrisse der theoretischen Nationalökonomie, S. 196.
145 Vgl. Abhandlungen über unsere Volkswirtschaft, namentlich S. 202-205 u. 338-341.
146 Die frappante Ähnlichkeit in der Position der russischen "Volkstümler" mit der Auffassung Sismondis hat namentlich Wlad. Iljin 1897 in einem Aufsatz "Zur Charakteristik des ökonomischen Romantizismus" im einzelnen nachgewiesen. [W. I. Lenin: Zur Charakteristik der ökonomischen Romantik. In: Werke, Bd. 2, S. 121-251.]
147 Siehe l.c., S. 322 ff. Anders beurteilte Fr. Engels die Lage in Rußland und suchte Nikolai-on wiederholt klarzumachen, daß für Rußland die großindustrielle Entwicklung unvermeidlich und daß die Leiden Rußlands nur die typischen Widersprüche des Kapitalismus seien. So schreibt er am 22. September 1892: "Ich behaupte nun, daß die industrielle Produktion heutzutage grande industrie bedeutet, Dampf, Elektrizität, mechanische Spindeln und Webstühle und schließlich maschinelle Herstellung der Maschinen selbst. Von dem Tage an, da Rußland Eisenbahnen einführte, war die Einführung dieser modernen Produktionsmittel beschlossene Sache. Ihr müßt imstande sein, Eure eigenen Lokomotiven, Waggons, Schienenwege zu reparieren und das kann nur auf billige Weise geschehen, wenn Ihr bei Euch auch die Dinge herstellen könnt, die Ihr reparieren wollt. Von dem Augenblick an, da die Kriegführung ein Zweig der grande industrie wurde (Panzerschiffe, gezogene Geschütze, schnellfeuernde Repetierkanonen, Repetiergewehre, Stahlmantelkugel, rauchloses Pulver usw.), ist die grande industrie, ohne die alle diese Dinge nicht produziert werden können, eine politische Notwendigkeit geworden. All das kann man nicht ohne eine hochentwickelte Metallindustrie haben, und diese wieder ist unmöglich ohne eine entsprechende Entwicklung aller anderen Industriezweige, namentlich der Textilindustrie." Und weiter in demselben Briefe: "Solange sich die russische Manufaktur auf den inneren Markt beschränken muß, können ihre Produkte auch nur den Inlandsbedarf decken. Dieser aber kann nur langsam wachsen und sollte sogar, wir mir scheint, unter den gegenwärtigen Bedingungen in Rußland abnehmen. Denn es ist eine der notwendigen Folgeerscheinungen der grande industrie, daß sie ihren eigenen innern Markt durch denselben Prozeß zerstört, durch den sie ihn schafft. Sie schafft ihn, indem sie die Basis der bäuerlichen Hausindustrie vernichtet. Aber ohne Hausindustrie kann die Bauernschaft nicht leben. Die Bauern werden als Bauern ruiniert; ihre Kaufkraft wird auf ein Minimum reduziert; und bis sie sich als Proletarier in die neuen Existenzbedingungen hineingefunden haben, geben sie für die neuentstandenen Fabriken einen sehr schlechten Markt ab. Die kapitalistische Produktion als eine vorübergehende ökonomische Phase ist voll innerer Widersprüche, die sich in dem Maße entfalten und sichtbar werden, in dem sie sich selbst entfaltet. Die Tendenz, ihren eigenen Markt zu schaffen und zugleich zu zerstören, ist einer dieser Widersprüche. Ein anderer liegt in der, zu der sie führt und die in einem Land ohne auswärtigen Markt, wie Rußland, eher eintritt als in Ländern, die auf dem freien Weltmarkt mehr oder weniger konkurrenzfähig sind. Diese letztgenannten Länder finden in einer solchen scheinbar ausweglosen Lage eine Lösung in der Ausdehnung des Handels durch gewaltsame Erschließung neuer Märkte. Aber auch da steht man vor einem cul-de-sac. Nehmen Sie England! Der letzte neue Markt, dessen Erschließung dem englischen Handel eine zeitweilige Wiederbelebung bringen könnte, ist China. Daher besteht das englische Kapital darauf, die chinesischen Eisenbahnen zu bauen. Aber chinesische Eisenbahnen bedeuten die Zerstörung der ganzen Basis der chinesischen kleinen Landwirtschaft und Hausindustrie, und da es nicht einmal eine chinesische grande industrie als Gegengewicht gibt, wird es Hunderten von Millionen Menschen unmöglich gemacht, ihr Dasein zu fristen. Die Folge wird eine Massenauswanderung sein, wir sie die Welt noch nicht gesehen hat, eine Überflutung Amerikas, Asiens und Europas durch den verhaßten Chinesen, der dem amerikanischen, australischen und europäischen Arbeiter auf der Grundlage des chinesischen Lebensstandards, des niedrigsten der Welt, Konkurrenz machen wird - und wenn die Produktionsweise in Europa bis dahin noch nicht umgewälzt ist, so wird ihre Umwälzung dann notwendig werden." (Briefe von Karl Marx und Friedrich Engels an Nikolai-on. Übersetzt ins Russische von G. Lopatin, Petersburg 1908, S. 79.) [Engels an Nikolai Franzewitsch Danielson, 22. September 1892. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 38, S. 467 u. 469/470.] - Trotzdem Engels an die Entwicklung der Dinge in Rußland aufmerksam verfolgte und dafür das größte Interesse zeigte, lehnte er seinerseits geflissentlich jede Einmischung in den russischen Streit ab. Er äußerte sich darüber selbst in seinem Briefe vom 24. November 1894, also kurz vor seinem Tode, wie folgt: "Meine russischen Freunde bestürmen mich ununterbrochen mit der Bitte, auf russische Zeitschriften und Bücher zu antworten, in denen die Worte unseres Autors (so wurde in dem Briefwechsel Marx bezeichnet - R. L.) nicht nur falsch interpretiert, sondern auch falsch zitiert werden; sie behaupten, mein Eingreifen würde genügen, um alles in Ordnung zu bringen. Ich habe das ständig abgelehnt, weil ich mich nicht, ohne dringende und wichtige Arbeiten aufzugeben, in Kontroversen hineinzerren lassen kann, die in einem weit entfernten Land in einer Sprache geführt werden, die ich noch nicht so leicht wie die bekannteren westeuropäischen Sprachen zu lesen vermag, und in Druckschriften, von denen ich im besten Falle nur gelegentliche Bruchstücke zu Gesicht bekomme, und daher die Debatte ganz unmöglich gründlich und in allen ihrer Phasen und Einzelheiten verfolgen kann. Überall trifft man ja Leute, die, um eine einmal eingenommene Position zu verteidigen, vor keiner Verzerrung und keinem unfairen Manöver zurückschrecken; und wenn man das mit den Schriften unseres Autors gemacht hat, so befürchte ich, daß man auch mit mir nicht glimpflicher verfahren und mich so schließlich zwingen würde, in die Debatte einzugreifen, um andere und mich selbst zu verteidigen." (l.c., S. 90.) [Engels an Nikolai Franzewitseh Danielson, 24. November 1894. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 39, S. 328.]
148 Übrigens sind die überlebenden Wortführer des volkstümlerischen Pessimismus, namentlich Herr W. Woronzow, ihrer Auffassung bis zuletzt treu geblieben, trotz allem, was inzwischen in Rußland passiert ist - eine Tatsache, die ihrem Charakter mehr Ehre macht als ihrem Kopfe. Im Jahre 1902 schrieb Herr W. W. mit Hinweis auf die Krise der Jahre 1900-1902 "Die dogmatische Lehre des Neomarxismus verliert rasch ihre Macht über die Geister, und die Wurzellosigkeit des neuesten Erfolge des Individualismus ist offenbar selbst für seine offiziellen Apologeten klargeworden ... Im ersten Dezennium des 20. Jahrhunderts kehren wir somit zu derselben Auffassung der ökonomischen Entwicklung Rußlands zurück, die von der Generation der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ihren Nachfolgern vermacht worden war." (Siehe die Revue "Die Volkswirtschaft", Oktober 1902. Zit. bei A. Finn-Jenotajewskij: Die gegenwärtige Wirtschaft Rußlands (1890 bis 1910), Petersburg 1911, S. 2.) Statt auf die "Wurzellosigkeit" der eigenen Theorien, schließen die letzten Mohikaner der Volkstümelei also heute noch auf die "Wurzellosigkeit" der ökonomischen Wirklichkeit - eine lebendige Widerlegung des Barèreschen Wortes: "il n'y a que les morts qui ne reviennent pas."
149 Kritische Bemerkungen, S. 251.
150 l.c., S. 255.
151 l.c., S. 252
152 l.c., S. 260. "Entschieden unrecht hat er (Struve - R. L.), wo er den gegenwärtigen Zustand Rußlands dem der Vereinigten Staaten vergleicht, um das zu widerlegen, was er Ihre pessimistischen Zukunftsansichten nennt. Er sagt, die üblen Folgen des modernen Kapitalismus in Rußland werden ebenso leicht überwunden werden wir in den Vereinigten Staaten. Hier vergißt er ganz, daß die USA von allem Anfang an bourgeois waren; daß sie von Kleinbürgern und Bauers gegründet wurden, die dem europäischen Feudalismus entflohen, um eine rein bürgerliche Gesellschaft zu errichten. Dagegen haben wir in Rußland ein Fundament von primitiv-kommustistischem Charakter, eine noch aus der Zeit vor der Zivilisation stammende Gentilgesellschaft, die zwar schon in Trümmer fällt, aber immer noch als Fundament, als Material dient, auf und mit dem die kapitalistische Revolution (denn es ist eine wirkliche soziale Revolution) wirkt und operiert. In Amerika gibt es seit mehr als einem Jahrhundert Geldwirtschaft, in Rußland war fast ausnahmslos Naturalwirtschaft die Regel. Deshalb ist es selbstverständlich, daß die Umwälzung in Rußland weit heftiger, weit einschneidender und von unermeßlich größeren Leiden begleitet sein muß als in Amerika." (Brief Engels' an Nikolai-on v. 17. Oktober 1893. In: Briefe usw., S. 85.) [Engels an Nikolai Franzewitsch Danielson, 17. Oktober 1893. In Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 39, S. 148/149.]
153 l.c., S. 284.
154 Die reaktionäre Seite der deutschprofessoralen Theorie von den "drei Weltreichen" Großbritannien, Rußland und Vereinigte Staaten, zeigt u.a. deutlich Professor Schmoller in seiner handelspolitischen Säkularbetrachung, wo er mit Wehmut sein greises Gelehrtenhaupt über die "neumerkantilistischen", will sagen imperialistischen Gelüste der drei Hauptbösewichter schüttelt und für "die Ziele aller höheren geistigen, sittlichen und ästhetischen Kultur" sowie des "sozialen Fortschritts" - eine starke deutsche Flotte und einen europäischen Zollverein mit der Spitze gegen England und Amerika fordert: "Für Deutschland erwächst aus dieser weltwirtschaftlichen Spannung als erste Pflicht die, sich eine starke Flotte zu schaffen, um eventuell auch, für den Kampf gerüstet, als Bundesgenosse von den Weltmächten begehrt zu sein. Es kann und soll kein Eroberungspolitik wie die drei Weltmächte treiben (denen aber Herr Schmoller - wie er an anderer Stelle sagt - "keine Vorwürfe" machen will, "daß sie wieder in die Bahnen der riesenhaften Kolonialeroberungen einlenkten" - R. L.). Aber es muß eventuell eine fremde Blockade der Nordsee brechen, seine Kolonien und seinen großen Handel schützen, den Staaten, welche sich mit ihm verbünden, die gleiche Sicherheit. bieten können. Deutschland wie Österreich-Ungarn und Italien, zum Dreibund vereinigt, haben mit Frankreich die Aufgabe, der zu aggressiven, für alle mittleren Staaten bedrohlichen Politik der drei Weltmächte die Mäßigung aufzuerlegen, die im Interesse des politischen Gleichgewichts, im Interesse der Erhaltung aller anderen Staaten wünschenswert ist: nämlich die Mäßigung in der Eroberung, im Kolonieerwerb, in der einseitigen, überspannten Schuttzollpolitik, in der Ausbeutung und Mißhandlung aller Schwächeren ... Auch die Ziele aller höheren geistigen, sittlichen und ästhetischen Kultur, aller soziale Fortschritt hängt davon ab, daß im 20. Jahrhundert nicht die ganze Erde zwischen die drei Weltreiche aufgeteilt und von ihnen ein brutaler Neumerkantilismus begründet werde." (Die Wandlungen in der europäischen Handelspolitik des 19. Jahrhunderts. In: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft, XXIV. Jg. S. 381.)
155 S. Bulgakow: Über die Absatzmärkte der kapitalistischen Produktion. Eine theoretische Studie, Moskau 1897, S. 15.
156 l.c., S. 32, Fußnote.
157 l.c., S. 27.
158 l.c., S. 2/3.
159 l.c., S. 50-55.
160 l.c., S. 132 ff.
161 l.c., S. 20.
162 Hervorgehoben bei Bulgakow.
163 l.c., S. 161.
164 l.c., S. 167.
165 l.c., S. 210. Von uns hervorgehoben.
166 l.c., S. 238.
167 Bulgakow, l.c., S. 199.
168 K. Bücher: Entstehung der Volkswirtschaft, 5. Aufl., S. 147. Die neueste Leistung auf diesem Gebiete ist die Theorie des Professors Sombart, wonach wir nicht in die Weltwirtschaft hineinwachsen, sondern gar umgekehrt uns immer mehr von ihr entfernen: "Die Kulturvölker, so behaupte ich vielmehr, sind heute (im Verhältnis zu ihrer Gesamtwirtschaft) nicht wesentlich mehr, sondern eher weniger durch Handelsbeziehungen untereinander verknüpft. Die einzelne Volkswirtschaft ist heute nicht mehr, sondern eher weniger in den Weltmarkt einbezogen als vor hundert oder fünfzig Jahren. Mindestens aber ... ist es falsch anzunehmen, daß die internationalen Handelsbeziehungen eine verhältnismäßig wachsende Bedeutung für die moderne Volkswirtschaft gewinnen. Das Gegenteil ist richtig." Sombart wendet sich mit Hohn gegen die Annahme einer zunehmenden internationalen Arbeitsteilung, eines steigenden Bedürfnisses nach auswärtigen Absatzmärkten, dieweil der inländische Markt einer Ausdehnung nicht fähig sei; Sombart seinerseits ist überzeugt, daß "die einzelnen Volkswirtschaften immer vollkommenere Mikrokosmen werden und daß der innere Markt für alle Gewerbe den Weltmarkt immer mehr an Bedeutung überflügelt". (Die deutsche Volkswirtschaft im Neunzehnten Jahrhundert. 2. Aufl. 1909, S. 399-420.) - Diese niederschmetternde Entdeckung setzt freilich voraus, daß man das bizarre, nun dem Herrn Professor erfundene Schema annimmt, wonach als Ausfuhrland - man weiß nicht, weshalb - einzig und allein dasjenige Land gelten soll, das seine Einfuhr mit dem Überschuß an landwirtschaftlichen Produkten über den eigenen Bedarf, "mit Boden" bezahlt. Nach diesem Schema sind Rußland, Rumänien, die Vereinigten Staaten, Argentinien "Ausfuhrländer", Deutschland aber, England, Belgien nicht. Da die kapitalistische Entwicklung über kurz oder lang den Überschuß an Agrarprodukten auch in den Vereinigten Staaten und in Rußland für den inneren Bedarf in Anspruch nehmen dürfte, so ist es klar, daß es immer weniger "Ausfuhrländer" in der Welt gibt, die Weltwirtschaft verschwindet also. - Eine andere Entdeckung Sombarts ist, daß die großen kapitalistischen Länder, die ja keine "Ausfuhrländer" sind, ihre Einfuhr immer mehr "umsonst" kriegen - nämlich als Zinsen der ausgeführten Kapitalien. Für Professor Sombart zählt aber die Kapitalausfuhr ebenso wie die industrielle Warenausfuhr überhaupt nicht: "Mit der Zeit werden wir wohl dahin kommen einzuführen, ohne auszuführen." (l.c., S. 422.) Modern, sensationell und gigerlhaft.
169 l.c., S. 132.
170 l.c., S. 236. Noch resoluter formuliert dieselbe Ansicht W. Iljin: "Der Romantiker (so nennt er die Skeptiker - R. L.) sagt: Die Kapitalisten können den Mehrwert nicht konsumieren und müssen ihn deshalb im Ausland absetzen. Geben denn etwa, fragt er sich, die Kapitalisten ihre Produkte umsonst an die Ausländer ab oder werfen sie sie etwa ins Meer? Sie verkaufen sie, also erhalten sie ein Äquivalent; sie fuhren Produkte aus, also führen sie andere ein." "Ökonomische Studien und Artikel, S. 26.) [W. I. Lenin: Zur Charakteristik der ökonomischen Romantik. In: Werke. Bd. 2, S. 156.] Im übrigen gibt Iljin eine viel richtigere Erklärung für die Rolle des auswärtigen Handels in der kapitalistischen Produktion als Struve und Bulgakow.
171 Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England, Jena 1901, S. 25.
172 l.c., S. 34.
173 l.c., S. 33.
174 l.c., S. 191.
175 l.c., S. 231. Hervorhebung im Original.
176 l.c., S. 35.
177 l.c., S. 191.
178 l.c., S. 27.
179 l.c., S. 58.
180 Wladimir Iljin: Ökonomische Studien und Artikel. Zar Charakteristik des ökonomischen Romantizismus, Petersburg 1899, S. 20. [W. I. Lenin: Zur Charakteristik der ökonomischen Romantik. In: Werke, Bd. 2, S. 149.] Demselben Verfasser gehört übrigens die Behauptung, daß die erweiterte Reproduktion erst mit dem Kapitalismus beginnt. Iljin hat nicht bemerkt, daß wir mit der einfachen Reproduktion, die er als Gesetz für alle vorkapitalistischen Produktionsweisen annimmt, wahrscheinlich heute noch über den paläolithischen Schaber nicht hinaus wären.
181 Krisentheorien. In: Die Neue Zeit. 20. Jg., Zweiter Band, S. 116. Wenn K. Kautsky durch die Fortsetzung des Schemas der erweiterten Reproduktion Tugan ziffernmäßig beweist, daß die Konsumtion unbedingt wuchsen müsse, und zwar "genau in demselben Verhältnis wie die Wertmasse der Produktionsmittel", so ist dazu zweierlei zu bemerken. Erstens ist dabei von Kautsky, wie auch von Marx in seinem Schema, der Fortschritt der Produktivität der Arbeit nicht berücksichtigt, wodurch die Konsumtion relativ größer erscheint als der Wirklichkeit entsprechen würde. Zweitens aber ist das Wachstum der Konsumtion, auf das Kautsky hier verweist, selbst Folge, Ergebnis der erweiterten Reproduktion, nicht ihre Grundlage und ihr Zweck, es ergibt sich in der Hauptsache aus dem gewachsenen variablen Kapital, aus der wachsenden Verwendung neuer Arbeiter. Die Erhaltung dieser Arbeiter kann aber nicht als Zweck und Aufgabe der Erweiterung der Reproduktion betrachtet werden, sowenig übrigens wie die zunehmende persönliche Konsumtion der Kapitalistenklasse. Der Hinweis Kautskys schlägt also wohl die Spezialschrulle Tugans zu Boden: den Einfall, eine erweiterte Reproduktion bei absoluter Abnahme der Konsumtion zu konstruieren; er geht hingegen nicht auf die Grundfrage des Verhältnisses von Produktion zur Konsumtion vom Standpunkte des Reproduktionsprozesse ein. Wir lesen zwar an einer anderen Stelle desselben Aufsatzes: "Die Kapitalisten und die von ihnen ausgebeuteten Arbeiter bilden einen mit der Zunahme des Reichtums der ersteren und der Zahl der letzteren zwar stets wachsenden, aber nicht so rasch wie die Akkumulation des Kapitals und die Produktivität der Arbeit anwachsenden und für sich allein nicht ausreichenden Markt für die von der kapitalistischen Großindustrie geschaffenen Konsummittel. Diese muß einen zusätzlichen Markt außerhalb ihres Bereiches in den noch nicht kapitalistisch produzierenden Berufen und Nationen suchen. Den findet sie auch, und sie erweitert ihn ebenfalls immer mehr, aber ebenfalls nicht rasch genug. Denn dieser zusätzliche Markt besitzt bei weitem nicht die Elastizität und Ausdehnungsfähigkeit des kapitalistischen Produktionsprozesses. Sobald die kapitalistische Produktion zur entwickelten Großindustrie geworden ist, wie dies in England schon im ersten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts der Fall war, erhält sie die Möglichkeit derartiger sprunghafter Ausdehnung, daß sie jede Erweiterung des Marktes binnen kurzem überholt. So ist jede Periode der Prosperität, die einer erheblichen Erweiterung des Marktes folgt, von vornherein zur Kurzlebigkeit verurteilt, und die Krise wird ihr notwendiges Ende. Dies in kurzen Zügen die, soweit wir sehen, von den 'orthodoxen' Marxisten allgemein angenommen, von Marx begründete Krisentheorie." (l.c., S. 80.) Kautsky befaßt sich aber damit nicht, die Auffassung von der Realisierung des Gesamtprodukts mit dem .Marxschen Schema der erweiterten Reproduktion in Einklang zu bringen, vielleicht aus dem Grunde, weil er, wie auch das Zitat zeigt, das Problem ausschließlich unter dem Gesichtswinkel dar Krisen, d.h. vom Standpunkte des gesellschaftlichen Produkts als einer unterschiedslosen Warenmasse in ihrer Gesamtmenge, nicht unter dem Gesichtswinkel seiner Gliederung im Reproduktionsprozeß, behandelt, An diese letztere Frage tritt anscheinend näher L. Boudin heran, der in seiner glänzenden Kritik desselben Tugan-Baranowski die Formulierung gibt: "Das in den kapitalistischen Ländern produzierte Mehrprodukt hat - mit einigen später zu erwähnenden Ausnahmen - nicht darum die Räder den Produktion in ihrem Lauf gehemmt, weil die Produktion geschickter in die verschiedenen Sphären verteilt wurden ist oder weil aus der Produktion von Baumwollwaren eine Produktion von Maschinen geworden ist, sondern deshalb, weil auf Grund der Tatsache, daß sich einige Länder früher kapitalistisch umentwickelt haben als andere und daß es auch jetzt noch einige kapitalistisch unentwickelt gebliebene gibt, die kapitalistischen Länder wirklich eine außerhalb liegende Welt haben, in welche sie die von ihnen nicht selbst zu verbrauchenden Produkte hineinwerfen konnten, gleichviel, ob diese Produkte nun in Baumwoll- oder Eisenwaren bestanden. Damit soll durchaus nicht gesagt sein, daß die Wandlung von den Baumwoll- zu den Eisenwaren als führendem Produkt der hauptsächlichen kapitalistischen Länder etwa bedeutungslos wäre. Im Gegenteil, sie ist von der größten Wichtigkeit. Aber ihre Bedeutung ist eine ganz andere, als Tugan-Baranowski ihr beilegt. Sie zeigt den Anfang vom Ende des Kapitalismus. Solange die kapitalistischen Länder Waren zur Konsumtion ausführten, solange war noch Hoffnung für den Kapitalismus in jenen Ländern. Da war noch nicht die Rede davon, wie groß die Aufnahmefähigkeit der nichtkapitalistischen Außenwelt für die kapitalistisch produzierten Waren wäre und wie lange sie noch dauern würde. Das Anwachsen der Maschinenfabrikation im Export der kapitalistischen Hauptländer auf Kosten der Konsumtionsgüter zeigt, daß Gebiete, welche früher abseits vom Kapitalismus standen und deshalb als Abladestelle für sein Mehrprodukt dienten, nunmehr in das Getriebe des Kapitalismus hineingezogen worden sind, zeigt, daß, da ihr eigener Kapitalismus sich entwickelt, sie ihre eigenen Konsumtionsgüter selbst produzieren. Jetzt, wo sie erst im Anfangsstadium ihrer kapitalistischen Entwicklung sind, brauchen sie noch die kapitalistisch produzierten Maschinen. Aber bald genug werden sie sie nicht mehr brauchen. Sie werden ihre eigenen Eisenwaren produzieren, genauso wie sie jetzt ihre eigenen Baumwoll- und andere Konsumtionswaren erzeugen. Dann werden sie nicht nur aufhören, eine Aufnahmestelle für das Mehrprodukt der eigentlichen kapitalistischen Länder zu sein, vielmehr werden sie selbst ein Mehrprodukt erzeugen, das sie nur schwer unterbringen können." (Mathematische Formeln gegen Karl Marx. In: Die Neue Zeit, 25 Jg. Erster Band, S. 604.) Baudin gibt hier sehr wichtige Ausblicke auf die großen Verknüpfungen in der Entwicklung des internationalen Kapitalismus. Weiter kommt er in diesem Zusammenhang logisch auf die Frage des Imperialismus. Leider spitzt er seine scharfe Analyse zum Schluß nach einer falschen Seite zu, indem er die ganze militärische Produktion und das System der internationalen Kapitalausfuhr nach nichtkapitalistischen Ländern unter den Begriff der "Verschwendung" bringt. - Im übrigen ist festzustellen, daß Boudin, genau wie Kautsky, das Gesetz des rascheren Wachstums der Abteilung der Produktionsmittel im Vergleich zur Abteilung der Lebensmittel für eine Täuschung Tugan-Baranowskis hält.
182 "Abgesehn von Naturbedingungen, wie Fruchtbarkeit des Bodens usw. und vom Geschick unabhängig und isoliert arbeitender Produzenten, das sich jedoch mehr qualitativ in der Güte als quantitativ in der Masse des Machwerks bewährt, drückt sich der gesellschaftliche Produktivgrad der Arbeit aus im relativen Größenumfang der Produktionsmittel, welche ein Arbeiter, während gegebener Zeit mit derselben Anspannung von Arbeitskraft, in Produkt verwandelt. Die Masse der Produktionsmittel, womit er funktioniert, wächst mit der Produktivität seiner Arbeit. Diese Produktionsmittel spielen dabei eine doppelte Rolle. Das Wachstum der einen ist Folge, das der andren Bedingung der wachsenden Produktivität der Arbeit. Z.B. mit der manufakturmäßigen Teilung der Arbeit und der Anwendung von Maschinerie wird in derselben Zeit mehr Rohmaterial verarbeitet, tritt also größere Masse von Rohmaterial und Hilfsstoffen in den Arbeitsprozeß ein. Das ist die Folge der wachsenden Produktivität der Arbeit. Andrerseits ist die Masse der angewandten Maschinerie, Arbeitsviehs, mineralischen Düngers, Drainierungsröhren usw. Bedingung der wachsenden Produktivität der Arbeit. Ebenso die Masse der in Baulichkeiten, Riesenöfen, Transportmitteln usw. konzentrierten Produktionsmittel. Ob aber Bedingung oder Folge, der wachsende Größenumfang der Produktionsmittel im Vergleich zu der ihnen einverleibten Arbeitskraft drückt die wachsende Produktivität der Arbeit aus. Die Zunahme der letzteren erscheint also in der Abnahme der Arbeitsmasse verhältnismäßig zu der von ihr bewegten Masse von Produktionsmitteln oder in der Größenabnahme des subjektiven Faktors des Arbeitsprozesses, verglichen mit seinen objektiven Faktoren." (Das Kapital, Bd. I, S. 586.) [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/ Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 650/651.] Und noch an einer anderen Stelle: "Man hat früher gesehn, daß mit der Entwicklung der Produktivität der Arbeit, also auch mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise - welche die gesellschaftliche Produktivität der Arbeit mehr entwickelt als alle früheren Produktionsweisen -, die Masse der in der Form von Arbeitsmitteln dem Prozeß ein für allemal einverleibten und stets wiederholten, während längrer oder kürzrer Periode in ihm fungierenden Produktionsmittel (Gebäude, Maschinen etc.) beständig wächst und daß ihr Wachstum sowohl Voraussetzung wie Wirkung der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit ist. Das nicht nur absolute, sondern relative Wachstum des Reichtums in dieser Form (vgl. Buch I, Kap. XXIII, 2.) charakterisiert vor allem die kapitalistische Produktionsweise. Die stofflichen Existenzformen des konstanten Kapitals, die Produktionsmittel, bestehn aber nicht nur aus derartigen Arbeitsmitteln, sondern auch aus Arbeitsmaterial auf den verschiedenen Stufen der Verarbeitung und aus Hilfsstoffen. Mit der Stufenleiter der Produktion und der Steigerung der Produktivkraft der Arbeit durch Kooperation, Teilung, Maschinerie usw. wächst die Masse des Rohmaterials, der Hilfsstoffe etc., die in den täglichen Reproduktionsprozeß eingehn" (Das Kapital, Bd. II. S. 112.) [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 142/143.]
183 In einer 1901 herausgegebenen Sammlung seiner russischen Aufsätze sagt Struve in der Einleitung: "Im Jahre 1894, als der Verfasser seine 'Kritischen Bemerkungen zur Frage der ökonomischen Entwicklung Rußlands' veröffentlichte, war er in der Philosophie kritischer Positivist, in der Soziologie und Nationalökonomie ausgesprochener, wenn auch durchaus nicht orthodoxer Marxist. Seitdem haben sowohl der Positivismus wie der auf ihn gestützte (!) Marxismus aufgehört, für den Verfasser die ganze Wahrheit zu sein, haben aufgehört, seine Weltanschauung völlig zu bestimmen. Er sah sich genötigt, auf eigene Faust ein neues Gedankensystem zu suchen und auszuarbeiten. Der bösartige Dogmatismus, der Andersdenkende nicht nur widerlegt, sondern sie auch noch moralisch-psychologisch spioniert, erblickt in einer solchen Arbeit nur 'epikureische Flatterhaftigkeit des Sinnes'. Er ist nicht imstande zu begreifen, daß das Recht der Kritik an sich eins der teuersten Rechte des lebendigen, denkenden Individuums ist. Auf dieses Recht gedenkt der Verfasser nicht zu verzichten, und sollte ihm auch ständig die Gefahr drohen, unter der Anklage der 'Unbeständigkeit' zu stehen." (Über verschiedene Themen, Petersburg 1901.)
184 Siehe Bulgakow: l.c., S. 252.
185 Tugan-Baranowski: Studien [zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England], S. 229.
186 "Es sind nie die originellen Denker, welche die absurden Konsequenzen ziehn. Sie überlassen das den Says und MacCullochs." (Das Kapital, Bd. II, S. 365.) [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24 S. 389.] und den Tugan-Baranowskis, fügen wir hinzu.
187 Die Zahlen ergeben sich als Differenz zwischen der von uns bei fortschreitender Technik angenommenen Größe des konstanten Kapitals der Abt. I und der im Marxschen Schema (Das Kapital, Bd. II, S. 496) [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 514.] bei unveränderter Technik gesetzten Größe.
188 Theorien, Bd. II, Teil 2, S. 252. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 485.]
189 Das Kapital Bd. III, Teil 1. S. 224 ff. [Karl Marx: Das Kapital, Dritter Band. In Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 25, S. 253-255.]
190 Theorien, Bd. II, Teil 2, S. 305. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 525.]
191 Das Kapital Bd. III, Teil 1. S. 289. [Karl Marx: Das Kapital, Dritter Band. In Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 25, S. 316/317.]
192 "Je größer das Kapital, je entwickelter die Produktivität der Arbeit, überhaupt die Stufenleiter der kapitalistischen Produktion, um so größer auch die Masse der Waren, die sich in dem Übergang aus der Produktion in die Konsumtion (individuelle und industrielle), in Zirkulation, auf dem Markt befinden, und um so größer die Sicherheit für jedes besondre Kapital, seine Reproduktionsbedingungen fertig auf dem Markt vorzufinden." (Marx: Theorien über den Mehrwert, Bd. II, Teil 2, S. 251.) [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 484.]
193 Theorien über den Mehrwert, Bd. II, Teil 2, S. 250, "Akkumulation von Kapital und Krisen". Hervorgehoben bei Marx. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 483, 484 u. 485.]
194 Dir Wichtigkeit der Baumwollindustrie für den englischen Export ist aus folgenden Zahlen ersichtlich: 1893: Gesamtexport von Fabrikaten 5.540 Mill. Mark; davon Baumwollwaren 1.280 Mill. Mark = 23 Prozent, Eisen- und sonstige Metallwaren nicht ganz 17 Prozent. 1898: Gesamtexport von Fabrikaten 4.668 Mill. Mark; davon Baumwollwaren 1.300 Mill. Mark = 28 Prozent, Eisen- und Metallwaren 22 Prozent. Verglichen damit ergeben die Zahlen für das Deutsche Reich 1898 Gesamtexport 4.010 Mill. Mark; davon Baumwollwaren 231,9 Mill Mark = 53/4 Prozent. Die Länge der 1898 exportierten Baumwollstückware betrug 51/4 Milliarden Yards, vor denen 21/4 Milliarden nach Vorderindien gingen. (E. Jaffé: Die englische Baumwollindustrie und die Organisation des Exporthandels. In: Schmollers Jahrbücher [Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft], XXIV. Jg., S. 1033.) 1908 betrug die britische Ausfuhr an Baumwollgarn allein 262 Mill. Mark. (Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1910.)
195 Von den deutschen Teerfarbstoffen geht z.B. ein Fünftel, vom Indigo die Hälfte nach Ländern wie China, Japan, Britisch-Indien, Ägypten, asiatische Türkei, Brasilien, Mexiko.
196 Das Kapital, Bd. I, S. 567. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 630/631.]
197 Die jüngsten Enthüllungen des englischen Blaubuchs über die Praxis der Peruvian Amazon Co. Ltd. in Putumayo haben gezeigt, daß das internationale Kapital sogar ohne die politische Form der Kolonialherrschaft, auf dem Gebiet der freien Republik Peru, die Eingeborenen in ein an Sklaverei grenzendes Verhältnis zu sich zu bringen weiß, um dadurch Produktionsmittel aus primitiven Ländern im Raubbau größten Stils an sich zu raffen. Seit 1900 hatte die genannte Gesellschaft englischer und exotischer Kapitalisten etwa 4.000 Tonnen Putumayokautschuk auf den Londoner Markt geworfen. In der gleichen Zeit sind 30.000 Eingeborene umgebracht und von den 10.000 Überlebenden die Mehrzahl zu Krüppeln geschlagen worden.
198 Das Kapital, Bd. I, S. 544. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 607.] Ähnlich an einer anderen Stelle: "Zunächst ist also ein Teil des Mehrwerts (und des ihm in Lebensmitteln entsprechenden surplus produce) in variables Kapital zu verwandeln; d.h., neue Arbeit ist damit zu kaufen. Dies ist nur möglich, wenn die Zahl der Arbeiter wächst oder wenn die Arbeitszeit, während der sie arbeiten, verlängert wird ... Dies jedoch nicht als konstantes Mittel der Akkumulation anzusehn. Die Arbeiterbevölkerung kann zunehmen, wenn vorhin unproduktive Arbeiter in produktive verwandelt werden oder Teile der Bevölkerung, die früher nicht arbeiteten, wie Weiber und Kinder, Paupers, in den Produktionsprozeß gezogen werden. Letztren Punkt lassen wir hier weg. Endlich durch absolutes Wachstum der ... Bevölkerung. Soll die Akkumulation ein stetiger, fortlaufender Prozeß sein, so dies absolute Wachstum der Bevölkerung (obgleich sie relativ gegen das angewandte Kapital abnimmt) Bedingung. Vermehrung der Bevölkerung erscheint als Grundlage der Akkumulation als eines stetigen Prozesses. Dieses setzt aber voraus ein avarage Salair, das beständige Wachstum der Arbeiterbevölkerung, nicht nur Reproduktion derselben erlaubt." (Theorien über den Mehrwert, Bd. II, Teil 2, Kapitel: Verwandlung von Revenue in Kapital, S. 243.) [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 478.]
199 Eine kurz vor denn Sezerssonskriege in den Vereinigten Staaten veröffentlichte Tabelle enthielt folgende Angaben über den Wert der jährlichen Produktion der Sklavenstaaten und die Zahl der beschäftigten Sklaven, von denen die übergroße Mehrzahl auf den Baumwollplantagen arbeitetet:
| Baumwolle | Sklaven | |
| 1800 | 5,2 Mill. Doll. | 893.041 |
| 1810 | 15,1 Mill. Doll. | 1.191.364 |
| 1820 | 26,3 Mill. Doll. | 1.543.688 |
| 1830 | 34,1 Mill. Doll. | 2.009.053 |
| 1840 | 74,6 Mill. Doll. | 2.487.255 |
| 1850 | 111,8 Mill. Doll. | 3.179.509 |
| 1851 | 137,3 Mill. Doll. | 3.200.300 |
(Simons: Klassenkämpfe in der Geschichte Amerikas. Ergänzungsheft der "Neuen Zeit", Nr. 7, S. 39.)
200 Ein Musterbeispiel solcher Mischformen schildert der frühere englische Minister Bryce in den süd-afrikanischen Diamantgruben. "Die interessanteste Sehenswürdigkeit Kimberleys, die einzig in der Welt dasteht, sind die beiden sogen. 'Compounds', wo die in den Bergwerken beschäftigten Eingeborenen beherbergt und eingesperrt werden. Es sind ungeheure Einfriedungen ohne Dach, aber mit einem Drahtnetz überspannt, um zu verhindern, daß etwas über die Mauern geworfen wird. Ein unterirdischer Gang führt zu dem benachbarten Bergwerk. Es wird in drei 8stündigen Schichten gearbeitet, so daß der Arbeiter nie länger als 8 Stunden hintereinander unter der Erde ist. An der Innenseite der Mauer sind Hütten errichtet, wo die Eingeborenen wohnen und schlafen. Auch ein Hospital ist innerhalb der Umfriedung vorhanden sowie eine Schule, wo die Arbeiter in ihrer freien Zelt lesen und schreiben lernen können. Geistige Getränke werden nicht verkauft. - Alle Eingänge werden streng bewacht, und keine Besucher, weder Eingeborene noch Weiße, erhalten Zutritt; die Lebensmittel werden von einem innerhalb der Mauern befindlichen, der Gesellschaft gehörigen Laden geliefert. Das Compound der De Beers-Grube beherbergte zur Zeit meines Besuches 2.600 Eingeborene aller möglichen Stämme, so daß man dort Exemplare der verschiedensten Negertypen von Natal und Pondoland im Süden bis zum Tanganjikasee im fernen Osten sehen konnte. Sie kommen von allen Himmelsrichtungen, durch die hohen Löhne, gewöhnlich 18-30 M die Woche, herbeigelockt, und bleiben dort 3 Monate und länger, zuweilen sogar für lange Zeit ... In diesem weiten, rechteckigen Compound sieht man Zulus aus Natal, Fingos Pondos, Tembus, Basutos, Betschuanas, Untertanen Gungunhanas aus den portugiesischen Besitzungen, einige Matabeles und Makalakas und viele sog. Zambesi-Boys von den an beiden Ufern dieses Flusses wohnenden Stämmen. Sogar Buschmänner oder wenigstens Eingeborene, die von Buschmännern stammen, fehlen nicht. Sie wohnen friedlich zusammen und vergnügen sich in ihren freien Stunden auf ihre Art. Außer Glücksspielen sahen wir noch ein Spiel, das, dem englischen 'Fuchs und Gänse' ähnlich, mit Steinen auf einem Brett gespielt wird; auch Musik wurde auf zwei primitiven Instrumenten gemacht; auf dem sog. Kaffernklavier, das aus ungleich langen, nebeneinander in einem Rahmen befestigten Eisenplättchen besteht, und auf einem noch kunstloseren Instrument, aus ungleich langen, harten Holzstückchen gefertigt, denen man durch Anschlagen verschiedene Töne, die Rudimente einer Melodie entlocken kann. Einige wenige lasen oder schrieben Briefe, die übrigen waren mit Kochen oder Schwatzen beschäftigt. Manche Stämme schwatzen ununterbrochen und man kann in dieser seltsamen Negerretorte ein Dutzend Sprachen hören, wenn man von Gruppe zu Gruppe geht." Die Neger pflegen nach mehreren Monaten Arbeit mit ihrem aufgesparten Lohn das Bergwerk zu verlassen, um zu ihrem Stamme zurückzukehren, sich für das Geld eine Frau zu kaufen und wieder in ihren hergebrachten Verhältnissen zu leben. (James Bryce: Impressions of South Africa, 1897, deutsche Ausgabe 1900, S. 206.) Ebenda siehe auch die recht lebendige Schilderung der Methoden wie man in Südafrika die "Arbeiterfrage" löst. Wir erfahren da, daß man die Neger zur Arbeit in den Bergwerken und Plantagen in Kimberley, in Witwatersrand, in Natal, im Matabeleland zwingt dadurch, daß man ihnen alles Land und alles Vieh, d.h. die Existenzmittel nimmt, sie proletarisiert, sie auch mit Branntwein demoralisiert (später, als sie schon in der "Einfriedung" des Kapitals sind, werden ihnen, die an Alkohol erst gewöhnt worden, "geistige Getränke" streng verboten: Das Ausbeutungsobjekt muß in brauchbarem Zustand erhalten werden.), schließlich einfach mit Gewalt, Gefängnis, Auspeitschung in das "Lohnsystem" des Kapitals preßt.
201 Typisch für diese Beziehung ist das Verhältnis von Deutschland und England.
202 Nachdem er in seiner Geschichte Britisch-Indiens die Zeugnisse aus den verschiedensten Quellen, aus Mungo Park, Herodot, Volney, Acosta, Garcilaso de la Vega, Abbé Grosier, Barrow, Diodorus, Strabo u.a., wahllos und kritiklos zusammengeschleppt hat, um den Satz zu konstruieren, daß in primitiven Verhältnissen der Grund und Boden stets und überall Eigentum des Herrschers war, zieht Mill durch Analogie auch für Indien den folgenden Schluß: "From these facts only one conclusion can be drawn, that the property of the soil resided in the sovereign, for if it did not reside in him, it will be impossible to show to whom it belonged." (James Mill: The History of British-India, Bd. I, 4. Aufl., 1840. S. 311) Zu dieser klassischen Schlußfolgerung des bürgerlichen Ökonomen gibt sein Herausgeber H. H. Wilson, der als Professor des Sanskrit an der Universität in Oxford genauer Kenner der altindischen Rechtsverhältnisse war, einen interessanten Kommentar. Nachdem er schon in der Vorrede seinen Autor als einen Parteigänger charakterisiert, der die ganze Geschichte Britisch-Indiens zur Rechtfertigung der theoretical views of Mr. Bentham zurechtgestutzt und dabei mit zweifelhaftesten Mitteln ein Zerrbild des Hinduvolkes gezeichnet hätte (a portrait of the Hindus which has no resemblance whereever to the original, and which almost outrages humanity), macht er die folgende Fußnote: "The greater part of the text and of the notes here is wholly irrelevant. The illustrations drawn from Mahometans practice, supposing them to be correct, have nothing to do with the laws and rights of the Hindus. They are not, however, even accurate, and Mr. Mill's guides have misled him." Wilson bestreitet dann rundweg speziell in bezug auf Indien die Theorie von dem Eigentumsrecht des Souveräns auf Grund und Boden. (Siehe l.c., S. 305, Fußnote.) Auch Henry Maine meint, daß die Engländer ihren anfänglichen Anspruch auf den gesamten Grundbesitz in Indien, den Maine wohl als grundfalsch erkennt, von ihren muselmanischen Vorgängern übernommen hätten: "The assumption which the English first made was one which they inherited from their Mahometan predecessors. It was, that all the soil belonged in absolute property to the sovereign, and that all private property in land existed by his sufferance. The Mahometan theory and the corresponding Mahometan practice had put out of sight the ancient view of the sovereign's rights, which though it assigned to him a far larger share of the produce of the land than any western ruler has ever claimed, yet in nowise denied the existence of private property in land" (Village communities in the East and West, 5. Aufl., 1890. 104). Maxim Kowalewski hat demgegenüber gründlich nachgewiesen, daß die angebliche "muselmännische Theorie und Praxis" bloß eine englische Fabel war. (Siehe seine ausgezeichnete Studie in russischer Sprache: Das Gemeineigentum an Grund und Boden. Ursachen, Verlauf und Folgen seiner Zersetzung. Teil I, Moskau 1879.) Die englischen Gelehrten wie übrigens auch ihre französischen Kollegen halten jetzt zum Beispiel an einer analogen Fabel in bezug auf China fest, indem sie behaupten, alles Land sei dort Eigentum des Kaisers gewesen. Siehe die Widerlegung dieser Legende bei Dr. O. Franke: Die Rechtsverhältnisse am Grundeigentum in China. 1903.)
203 "The partition of inheritance and execution for debt levied on land are destroying the communities - this is the formla heard now-a-days everywhere in India." Henry Maine: l.c., S.113.)
204 Diese typische Beleuchtung der offiziellen britischen Politik in den Kolonien findet man z.B. bei dem langjährigen Vertreter der englischen Macht in Indien, Lord Roberts of Kandahar, der zur Erklärung des Sepoyaufstandes nichts anderes anzuführen weiß als lauter "Mißverständnisse" über die väterlichen Absichten der englischen Regenten: "Der Siedelungskommission warf man fälschlicherweise Ungerechtigkeit vor, wenn sie, wie es ihre Pflicht war, die Berechtigung von Landbesitz und auch die Führung von damit verbundenen Titeln kontrollierte, um dann den rechtmäßigen Besitzer eines Grundstücks zur Grundsteuer heranzuziehen ... Nachdem Frieden und Ordnung hergestellt war, mußte der Landbesitz, welcher teilweise durch Raub und Gewalt erlangt war, wie das unter den eingeborenen Regenten und Dynastien die Gewohnheit ist, geprüft werden. Unter diesen Gesichtspunkten wurden Erörterungen angestellt in bezug auf Besitzrecht usw. Das Resultat dieser Untersuchungen war, daß viele Familien von Rang und Einfluß sich einfach das Eigentum ihrer weniger angesehenen Nachbarn angeeignet hatten oder sie zu einer Steuer heranzogen, die ihrem Landbesitz entsprach. Das wurde in gerechter Weise abgeändert. Obwohl diese Maßregel mit großer Rücksicht und in der besten Meinung getroffen wurde, war sie doch den höheren Klassen äußerst unangenehm, während es nicht gelang, die Massen zu versöhnen. Die regierenden Familien nahmen uns die Versuche, eine gerechte Verteilung der Rechte und gleichmäßige Besteuerung des Landbesitzes herbeizuführen, gehörig übel ... Obwohl auf der anderen Seite die Landbevölkerung durch unsere Regierung bessergestellt wurde, kam sie doch nicht zur Erkenntnis, daß wir beabsichtigten, durch alle diese Maßregeln ihre Lage zu bessern." (Forty one years in India, Bd. I, deutsche Ausgabe 1904, S. 307.)
205 In den Regierungsmaximen Timurs (1783 aus dem Persischen ins Englische übersetzt, hieß es "And I commanded that they should build places of worship, and monasteries in every city; and that they should erect structures for the reception of travellers on the high roads and that they should make bridges across the rivers. An I commanded that the ruined bridges should be repaired and that bridges should be constructed over the rivulets and over the rivers; and that on the roads, at the distance of one stage from each other, Kauruwansarai should be erected, and that guards and watchers &c. should be stationed on the road, and that in every Kauruwansarai people should be appointed to reside etc. And I ordained, whoever undertook the cultivation of waste lands, or build an aqueduct, or made a canal or planted a grove, or restored to culture a deserted district, that in the first year nothing should be taken from him, and that in the second year, whatever the subject voluntarily offered should be received, and that in the third year the duties, should he collected according to the regulation." (James Mill: The History of British India, Bd. II. 4. Aufl., S. 492-498.)
206 Graf Warren: De l'état moral de la population indigène. Zit. bei: Kowalewski: l.c., S. 164.
207 Historical and descriptive account of British India from the most remote period to the conclusion of the Afghan war by Hugh Marray, James Wilson, Greville, Prof. Jameson, William Wallace and Captain Dalrymple, Bd. II, 4. Aufl., Edinburgh 1843, S. 427. Zit. bei Kowalewski: l.c.
208 Siehe Victor v. Leyden: Agrarverfassung und Grundsteuer in Britisch-Ostindien In: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, XXXVI. Jg., Heft 4, S. 1855.
209 "Presque toujours, le père de famille en mourant recommande à ses descendants de vivre dans l'indivision, suivant l'exemple de leurs aïeux t'est là sa dernière exhortation et son vœu le plus cher." (A. Hanotaux et A. Letourneux: La Kabylie et les coutumes Kabyles Bd. 1; Droit civil, 1873, S. 468-473.) Die Verfasser bringen es übrigens fertig, die oben wiedergegebene frappante Schilderung des Großfamilienkommunismus mit der folgenden Sentenz einzuleiten: "Dans la ruche laborieuse de la famille associée, tous sont réunis dans un but commun, tous travaillent dans un intérêt général; mais nul n'abdique sa liberté et ne renonce à ses droits héréditaires. Chez aucune nation on ne trouve de combinaison qui soit plus près de l'égalité et plus loin du communisme!"
210 "Wir müssen uns beeilen", erklärte in der Nationalversammlung 1851 der Abgeordnete Didier als Berichterstatter, "die Geschlechtsverbände aufzulösen, denn sie sind der Hebel jeder Opposition gegen unsere Herrschaft."
211 Zit. bei: Kowalewski: l.c., S. 217. Bekanntlich ist in Frankreich seit der großen Revolution Mode, jede Opposition gegen die Regierung als offene oder versteckte Verteidigung des "Feudalismus" zu bezeichnen.
212 Vgl. G. K. Anton: Neuere Agrarpolitik in Algerien und Tunesien. In: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 1900, S. 1341 ff.
213 In seiner Rede am 20. Juni 1912 in der französischen Abgeordnetenkammer führte der Berichterstatter der Kommission für die Reform des "Indigenants" (der administrativen Justiz) in Algerien, Albin Rozet, die Tatsache an, daß aus dem Bezirk Setif Tausende Algerier emigrieren. Aus Tlemcen sind im vergangenen Jahre in einem Monat 1.200 Eingeborene ausgewandert. Das Ziel der Auswanderung ist Syrien. Ein Auswanderer schrieb aus der neuen Heimat: "Ich habe mich jetzt in Damaskus niedergelassen und bin vollkommen glücklich. Wir sind hier in Syrien zahlreiche Algerier, die gleich mir ausgewandert sind und denen die Regierung Grund und Boden bewilligt sowie die Mittel zu seiner Bearbeitung erleichtert hat." Die algerische Regierung bekämpft die Auswanderung in der Weise, daß sie - die Pässe verweigert. (Siehe Journal officiel vom 21. Juni 1912, S. 1594 ff.)
214 1854 wurden 77.379 Kisten eingeführt. Später geht die Einfuhr angesichts der Ausbreitung der heimischen Produktion ein wenig zurück. Trotzdem bleibt China der Hauptabnehmer der indischen Plantagen. 1873/1874 wurden in Indien 6,4 Millionen Kilogramm Opium produziert, davon 6,1 Millionen Kilogramm an die Chinesen abgesetzt. Jetzt noch werden von Indien jährlich 4,8 Kilogramm im Werte von 150 Millionen Mark fast ausschließlich nach China und dem Malaiischen Archipel ausgeführt.
215 Angeführt bei Schreibert: Der Krieg in China, 1903, S. 170.
216 Schreibert:, l.c., S. 207.
217 Ein kaiserliches Edikt vom 3. Tage des 1. Mondes im 10. Jahre Hsien-Feng (6. September 1860) sagt u.a.: "Wir haben weder England noch Frankreich jemals untersagt, mit China Handel zu treiben, und lange Jahre hat zwischen jenen und uns Friede gewaltet. Aber vor drei Jahren sind die Engländer in übler Absicht in unsere Stadt Kanton eingedrungen und haben unsere Beamten in Gefangenschaft hinweggeführt. Wir sahen damals von Wiedervergeltung und Maßregeln ab, weil wir anzuerkennen gezwungen waren, daß die Hartnäckigkeit des Vizekönigs Yeh in gewissen Grade eine Veranlassung zu den Feindseligkeiten gegeben hatte. Vor zwei Jahren kam der Barbarenanführer Elgin gen Norden, und wir befahlen dem Vizekönig von Tschi-li, T'an Ting-Hsiang, die Sachlage zu prüfen, ehe man zu Unterhandlungen schritte. Aber der Barbar benutzte unsere unvorbereitete Lage, griff die Takuforts an und ging auf Tientsin vor. Besorgt, unserem Volke die Kriegsschrecknisse zu ersparen, sahen wir abermals von Vergeltung ab und befahlen dem Kuel-Liang, über Frieden zu verhandeln. Trotz der schmählichen Forderungen der Barbaren befahlen wir dem Kuel-Liang darauf, sich nach Schanghai wegen des vorgeschlagenen Handelsvertrages zu begeben, und haben sogar dessen Ratifikation als Zeichen unserer bona fides verstattet. Dessen nicht geachtet, entwickelte der Barbarenführer Bruce neuerdings eine Halsstrarrigkeit unvernünftigster Art und erschien im 8. Monde mit einem Geschwader von Kriegsschiffen auf der Takureede. Daraufhin griff ihn Seng Ko Liu Ch'in heftig an und zwang ihn so schleunigem Rückzug. Aus allem diesem geht hervor, daß China keinen Vertrauensbruch begangen hat und daß die Barbaren im Unrecht gewesen sind. Im laufenden Jahre sind nun die Barbarenchefs Elgin und Gros neuerlich an unseren Küsten erschienen, aber China, unlustig, zu äußersten Maßregeln zu greifen, gestattete ihnen die Landung und ihren Besuch in Peking zwecks Ratifikation des Vertages. Wer hätte es glauben können, daß während dieser ganzer Zeit die Barbaren nichts als Ränke gesponnen haben, daß sie ein Heer von Soldaten und Artillerie mir sich führten, mit denen sie die Takuforts von rückwärts angegriffen haben und nach Vertreibung der Besatzung auf Tientsin marschiert sind!" (China unter der Kaiserin-Wltwe, Berlin 1912, S. 25. Vgl. auch in dem genannten Werk das ganze Kapitel "Die Flucht nach Jehol".)
218 Die Operationen der europäischen Helden behufs Erschließung Chinas für den Warenhandel sind noch mit einem hübschen Fragment aus der inneren Geschichte Chinas verknüpft. Frischweg von der Plünderung des Sommerpalastes der Mandschu-Souveräne begab sich der "Chinesische Gordon" auf den Feldzug gegen die Taiping-Rebellen und übernahm 1863 sogar den Befehl über die Kaiserliche Streitmacht. War doch die Niederwerfung des Aufstandes eigentlich das Werk der englischen Armee. Während aber eine erhebliche Anzahl von Europäern, darunter ein französischer Admiral, ihr Leben gelassen haben, um China der Mandschudynastie zu erhalten, benutzten die Vertreter des europäischen Warenhandels die Gelegenheit, um bei diesen Kämpfen ein Geschäftchen zu machen, und versorgten mit Waffen sowohl die Verfechter der Erschließung Chinas wie die Rebellen, gegen die jene zu Felde zogen. "Dir Gelegenheit. Geld zu machen, verführte außerdem auch den ehrenwerten Kaufmann dazu, beiden Parteien Waffen und Munition zu liefern, und da die Schwierigkeiten, sich in diesem Artikel zu verproviantieren, für die Rebellen größer waren als für die Kaiserlichen und sie daher höhere Preise zahlen mußten und zu zahlen bereit waren, wurden mit Vorliebe mit ihnen die Geschälte abgeschlossen. die ihnen erlaubten, nicht allein den Truppen der eigenen Regierung. sondern auch denen Englands und Frankreichs Widerstand zu leisten." (M. v. Brandt: 33 Jahre in Ostasien, Bd. III: China, 1901, S. 11.)
219 Siehe O. Franke: Die Rechtsverhältnisse am Grundeigentum in China, Leipzig 1903, S. 82 ff.
220 China unter der Kaiserin-Witwe, S. 334.
221 In China hat sich das häusliche Gewerbe bis in die jüngste Zeit sogar beim Bürgertum in weitem Maße erhalten, selbst in so großen und alten Handelsstädten, wie z.B. Ningpo mit seinen 300.000 Einwohnern. "Noch vor einem Menschenalter machten die Frauen selbst Schuhe, Hüte, Hemden und sonstiges für ihre Männer und für sich. Es erregte damals in Ningpo viel Aufsehen. wenn eine junge Frau irgend etwas bei einem Händler einkaufte, was sie durch den Fleiß ihrer Hände selbst hätte herstellen können." (Nyok-Ching Tsur: Die gewerblichen Betriebsformen der Stadt Ningpo. Tübingen 1909. S. 51.)
222 Das letzte Kapitel in der Geschichte der Bauernwirtschaft unter den Einwirkungen der kapitalistischen Produktion stellt freilich dieses Verhältnis auf den Kopf. Bei dem ruinierten Kleinbauer wird vielfach die Hausindustrie für kapitalistische Verleger oder einfach die Lohnarbeit in der Fabrik zum Hauptberuf der Männer, während der landwirtschaftliche Betrieb ganz auf die Schultern von Frauen, Greisen und Kindern abgewälzt wird. Ein Musterbeispiel bietet der Kleinbauer Württembergs.
223 W. A., Peffer: The Farmer's side. His troubles and their remedy, Tel II: How we got here, Kapitel I: Changed conditions of the Farmer, New York 1891, S. 56/57. Vgl. auch A. M. Simons: The American Farmer, 2. Aufl. Chicago 1906, S. 74 ff.
224 Zit. bei Lafargue: Getreidebau und Getreidehandel in den Vereinigten Staaten. in: Die Neue Zeit, 1885, S. 344. (Der Aufsatz ist zuerst im Jahre 1883 in einer russischen Zeitschrift erschienen.)
225 "The three revenue acts of June 30, 1864, practically form one measure, and that probably the greatest measure of taxation which the world has seen ... The internal revenue act was arranged, as Mr. David A. Wells had said on the principles of the Irishman at Donnybrook fair: 'Whenever you see a head, hit it; whenever you see a commodity, tax it.' Every thing was taxed, and taxed heavily." (F. W. Taussig: The Tariff History of the United States, New York 1888, S. 164.)
226 "The necessity of the Situation, the critical state of the country, the urgent need of revenue, may have justified this haste, which, it is safe to say, is unexampled in the history of civilized countries." (Taussig: l.c., S. 168.)
227 W. A. Peffer: l.c., S. 58.
228 W. A. Peffer : l.c. Introducton, S. 6. Sering berechnet Mitte der 80er Jahre das notwendige Bargeld für einen "sehr dürftigen Anfang" der kleinsten Farm im Nordwesten auf 1.200-1.400 Dollar. (Siehe Die landwirtschaftliche Konkurrenz Nordamerikas, Leipzig 1887, S. 431.)
229 Lafague: l.c., S. 345.
230 Der "Report of the U.S. Commissioner of Labor" für 1898 gibt die folgende Zusammenstellung der erreichten Vorteile des maschinellen Betriebes gegen die Handarbeit:
| Arbeit | Arbeitszeit bei der Anwendung von Maschinen für die Ausgegebene Einheit | Arbeitszeit bei Handarbeit für dieselbe Einheit des Produktes | |||
| Stunden | Minuten | Stunden | Minuten | ||
| Pflanzen von kleinem Getreide | - | 32,7 | 10 | 55 | |
| Ernten und Dreschen von kleinem Getreide | 1 | - | 46 | 40 | |
| Pflanzen von Mais | - | 37,5 | 6 | 15 | |
| Schneiden von Mais | 3 | 4,5 | 5 | - | |
| Enthülsen von Mais | - | 3,6 | 66 | 40 | |
| Pflanzen von Baumwolle | 1 | 3.0 | 8 | 48 | |
| Kultivieren von Baumwolle | 12 | 5,1 | 60 | - | |
| Mähen von Heu | Sense gegen Maschine | 1 | 0,6 | 7 | 20 |
| Einholen u. Verpacken | 11 | 3,4 | 35 | 30 | |
| Pflanzen von Kartoffeln | 1 | 2,5 | 15 | - | |
| Pflanzen von Paradiesäpfeln | 1 | 4,0 | 10 | - | |
| Kultivieren und Ernten von Paradiesäpfeln | 134 | 5,2 | 324 | 20 |
231 Die Ausfuhr des Weizens aus der Union nach Europa betrug in Millionen Bushels:
| 1868/69 | 17,9 |
| 1874/75 | 71,8 |
| 1879/80 | 153,2 |
| 1885/86 | 57,7 |
| 1890/91 | 55,1 |
| 1899/1900 | 101,9 |
(Juratcheks Übersichten der Weltwirtschaft, Bd. VII, Abt. I. S. 32.
Gleichzeitig ging der Preis pro Bushel Weizen loco Farm in Cents folgendermaßen herunter:
| 1870/79 | 105 |
| 1880/89 | 83 |
| 1895 | 51 |
| 1896 | 73 |
| 1887 | 81 |
| 1898 | 58 |
Seit 1883, wo er den Tiefstand von 58 Cents pro Bushel erreicht hat, bewegt sich der Preis wieder aufwärts:
| 1900 | 62 |
| 1901 | 62 |
| 1902 | 63 |
| 1903 | 70 |
| 1904 | 92 |
(Juraschek: l.c., S. 18.)
Nach den "Monatlichen Nachweisen über den auswärtigen Handel" stand der Preis pro 1.000 Kilogramm im Juni 1912 in Mark:
| Weizen | |
| Berlin | 227,82 |
| Mannheim | 247,93 |
| Odessa | 173,94 |
| New York | 178,08 |
| London | 170,96 |
| Paris | 243,69 |
232 Zit. bei: Peffer: l.c., Teil I: Where we are, Kapitel II: Progress of Agriculture, S. 30/31.
233 Peffer: l.c.; S. 42.
234 Sering: Die landwirtschaftliche Konkurrenz Nordamerikas, S. 433.
235 Siehe W. A. Pfeffer: l.c., S. 35/36.
236 Zit. bei Nikolai-on: l.c. S. 224.
237 Die Einwanderung nach Kanada betrug 1901 49.149 Personen. Im Jahre 1912 sind über 300.000 Personen eingewandert, davon 131.000 britische und 134.000 amerikanische Einwanderer. Wie aus Montreal Ende Mai 1912 gemeldet wurde, dauerte der Zuzug der amerikanischen Farmer auch in diesem Frühjahr fort.
238 "Ich habe auf der Reise durch den kanadischen Westen nur eine einzige Farm besucht, welche weniger als 1.000 Acres (1.585 preußische Morgen) umfaßte. Nach dem 1881er Census des Dominion of Canada waren in Manitoba zur Zeit der Aufnahme 2.384.337 Acre Landes von nur 9.077 Besitzern okkupiert; es entfielen demnach auf einen einzelnen nicht weniger 2.047 Acres - eine Durchschnittsgröße, wir sie in keinem Staate der Union nur entfernt erreicht wird." (Sering: l.c., S. 376.) Wenig verbreitet war freilich zu Beginn der 80er Jahre in Kanada eigentlicher Großbetrieb. Doch beschreibt schon Sering die einer Aktiengesellschaft gehörige "Bell-Farm", die nicht weniger als 22.680 Hektar umfaßte und offenbar nach dem Muster der Dalrymple-Farm eingerichtet war. - Sering, der die Aussichten kanadischen Konkurrenz sehr kühl und skeptisch betrachtete, hat in den 80er Jahren als den "fruchtbaren Gürtel" Westkanadas eine Fläche von 311.000 Quadratmeilen oder ein Gebiet drei Fünftel so groß wie ganz Deutschland berechnet, davon nahm er bei extensiver Kultur nur 38,4 Millionen Acres als wirkliches Kulturland und davon als voraussichtliches Weizengebiet im Höchstfalle nur 14 Millionen Acres an. (Sering: l.c., S. 337 u. 338.) Nach den Schätzungen der "Manitoba Free Press" von Mitte Juni 1912 betrug die Anbaufläche für Frühjahrsweizen in Kanada im Sommer 1912 11,2 Millionen Acres gegen eine Fläche von 19,2 Millionen Acres Frühjahrsweizen in den Vereinigten Staaten. (Siehe Berliner Tageblatt und Handelszeitung, Nr. 305 vom 18. Juni 1912.)
239 Siehe Sering: l.c., S. 362 ff.
240 Siehe Ernst Schultze: Das Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten. In: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 1912, Heft IV, S. 1724.
241 "Moshesh, the great Basuto leader, tho whose courage and statesmanship the Basutos owed their very existence as a people, was still alive at the time, but constant war with the Boers of the Orange Free State had brought him and his followers to the last stage of distress. Two thousand Basuto warriors had been killed, cattle had been carried off, native homes had been broken up and crops destroyed. The tribe was reduced to the position of starving refugees, and nothing could save them but the protection of the British Government, which they had repeatedly implored." (C. P. Lucas: A Historical Geography of the British Colonies, Oxford, Bd. IV, S. 60.)
242 "The eastern section of the territory is Mashonaland, where, with the permission of King Lobengula, who claimed it, the British South Africa Company first established themselves." (Lucas; l.c., S 77.)
243 Das Eisenbahnnetz betrug in Kilometern in
| Europa | Amerika | Asien | Afrika | Australien | |
| 1840 | 2.925 | 4.754 | - | - | - |
| 1850 | 23.504 | 15.064 | - | - | - |
| 1860 | 51.862 | 53.935 | 1.393 | 455 | 367 |
| 1870 | 104.914 | 93.139 | 8.185 | 1.786 | 1.765 |
| 1880 | 168.983 | 174.666 | 16.287 | 4.646 | 7.847 |
| 1890 | 223.869 | 331.417 | 33.724 | 9.386 | 18.889 |
| 1900 | 283.878 | 402.171 | 60.301 | 20.114 | 24.014 |
| 1910 | 333.848 | 526.382 | 101.916 | 36.854 | 31.014 |
Demnach betrug der Zuwachs in
| Europa | Amerika | Asien | Afrika | Australien | |
| 1840-50 | 710 Proz. | 215 Proz. | - | - | - |
| 1850-60 | 121 Proz. | 257 Proz. | - | - | - |
| 1860-70 | 102 Proz. | 73 Proz. | 486 Proz. | 350 Proz. | 350 Proz. |
| 1870-80 | 61 Proz. | 88 Proz. | 99 Proz. | 156 Proz. | 333 Proz. |
| 1880-90 | 32 Proz. | 89 Proz. | 107 Proz. | 104 Proz. | 142 Proz. |
| 1890-1900 | 27 Proz. | 21 Proz. | 79 Proz. | 114 Proz. | 27 Proz. |
244 Tugan-Baranowski: Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen, S. 74.
245 Sismondi: Nouveaux principes, Bd. II, Buch IV, Kap. IV: Der kaufmännische Reichtum folgt dem Wachstum des Einkommens.
246 "Es begann", erzählt der Vertreter der Fowlerschen Firma, Ingenieur Eyth, "ein fieberhaftes Telegraphieren zwischen Kairo, London und Leeds. Wann kann Fowler 150 Dampfpflüge liefern? - Antwort: in einem Jahr. Anspannung aller Kräfte garantiert. - Das genügt nicht. 150 Dampfpflüge müssen bis zum Frühjahr in Alexandrien landen - Antwort: Unmöglich - Die Fowlersche Fabrik in ihrer damaligen Größe konnte nämlich kaum 3 Dampfpflugapparate in der Woche stellen. Dabei ist zu beachten, daß ein Apparat dieser Art 50.000 M kostete, daß es sich also um eine Bestellung im Betrage von 71/2 Millionen handelte. - Nächstes Telegramm Ismail Paschas: Was die sofortige Vergrößerung der Fabrik koste? Der Vizekönig sei bereit, das Geld hierfür anweisen zu lassen. Sie können sich denken, daß man in Leeds das Eisen schmiedete, solange es heiß war. Aber auch andere Fabriken in England und in Frankreich wurden veranlaßt, Dampfpflüge zu liefern. Das Arsenal in Alexandrien, die Landungsstelle der vizeköniglichen Güter füllte sich haushoch mit Kesseln, Rudern, Trommeln, Drahtseilen, Kisten und Kasten aller Art und die Gasthöfe zweiten Ranges in Kairo mit frischgebackenen Dampfpflügern, die man aus Schlossern und Schmieden, aus Bauernburschen und hoffnungsvollen junges Männern, die zu allem und nichts fähig waren, in aller Eile zugestutzt hatte. Denn auf jedem dieser Dampfpflüge mußte doch mindestens ein sachverständiger Pionier der Zivilisation sitzen, Alles das schickten die Effendis von Alexandrien in wirren Massen nach dem Innern, nur um Platz zu gewinnen, so daß wenigstens das ankommende nächste Schiff seine Ladung ausspeien konnte. Man macht sich keinen Begriff davon, wie all dies an seinem Bestimmungsort oder vielmehr an jedem andern als seinem Bestimmungsort ankam. Hier lagen zehn Kessel am Nilufer, 10 Meilen davon die dazu gehörigen Maschinen, hier ein kleines Gebirge von Drahtseilen, zwanzig Stunden weiter oben die Windetrommeln für die Seile. Hier saß ein englischer Monteur hungernd und verzweifelnd auf einem Berg französischer Kisten, dort ergab sich ein anderer hoffnungslos dem heimischen Trunk. Effendis und Katibs rannten - Allah um Hilfe anflehend - zwischen Siut und Alexandrien hin und her und fertigten Listen von Dingen an, von deren Namen sie keine Ahnung hatten. Und doch kam schließlich auch ein Teil dieser Apparate in Bewegung. Der Dampfpflug rauchte in Oberägypten. Civilisation en progrès hatten abermals einen Schritt weiter getan." (Lebendige Kräfte. Sieben Vorträge aus dem Gebiete der Technik, Berlin 1908. S. 219.)
247 Siehe Earl of Cromer: Das heutige Ägypten, Bd. I, deutsch 1908, S. 11.
248 Übrigens wanderte das aus dem ägyptischen Fellah herausgeschundene Geld auch noch auf dem Umweg über die Türkei an das europäische Kapital. Die türkischen Anleihen von 1854, 1855, 1871, 1877 und 1886 sind auf den mehrmals erhöhten ägyptischen Tribut fundiert, der direkt an die Bank von England gezahlt wird.
249 "It is stated by residents in the Delta," berichtete die "Times" aus Alexandrien am 31. März 1879, "that the third quarter of the year's taxation is now collected, and the old methods of collection applied. This sounds strangely by the side of the news that people are dying by the roadside, that great tracts of country are uncultivated, because of the fiscal burdens, and that the farmers have sold their cattle, the women their finery, and that the usurers are filling the mortgage offices with their bonds and the courts with their suits of foreclosure." (Zit. bei: Th. Rothstein: Egypt's Ruin, 1910, S. 69/70.)
250 "This produce", schrieb der Korrespondent der "Times" aus Alexandrien, "consists wholly of taxes paid by the peasants in kind, and when one thinks of the povery-stricken, over-driven. under-fed fellaheen in their miserable hovels, working late and early to fill the pockets of the creditors, the punctual payment of the coupon ceases to be wholly a subject of gratification." (Zit bei: Th. Rothstein: l.c. S. 49)
251 Eyth, ein hervorragender Agent der Kapitalkultur in den primitiven Ländern, schließt bezeichnenderweise seine meisterhafte Skizze über Ägypten, der wir die Hauptdaten entnommen haben, mit dem folgenden imperialistischen Glaubensbekenntnis: "Was uns diese Vergangenheit lehrt, ist auch für die Zukunft von zwingender Bedeutung: Europa muß und wird, wenn auch nicht ohne Kämpfe jeder Art, in denen sich Recht und Unrecht kaum mehr unterscheiden lassen und in denen das politische und historische Recht oft genug gleichbedeutend sein müßte mit dem Unglück von Millionen, das politische Unrecht gleichbedeutend sein mag mit ihrer Rettung - Europa muß seine feste Hand auf jene Länder legen, die nicht mehr fähig sind, aus eigener Kraft das Leben unserer Zeit zu leben, und die festeste Hand wird, wie überall in der Welt, auch an den Ufern des Nils den Wirren ein Ende machen." (l.c. S. 247.) Wie die "Ordnung" aussieht, die England "an den Ufern des Nils" schuf, darüber gibt Rothstein, l.c., genügenden Aufschluß.
252 Die anglo-indische Regierung erteilte schon zu Beginn der 30er Jahre dem Colonel Chesney den Auftrag, den Euphrat auf seine Schiffbarkeit behufs Erzielung einer möglichst kurzen Verbindung zwischen denn Mittelmeer und dem Persischen Golf bzw. Indien zu untersuchen. Nach einer vorläufigen Rekognoszierungstour im Winter 1831 fand nach umständlichen Vorbereitungen die eigentliche Expedition in den Jahren 1835-1837 statt. Im Anschluß hieran wurden größere Teile des östlichen Mesopotamien von englischen Offizieren und Beamten erforscht und aufgenommen. Diese Arbeiten zogen sich bis zum Jahre 1866 hin, ohne für die englische Regierung ein praktisches Ergebnis erzielt zu haben. Der Gedanke, eine Verbindungsstraße vom Mittelmeer über den Persischen Golf nach Indien herzustellen, wurde später von England in anderer Form wieder aufgenommen, nämlich durch der Plan der Tigris-Eisenbahn. 1879 macht Cameron im Auftrage der englischen Regierung eine Reise durch Mesopotamien, um die Trasse für die projektierte Bahn zu studieren. (Siehe Max Freiherr von Oppenheim: Vom Mittelmeer zum Persischen Golf durch den Hauran, die Syrische Wüste und Mesapotamien, Bd. II, S. 5 u. 36.)
253 Siehe Schneider: Die deutsche Bagdadbahn, 1900, S. 3.
254 Saling, Börsenjahrbuch 1911/12, S. 2211.
255 Siehe Saling: l.c. S. 360 u. 361. Über den gesamten Zuschuß zum Eisenbahnbau in der Türkei, den die türkische Regierung dem internationalen Kapital leisten mußte, gibt der Ingenieur Pressel aus Württemberg, der an diesen Geschäften in der europäischen Türkei als Gehilfe des Barons von Hirsch zum Teil selbst tätig war, die folgende hübsche Rechnung:
| Länge Kilometer | bezahlte Garantie Fr. | |
| Die drei Linien der europäischen Türkei | 1.888.8 | 33.099.352 |
| Das bis 1900 ausgeführte Netz der asiatischen Türkei | 2.513,2 | 53.811.538 |
| Kommissionen und andere an die Dette Publique bezahlte Kosten im Dienste der Kilometergarantie | 9.351.209 | |
| ------------------------ | ||
| zusammen | 96.262.099 |
Dies alles wohlgemerkt nur bis Ende 1899, seit welchem Datum die Kilometergarantie zum Teil erst gezahlt wird. Von den 74 Sandschaks der asiatischen Türkei waren schon damals nicht weniger als 28 mit ihrem Zehnten für die Kilometergarantie verpfändet. Und mit all diesem Zuschuß waren seit dem Jahre 1856 bis 1900 im ganzen 2.513 Kilometer in der asiatischen Türkei geschaffen. (Siehe W. von Pressel: Les chemins de fer en Turquie d'Asie, Zürich 1900, S. 59.)
Von den Manipulationen der Eisenbahngesellschaften auf Kosten der Türkei gibt Pressel als Sachverständiger übrigens die folgende Probe:
Er behauptet, daß die Anatalische Gesellschaft in der Konzession von 1893 erst die Bahn über Angora nach Bagdad zu leiten versprach, dann die Unausführbarkeit ihres eigenen Planes erklärte, um diese durch Kilometergarantie sichergestellte Linie ihrem Schicksal zu überlassen und eine andere Route über Konia in Angriff zu nehmen. "Im Augenblick, wo es den Gesellschaften gelungen sein wird, die Linie Smyrna – Aidin – Diner zu erwerben, werden sie die Verlängerung bis zur Linie Konia fordern. Und nachdem diese Zweiglinie vollzogen sein wird, werden die Gesellschaften Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um den Warenverkehr zu zwingen, diese neue Route zu nehmen, die keine Kilometergarantie hat und die, was noch wichtiger, in keinem Fall ihre Einkünfte mit der Regierung teilen muß, während die anderen Linien von einer gewissen Höhe der Bruttoeinnahmen einen Teil des Überschusses an die Regierung abführen müssen. Resultat: Die Regierung wird an der Linie Aidin nichts einnehmen, und die Gesellschaften werden Millionen einstreichen. Die Regierung wird für die Linien Kassaba und Angora fast den ganzen Betrag der Kilometergarantie zahlen und wird nicht erhoffen dürfen, von dem ihr im Vertrag zugesicherten 25prozentigen Anteil an dem Überschuß über 15.000 Franc Bruttoeinnahme je profitieren zu können." (l.c., S. 7.)
256 Siehe Charles Morawitz: Die Türkei im Spiegel ihrer Finanzen, 1903, S. 84.
257 "Übrigens ist in diesem Lande alles schwierig und verzwickt. Will die Regierung ein Monopol auf Zigarettenpapier oder Spielkarten schaffen, gleich sind Frankreich und Österreich-Ungarn da, um im Interesse ihres Handels ein Veto einzulegen. Handelt es sich um Petroleum, so wird Rußland Einwände erheben, und selbst die am wenigsten interessierten Mächte werden ihre Zustimmung zu irgendeiner Sache von irgendwelchen Regelungen abhängig machen. Der Türkei ergeht es wie Sancho Pansa bei seiner Mahlzeit: Sooft der Finanzminister eine Sache angreifen will, erhebt sich irgendein Diplomat, um ihm in den Arm zu fallen und sein Veto entgegenzuhalten." (Morawitz: l.c. S. 70.)
258 Und nicht nur in England. "Schon 1859 hatte eine durch ganz Deutschland verbreitete Flugschrift, als deren Verfasser man den Fabrikanten Diergardt aus Viersen bezeichnete, die eindringliche Mahnung an Deutschland gerichtet, sich des ostasiatischen Marktes rechtzeitig zu versichern. Es gab nur ein Mittel, um den Japanern, überhaupt den Ostasiaten gegenüber handelspolitisch etwas zu erreichen, das ist militärische Machtentfaltung. Die aus dem Sparpfennig des Volkes erbaute deutsche Flotte war ein Jugendtraum gewesen. Sie war längst durch Hannibal Fischer versteigert. Preußen hatte einige Schiffe, freilich keine imponierende Marinemacht. Man entschloß sich aber, ein Geschwader auszurüsten, um in Ostasien Handelsvertragsverhandlungen anzuknüpfen. Die Führung der Mission, welche auch wissenschaftliche Zwecke verfolgte, erhielt einer der fähigsten und besonnensten preußischen Staatsmänner, Graf zu Eulenburg. Derselbe führte seinen Auftrag unter den schwierigsten Verhältnissen mit großem Geschick durch. Auf den Plan, damals auch mit den Hawaiischen Inseln Vertragsbeziehungen anzuknüpfen, mußte man verzichten. Im übrigen erreichte die Expedition ihren Zweck. Trotzdem die Berliner Presse damals alles besser wußte und bei jeder Nachricht über eingetretene Schwierigkeiten erklärte, das habe man längst vorausgesehen und alle solche Ausgaben für Flottendemonstrationen seien eine Verschwendung der Mittel der Steuerzahler, läßt sich das Ministerium der neuen Ära nicht irremachen. Den Nachfolgern wurde die Genugtuung des Erfolges zuteil." (W. Lotz: Die Ideen der deutschen Handelspolitik, S. 80.)
259 "Une négociation officielle fut ouverte (zwischen der französischen und der englischen Regierung, nachdem Michel Chevalier mit Rich. Cobden die vorbereitenden Schritte getan hatte) au bout de peu de jours: elle fut conduite avec le plus grand mystère. Le 5 Janvier 1860 Napoléon III annonça ses intentions dans une lettreprogramme adressée au ministère d'État, M. Fould. Cette déclaration éclata comme un coup de foudre. Après les incidents de l’année qui venait de finir, on comptait qu'aucune modification du régime douanier ne serait tentée avant 1861. L'émotion fut générale. Néanmoins le traite fut signe le 23 Janvier." (Auguste Devers: La politique commerciale de la France depuis 1860. Schriften des Vereins für Sozialpolitik, LI, S. 136.)
260 Die Revision des russischen Zolltarifs in liberalem Sinne 1857 und 1868, die endgültige Abtragung des wahnwitzigen Schutzzollsystems Kankrins, war eine Ergänzung und Äußerung des ganzen Reformwerkes, das durch das Debakel des Krimkrieges erzwungen wurde. Unmittelbar entsprach aber die Ermäßigung der Zölle vor allem den Interessen des adeligen Grundbesitzes, der sowohl als Konsument ausländischer Waren wie als Produzent des ins Ausland ausgeführten Getreides an einem ungehinderten Handelsverkehr Rußlands mit Westeuropa interessiert war. Hat doch die Verfechterin der landwirtschaftlichen Interessen, die Freie Ökonomische Gesellschaft, konstatiert: "Während der verflossenen 60 Jahre, von 1822 bis 1882, hat die größte Produzentin Rußlands, die Landwirtschaft, viermal unermeßlichen Schaden erleiden müssen, wodurch sie in eine äußerst kritische Lage gebracht wurde, und in allen vier Fällen lag die unmittelbare Ursache an maßlos hohen Zolltarifen. Umgekehrt ist die 32jährige Zeitperiode von 1845 bis 1877, während der gemäßigte Zölle bestanden, ohne solche Notstände abgelaufen, ungeachtet der drei Kriege und eines inneren Bürgerkrieges (gemeint ist der polnische Aufstand 1863 – R. L.), von denen jeder eine größere oder geringere Anspannung der Finanzkräfte des Staates bewirkte." (Memorandum der Kaiserl. Freien Ökonomischen Gesellschaft in Sachen der Revision des russischen Zolltarifs, Petersburg 1890, S. 148.) Wie wenig in Rußland bis in die jüngste Zeit die Verfechter des Freihandels oder wenigstens eines gemäßigten Schutzzolls als die Vertreter der Interessen des Industriekapitals betrachtet werden dürfen, beweist schon die Tatsache, daß die wissenschaftliche Stütze dieser freihändlerischen Bewegung, die genannte Freie Ökonomische Gesellschaft, noch in den 90er Jahren gegen den Schutzzoll gerade als gegen ein Mittel der "künstlichen Verpflanzung" der kapitalistischen Industrie nach Rußland eiferte und im Geiste reaktionärer "Volkstümler" den Kapitalismus als die Brutstätte des modernen Proletariats denunzierte, "jener Massen militärdienstuntauglicher, besitzloser und heimatloser Menschen, die nichts zu verlieren haben und die seit langer Zeit keinen guten Ruf genießen ...". (l.c., S. 171.) Vgl. auch K. Lodyshenski: Geschichte des russischen Zolltarifs, Petersburg 1886, S. 239-258.
261 Auch Fr. Engels teilte diese Auffassung. In einem seiner Briefe an Nikolai-on schreibt er am 18. Mai 1892: "Englische Interessen vertretende Schriftsteller können es nicht verstehen, daß alle Welt es ablehnt, ihr Freihandelsbeispiel zu befolgen, und statt dessen Schutzzölle eingeführt hat. Natürlich wagen sie nicht zu sehen, daß dieses jetzt fast allgemeine Zollsystem ein – mehr oder weniger kluges und in manchen Fällen absolut dummes - Mittel der Selbstverteidigung gegen ebendenselben englischen Freihandel ist, der das englische Industriemonopol zu seiner höchsten Vollendung geführt hat. (Dumm z.B. im Falle Deutschlands, das unterm Freihandel ein großes Industrieland geworden ist und wo der Schutzzoll auf landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe ausgedehnt wird, was die Kosten der industriellen Produktion erhöht!) Ich betrachte dieses allgemeine Zurückgreifen auf den Schutzzoll nicht als einen bloßen Zufall, sondern als Reaktion gegen das untragbare Industriemonopol Englands; die Form dieser Reaktion mag, wie gesagt, unzuträglich sogar noch schlechter sein, aber die historische Notwendigkeit einer solchen Reaktion scheint mir klar und offensichtlich." (Briefe usw., S. 71.) [Friedrich Engels an Nikolai Franzewitsch Danielson in Petersburg, 18. Juni 1892. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 38. S. 365.]
262 Diese Annahme macht z B. in der Tat Dr. Renner zur Grundlage seiner Schrift über die Steuern. "Alles, was in einem Jahre an Werten geschaffen wird", sagt er, "spaltet sich in diese vier Teile. Und also können die Steuern eines Jahres nur aus ihnen geschöpft werden: Profit, Zins, Rente und Lohn sind die vier besonderen Steuerquellen." (Das arbeitende Volk und die Steuern, Wien 1909, S. 9.) Renner erinnert sich zwar gleich darauf den Existenz der Bauern, erledigt sie aber mit einem Satz: "Ein Bauer zum Beispiel ist zugleich Unternehmer, Arbeiter und Grundeigentümer, er bezieht in seinem Wirtschaftsvertrag unter einem den Lohn, den Profit und die Rente." Es ist klar, daß eine solche Spaltung des Bauerntums in alle Kategorien der kapitalistischen Produktion und die Betrachtung des Bauern als seines eigenen Unternehmers,. Lohnarbeiters und Grundherrn in einer Person eine blutleere Abstraktion ist. Die ökonomische Besonderheit des Bauerntums - will man es schon, wie Renner, als eine unterschiedslose Kategorie behandeln - besteht gerade darin, daß es weder zum kapitalistischen Unternehmertum noch zum Lohnproletariat gehört und daß es nicht kapitalistische sondern einfache Warenproduktion repräsentiert.
263 Die Behandlung der Kartelle und Trusts als eine spezifischen Erscheinung der imperialistischen Phase auf dem Boden des inneren Konkurrenzkampfes zwischen einzelnen Kapitalgruppen um die Monopolisierung der vorhandenen Akkumulatiosgebiete und um die Verteilung des Profits liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.
264 In einer von den russischen Marxisten seinerzeit sehr gefeierten Antwort an Woronzow schrieb z.B. Professor Manuilow: "Hier muß streng unterschieden werden zwischen der Unternehmergruppe, die Gegenstände des Kriegsbedarfs herstellt, und der Gesamtheit der Kapitalistenklasse. Für die Fabrikanten, die Kanonen, Gewehre und sonstiges Kriegsmaterial produzieren, ist die Existenz des Militärs zweifellos vorteilhaft und unentbehrlich. Es ist sehr wohl möglich, daß die Abschaffung des Systems des bewaffneten Friedens für die Firma Krupp einen Ruin bedeuten würde, es handelt sich aber nicht um irgendeine besondere Gruppe von Unternehmen, sondern lediglich um die Kapitalisten als Klasse, um die kapitalistische Produktion im ganzen." Von diesem letzteren Standpunkte aber sei zu bemerken, daß "wenn die Steuerlast vorwiegend auf der Masse der arbeitenden Bevölkerung liegt, jede Vergrößerung dieser Last die Kaufkraft der Bevölkerung, damit aber auch die Nachfrage nach Waren verringert". Diese Tatsache beweise, "daß der Militarismus vom Standpunkte der Produktion des Kriegsmaterials betrachtet, wohl die einen Kapitalisten bereichert, die anderen aber schädigt, auf der einen Seite einen Gewinn, auf der anderen aber einen Verlust bedeutet". "Der Bote der Jurisprudenz", 1890, Heft I: Militarismus und Kapitalismus.)
265 Im Endergebnis führt die Verkümmerung der normalen Bedingungen, unter denen sich die Arbeitskraft erneuert, zur Verkümmerung der Arbeitskraft selbst, zur Verminderung ihrer durchschnittlichen Intensität und Produktivität, also auch zur Gefährdung der Bedingungen der Mehrwertproduktion. Allein diese weiteren Resultate, die erst nach längeren Zeitperioden dem Kapital fühlbar werden, fallen in seinen ökonomischen Berechnungen zunächst nicht ins Gewicht. Sie äußern sich freilich unmittelbar in einer allgemeinen Verschärfung der Abwehrreaktionen der Lohnarbeiter.