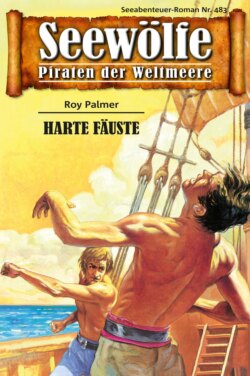Читать книгу Seewölfe - Piraten der Weltmeere 483 - Roy Palmer - Страница 6
1.
ОглавлениеKuba, 26. Mai 1595. Hammerschläge tönten über die Bucht westlich von Batabanó, das Geräusch von Sägen und das Rufen und Lachen von Männern. Die Korsaren – Philip Hasard Killigrew, Siri-Tong, Edmond Bayeux und deren Crews – hatten über die Spanier gesiegt.
Die „Isabella IX.“, die „Caribian Queen“, „Le Griffon“ und die „Trinidad“ ankerten in der Bucht. Die Schätze aus der Höhle wurden zum Ufer transportiert, in Jollen verladen und zu den Schiffen gepullt.
Luiz, der Spanier, lauschte den Geräuschen. Er biß sich auf die Unterlippe. Seine Hände ballten sich zu harten Fäusten. Verdammt, dachte er immer wieder, ihr verfluchten Hunde!
Er saß auf dem Stamm eines umgestürzten Baumes mitten im Urwald, vielleicht eine halbe oder sogar eine Meile vom Schauplatz des Geschehens entfernt. Rechtzeitig hatte er sich von der „Trinidad“ abgesetzt, wo er unter dem Kommando des Diego Machado gedient hatte. Machado war ein Himmelhund gewesen, ein Höllenbraten und Bastard, der nur auf seinen eigenen Vorteil aus war.
Gewesen – Machado war tot. Von Haien zerfetzt. Der Versuch, die „Trinidad“ zurückzuerobern, war gescheitert. Luiz wußte dies, weil er es beobachtet und mitgehört hatte. Daraufhin hatte Luiz beschlossen, ganz abzuhauen. Es war ihm zu brenzlig geworden.
Nach seiner Flucht hatte er zwar eine Zeitlang im Uferdickicht gehockt und überlegt, was er unternehmen sollte. Dann aber hatte er sich gesagt, daß es das beste wäre, das Weite zu suchen. Die Luft war blei- und eisenverseucht. De Mello und seine Männer von der „San Sebastian“ hatten kräftig zugelangt.
Dann aber die Wende: die „San Sebastian“ war verschwunden, und die drei Schiffe, die Luiz nie zuvor in seinem Leben gesehen hatte, waren in die Bucht eingelaufen. Besonders aufgefallen waren Luiz die große Galeone mit den hohen Masten, den überlangen Rahruten und den neuartigen flachen Aufbauten sowie der düstere Zweidecker. Wer waren die Männer dieser Segler? Korsaren – oder Piraten? Luiz verfluchte sie in die tiefste Hölle. Von dem Wipfel eines Mangrovenbaumes aus, den er erkletterte, konnte er alles verfolgen.
Ein Mann ließ sich zur „San Sebastian“ pullen, ein schwarzhaariger Riese. Er ging an Bord und sprach mit Capitán Gaspar de Mello. Dann verschwand die „San Sebastian“ aus der Bucht. Die Korsaren fingen nunmehr an, die Schatzhöhlen auszuräumen.
Ganz klar: Sie waren in der Übermacht, de Mello hatte sich ihnen beugen müssen. Sicherlich war de Mello inzwischen auch aufgegangen, daß es sich bei den Schätzen nicht um das Eigentum des Königs von Spanien handelte, sondern um die Reichtümer, die Don Antonio de Quintanilla, seines Zeichens ehemaliger Gouverneur von Kuba, für sich auf die Seite gebracht und sozusagen auf die hohe Kante gelegt hatte. Alonzo de Escobedo nun, der neue Gouverneur und somit Nachfolger des dicken Don Antonio, hatte herausgekriegt, wo die Schätze lagen, und wollte sie für sich ausbeuten.
Das Unternehmen war gründlich fehlgeschlagen. De Mello hatte de Escobedo gefangensetzen lassen. De Mello war für den Señor Gouverneur nur ein nützlicher Idiot gewesen. Das hatte de Mello begriffen. So zögerte er nicht, die Bucht zu räumen und mit seiner Kriegsgaleone nach Havanna zurückzukehren.
Luiz fragte sich, ob es nicht doch besser sei, an die Bucht zurückzukehren. Jetzt, da die Kanonen schwiegen und alles friedlich war, konnte er vielleicht doch noch etwas von dem immensen Schatz ergattern. Wenn er es geschickt anstellte, bemerkten ihn die Korsaren überhaupt nicht. Sie waren viel zu sehr mit dem Bergen der Truhen und Kisten aus den Höhlen beschäftigt. Sie konnten ihre Augen nicht überall haben.
Luiz verließ also seinen Aussichtspunkt und trat den Rückmarsch zur Bucht an. Aber unterwegs, im dichten und verfilzten Gestrüpp des Regenwaldes, verlor er die Orientierung. Er konnte den Himmel nicht mehr sehen und hörte nur noch die Geräusche: das Klopfen der Hämmer und Kreischen der Sägen, die Stimmen, die sich in einer ihm fremden Sprache unterhielten. Doch aus welcher Richtung kamen sie? Luiz irrte im Dickicht herum. Er hatte sich verlaufen.
So ließ er sich auf dem umgekippten Baum nieder. Und hier hockte er nun und dachte verzweifelt darüber nach, was er tun solle. Wenn die Dunkelheit hereinbrach, war er der Natur völlig ausgeliefert – den wilden Tieren und den Ausdünstungen des feuchten Dschungels, der das Sumpffieber und andere Krankheiten mehr brachte.
Ein leiser Laut hinter seinem Rücken ließ Luiz herumfahren. Sein Blick huschte hin und her. In einer instinktiven Geste griff er zum Messer – der einzigen Waffe, die ihm geblieben war. Er riß es aus dem Gurt. Gefahr schien zu drohen, Luiz spürte es. Was war dort, im Unterholz, zum Greifen nah? Ein Tier?
Plötzlich sah er, was es war. Ein grünlich-grauer Leib schob sich auf ihn zu. Unwillkürlich erschauderte der Mann. Eine Schlange! Sie steuerte auf den Baum zu und wand sich am Stamm hoch.
Luiz wollte nach dem Reptil stechen, doch etwas bremste ihn. Er fuhr hoch und wich zurück. Luiz war ein Kerl, der vor nichts und niemandem Angst hatte, aber Schlangen haßte und fürchtete er wie die Pest.
Hierbei stellte sich die Frage, ob die Schlange giftig war oder nicht, nur am Rande. Luiz hatte seine unangenehmen Erfahrungen mit Schlangen. Er wußte, daß sie unberechenbar waren, auch die angeblich harmlosen Arten. Eben glitten sie noch scheinbar geruhsam über den Boden, im nächsten Moment konnte der geringste Anlaß einen Ausbruch in ihnen auslösen.
Luiz, ein großer, wuchtig gebauter Mann mit dichtem schwarzem Vollbart, stammte von der spanischen Insel Formentera. Dort war er aufgewachsen und kannte die Strände, die Wälder und Berge wie die Taschen seines Beinkleides. Auf Formentera gab es giftige Vipern, aber auch große, bunte Nattern, die wie ein Pfeil durchs Gras schnellen konnten.
Einmal im Jahr, im Frühling, war die Paarungszeit dieser Tiere. Dann waren auch die Nattern aggressiv. Als Junge hatte Luiz einmal mit einem Stein nach zwei Schlangen geworfen – nach einem Männchen und einem Weibchen. Er hatte nicht geahnt, daß sie sich im Liebesspiel wanden. Aber er hatte sie gestört. Da hatten sie ihn verfolgt und mit ihren langen Schwänzen wie mit Peitschen auf ihn eingehauen. Luiz hatte diese Erlebnis nie vergessen. Ein anderes Mal war er nur knapp dem Biß einer Berus-Viper entgangen, die an einer Quelle getrunken hatte.
Die Schlange machte es sich auf dem umgestürzten Baum bequem. Sie rollte sich zusammen und schien die Sonnenstrahlen zu genießen, die durch das dichte Blätterdach stachen.
Luiz zog sich zurück und stapfte wütend durch das Dickicht. Welche Richtung sollte er einschlagen? Er versuchte, die Herkunft der Laute an der Bucht präzise zu orten und wandte sich nach rechts, dann wieder ein Stück nach links. Mal lachte da ein Mann, mal wurde wieder kräftig gehämmert und gesägt.
Überhaupt, was hatte das zu bedeuten? Von seinem Aussichtsplatz hatte Luiz nicht genau erspähen können, was an der Bucht vor sich ging. Aber wie es schien, bauten die Korsaren irgendwelche Hilfsmittel, um die Truhen und Kisten bequemer und schneller von den Höhlen zum Wasser zu bringen.
Luiz steckte das Messer wieder weg und stieß leise Flüche aus, blickte mal hier- und mal dorthin, konnte sich aber nicht erinnern, auf seiner Flucht von der Bucht in diesem Bereich des Urwaldes gewesen zu sein.
Aber in dieser grünen Hölle sah alles gleich aus. Ein Mangrovenbaum war wie der andere, alle Büsche und Lianen glichen sich. Wer sollte sich da auskennen? Es gab keine Pfade und Markierungen, nichts. Nur heiß und feucht war es. Das Kreischen der Vögel und Affen und das Zirpen der Zikaden klang wie ein höhnisches Konzert in Luiz’ Ohren.
Immer wütender wurde Luiz. Dann schlug seine Wut in Panik um. Was nun, wenn er sich überhaupt nicht mehr zurechtfand? War das möglich? So weit konnte das Ufer doch nicht entfernt sein! Warum ließ er sich in die Irre führen? War es die Hitze, das Klima? Oder hatte er schon eine der gefährlichen, gefürchteten Krankheiten?
Wenn einen das Wechselfieber packte, sollte man anfangs ja auch nichts davon bemerken. Luiz hatte in Cartagena, wo er einige Zeit gewesen war, mal einen Kerl kennengelernt, der das Sumpf- oder Wechselfieber hatte. Dieser Kerl wirkte ganz normal. Nur hin und wieder kriegte er seine Anfälle. Dann kippte er um und wand sich wie unter Krämpfen. Das Fieber stieg rasend schnell, der kalte Schweiß brach ihm aus. Luiz war dabeigewesen, als der Kerl solch einen Anfall gehabt hatte. Der Anblick hatte ihm gereicht. Vor Krankheiten dieser Art hatte Luiz Angst wie vor Schlangen.
Ein Schwarm dicker Fliegen tanzte durch den Dschungel. Sie brummten auf Luiz zu und schwirrten um seinen Kopf herum. Fluchend schlug er nach ihnen. Eine Fliege klatschte ihm mitten gegen die Stirn. Luiz war irritiert. Er wankte nach links, trat mit dem Fuß gegen die Luftwurzel eines Mangrovenbaumes, strauchelte und fiel hin.
Er sprang wieder auf und tobte zornig durch das Gestrüpp. Dornen kratzten ihn, seine Arme waren voller blutiger Male. Er blieb stehen, atmete schwer und schaute sich nach allen Seiten um. Wo war er?
Plötzlich war wieder ein kaum wahrnehmbarer Laut hinter ihm. Dieses Mal reagierte Luiz jedoch zu langsam. Ein Schatten huschte von hinten auf ihn zu. Derbe Hände packten Luiz und warfen ihn zu Boden. Dann rammte sich eine Faust in seinen Rücken, und Luiz stöhnte entsetzt und unter Schmerzen auf.
Aus, dachte er nur noch, die Hunde haben Wachtposten aufgestellt! Jetzt haben sie dich erwischt!
Ferris Tucker, der rothaarige Schiffszimmermann der „Isabella IX.“, richtete sich grinsend auf und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Na, wie haben wir das gemacht?“ fragte er seine Helfer.
„Großartig“, erwiderte Big Old Shane trocken und ohne eine Miene zu Verziehen. „Eine geniale Erfindung. Seit dem Stapellauf unserer ‚Isa‘ ist es das Beste, was ich gesehen habe.“
„Hör auf, mich zu verulken“, sagte Ferris. „Ich gebe zu, es ist eine simple Sache. Aber sie funktioniert.“
Das stimmte. Als die Männer beraten hatten, wie die Reichtümer, die in den Höhlen lagerten, am schnellsten und mühelosesten zum Ufer der Bucht transportiert werden konnten, war der rothaarige Riese auf die glorreiche Idee gekommen, Rutschen zu bauen. Diese Idee war inzwischen in die Tat umgesetzt worden.
Das Gelände vom Wasserfall bis zum Strand der Bucht war permanent abschüssig. So lag es fast auf der Hand, daß man die Kisten und Truhen am besten ins Gleiten oder Rollen brachte, um sie nicht schleppen zu müssen. Mac Pellew hatte vorgeschlagen, Rundhölzer unter die Behältnisse zu legen, die beim Rollen jeweils hinten weggenommen und vorn wieder untergelegt werden mußten. Doch Ferris’ Einfall war besser gewesen: Aus Balken und Planken fertigten die Männer der „Isabella“, der „Caribian Queen“ und der „Le Griffon“ einen hölzernen Pfad, der bis zu den bereitliegenden Jollen führte. Das hatte ein paar Stunden gedauert, aber die Mühe lohnte sich. Es zeigte sich jetzt, wie groß die Zeitersparnis war, die die Freunde auf diese Weise gewannen.
Der letzte Nagel, der die durch Planken verbundenen Balken zusammenhielt, saß. Ferris Tucker legte seinen Hammer beiseite und gab Hasard ein Zeichen. Der Seewolf, der am Rand des Uferdickichts stand, bedeutete seinerseits Siri-Tong mit einer Gebärde, daß es losgehen könne. Die Rote Korsarin stieß einen Pfiff aus.
Barba, ihr bulliger Steuermann, stand oben zwischen den Felsen und blickte zu Siri-Tong hinunter. Er winkte ihr lachend zu, dann wandte er sich George Baxter und Montbars zu. Sie hatten die erste Schatzkiste auf den obersten Balken der Rutsche gehievt und hielten sie an Tauen, die mit ihren Enden an den Griffen der Kiste belegt waren, fest.
„Es kann losgehen“, sagte Barba. „Laßt die Kuh fliegen, Leute!“
Baxter und Montbars setzten sich in Bewegung. Sie ließen die Kiste abwärts gleiten und folgten ihr. Dabei behielten sie die Taue in den Fäusten. Man wollte bei diesem ersten Versuch nicht riskieren, daß die Kiste von der Rutsche kippte und aufsprang. Den Schmuck, der dann herausfiel, mußte man erst wieder einsammeln. Auch das war eine zeitraubende Angelegenheit.
Aber alles verlief genauso, wie Ferris Tucker sich das vorgestellt hatte. Die Kiste rutschte um ein paar leichte Kurven und glitt, immer noch von Baxter und Montbars geführt, bis ans Ufer. Hier standen Blacky, Matt Davies, Stenmark, Higgy und ein paar andere Männer bereit. Sie übernahmen die Kiste und wuchteten sie in eine der Jollen.
„Na bitte!“ rief Ferris. „So einfach ist das! So, ich glaube, die Kisten können jetzt auch allein rutschen!“
So starteten sie den zweiten Versuch. Barba und Pedro Ortiz holten aus der Höhle eine gewichtige, mit eisernen Beschlägen versehene Truhe und hievten sie auf die Rutsche. Dann ließen sie sie einfach los. Die Truhe machte sich selbständig und sauste zu Tal. Sie huschte auf die am anderen Ende der Bahn Wartenden zu, verringerte leicht ihre Fahrt und stoppte dann, wie von Geisterhand gelenkt, genau am richtigen Punkt.
Albert klatschte begeistert in die Hände. „Wunderbar! Besser geht’s nicht!“
Jeff Bowie sah ihn von der Seite an und tippte sich an die Stirn. „Dir fehlen wohl ein paar Becher im Schapp, was? Führ dich doch nicht so albern auf.“
„Ich führe mich nicht albern auf“, erwiderte Albert giftig. „Ich freue mich nur, daß alles so schön klappt.“
„Na, dann freu dich man weiter“, brummte Jeff.
Carberrys Donnerstimme tönte über den Strand. „Haut rein! Keine Maulaffen feilhalten und nicht rumquatschen, ihr Rübenschweine! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Bald wird es dunkel, dann wollen wir die Höhlen mindestens halb leergeräumt haben!“
Barba hörte es und lachte grollend.
„Ran“, sagte er. „Denen wollen wir’s mal zeigen.“
Die zehn Männer, die bei ihm waren, holten nun ununterbrochen Kisten, Truhen und Fässer aus den Schatzhöhlen. Die wurden auf die Rutsche geladen, und wenn eine Kiste oder Truhe mal ein bißchen bockte, versetzte Barba ihr einen Tritt. Eine nach der anderen glitten sie nach unten.
Immense Werte, in ihrer Höhe kaum zu schätzen, bewegten sich da zum Südufer von Kuba. Ein ergreifendes und faszinierendes Bild. Das Ziel, daß sich Hasard und seine Kameraden vom Bund der Korsaren gesetzt hatten, war erreicht, Sie hatten den Privatschatz des Don Antonio de Quintanilla gefunden und für sich gewonnen. Alonzo de Escobedo hatten sie dabei auflaufen lassen, wie sich das gehörte. Anders hatte der neue Gouverneur von Kuba es nicht verdient. Er war auf seine Art ein noch größerer Galgenstrick und Menschenschinder als der dicke Don Antonio.
Über den Bau der Rutsche war es später Nachmittag geworden. Es herrschte reger Betrieb, die Männer arbeiteten ohne Pause, Kiste um Kiste, Truhe um Truhe wurde aus dem Spalt der Höhle befördert, durch den die letzten acht Deserteure das Labyrinth verlassen hatten. Bis zuletzt hatten diese Kerle geglaubt, noch eine Chance zu haben. Aber dann waren sie von Hasards Mannen mattgesetzt worden. So war das – sie hatten sich gegenseitig zerfleischt. Das Gold, das Silber und die Diamanten hatten sie in gnadenlose Bestien verwandelt. Hinzu kam, daß es sich bei der Mannschaft des Diego Machado um eine Meute von Schlagetots und üblen Halsabschneidern gehandelt hatte, die nicht anders gewesen waren wie ihr Kapitän selbst.
Ganz anders war die Crew der Kriegsgaleone „San Sebastian“. Unter dem Kommando von Gaspar de Mello segelten disziplinierte, anständige Männer, die das Unternehmen in der Bucht bei Batabanó von Anfang an nicht gutgeheißen hatten. Sie hatten aber gehorchen müssen, denn sie unterstanden dem Kommando des sehr ehrenwerten Señor Gouverneur.
All das hatte sich geändert. De Escobedo hatte gestanden, daß er nicht den Schatz des Königs abbergen und nach Spanien befördern, sondern in die eigene Tasche hatte wirtschaften wollen. Das brach ihm das Genick. De Mello hatte ihn unter Arrest gestellt, der Rest würde sich in Havanna ergeben.
Unbehelligt und in aller Ruhe konnten die Männer des Bundes der Korsaren arbeiten. Die Kisten, Truhen und Fässer wurden in die Jollen verladen und zu den Schiffen gepullt. Hier hievte man sie an Bord und verstaute sie in den Laderäumen.
Die Toten, die man in den Schatzhöhlen gefunden hatte, waren bereits begraben worden. Die anderen Toten, die im Verlauf der Kämpfe aus den Höhlen abgestürzt waren, waren verschwunden. Der Fluß hatte sie entführt, und sie verschwanden auf Nimmerwiedersehen im Meer, wo auch der Fuhrunternehmer Cajega sein Grab gefunden hatte – der erste Tote in dem Wahnsinnsunternehmen des Alonzo de Escobedo.
Hasard, Siri-Tong und Edmond Bayeux setzten sich zu einer kurzen Absprache zusammen.
„Ich finde, Arne muß so schnell wie möglich über den glücklichen Ausgang des Unternehmens unterrichtet werden“, sagte der Seewolf. „Wenn ihr nichts dagegen habt, gehe ich selbst nach Havanna.“
„Allein?“ fragte die Rote Korsarin. „Du solltest wenigstens einen Mann mitnehmen, der sich im Inneren der Insel bereits auskennt.“
„Roger Lutz“, sagte Hasard und winkte den Franzosen zu sich heran.
Roger hatte vernommen, was gesprochen worden war.
„Klar“, bestätigte er grinsend. „Jean und ich sind den ganzen Weg von Havanna bis hierher ja schon gelaufen.“
„Also, wir brechen gemeinsam auf“, sagte der Seewolf.
„Keine Einwände“, entgegnete Siri-Tong. „Ihr müßt euch nur beeilen. Es dauert nicht mehr lange, dann ist es dunkel.“
„Bei Nacht marschiert es sich auch nicht schlecht“, sagte Hasard lächelnd. „Richtig, Roger?“
„Richtig. Und bei Nacht sind alle Katzen grau.“
„Das ist auch wichtig“, pflichtete der Seewolf ihm bei. „Damit wir in Havanna nicht auffallen.“
„Ich kenne die Schleichwege bereits“, sagte Roger Lutz. „Jussuf hat uns in alles eingeweiht.“
„Somit kann nichts schiefgehen“, sagte Bayeux. „Wir halten in der Zwischenzeit hier die Stellung.“
„In Ordnung“, sagte Hasard. „Dann nichts wie los.“
Wenig später brachen Roger Lutz und der Seewolf nach Havanna auf. Für Arne von Manteuffels „Kriegskasse“ nahmen sie jeder zwei Lederbeutel mit Perlen mit. Sie tauchten im Dickicht unter und entzogen sich den Blicken ihrer Kameraden. Roger übernahm die Führung. Er konnte sich noch genau an alle Details erinnern und vermochte sich ausgezeichnet zu orientieren.
In jener Nacht, in der de Escobedo Cajega mittels der Folter zum Sprechen gezwungen hatte, waren Ribault und Lutz dem Gouverneur bis zu dem Schatzversteck gefolgt. Cajega hatte de Escobedo hinführen müssen. Als Lohn hatte er eine Pistolenkugel erhalten. Das Verfolgungsunternehmen der beiden Franzosen hatte sich ausgezahlt. Dies war der größte Schatz, den der Bund der Korsaren derart schnell und mühelos bislang gehoben hatte.
Während sie hintereinander voranschritten, sagte Hasard: „Ich habe auch noch einen anderen Grund, warum ich sofort nach Havanna will.“
„Die ‚San Sebastian‘?“ fragte Roger.
„Ja. Ich will beobachten, was sich tut.“
Roger Lutz lachte leise. „Es tut sich gewiß einiges, wenn der Capitán de Mello mit seiner Galeone und dem gefangenen Gouverneur dort einläuft.“
„Eben das will ich nicht versäumen“, erwiderte der Seewolf. Dann schwiegen sie beide und marschierten im einsetzenden rötlichen Licht der Dämmerung nach Norden.
Luiz, der Mann von Formentera, war sicher: Entweder steckte ihm der andere ein Messer zwischen die Rippen, oder aber er erwürgte ihn. Luiz versuchte, sich zur Wehr zu setzen, doch der andere hatte ihn zu fest im Griff. Nur eins konnte Luiz noch tun – kräftig fluchen. Er verdammte Gott, die Welt, die Seefahrt und seine eigene Mutter, weil sie ihn geboren hatte. Was war das für ein Leben, wenn man so elendig krepierte?
Plötzlich ließ der andere Luiz jedoch los und stieß selbst eine saftige Verwünschung aus. Luiz fuhr herum – und erstarrte vor Überraschung.
„Mann!“ zischte er. „Du bist das?“
Der andere Kerl versuchte zu grinsen. Es mißlang. Es wurde nur eine schiefe Grimasse daraus:
„Ich und kein anderer“, erwiderte er. „Hölle, so ein Dreck.“
„Pablo“, sagte Luiz haßerfüllt. „Du blöder Hund hättest mich um ein Haar abgestochen.“ Er blickte auf das Messer in Pablos Hand.
Langsam ließ Pablo das Messer sinken. „Ich hab’ dich nicht erkannt. Pest noch mal, ich krieche schon ’ne ganze Weile in diesem elenden Dschungel herum. Ich dachte, du seist einer von denen.“
Luiz hätte sich am liebsten auf den Kerl gestürzt und ihn umgebracht.
Doch seine Wut und sein Haß verrauchten wieder. Er besann sich und gelangte zur Vernunft. Pablo war einer seiner Kumpane von der „Trinidad“. Zu zweit konnten sie sich vielleicht doch besser durchschlagen.
Luiz brummte etwas Unverständliches und rieb sich mit beiden Händen das Genick. Jetzt ließen die Schmerzen etwas nach.
„Was treibst du hier eigentlich?“ fragte er den anderen. „Was hast du vor?“
„Das weiß ich selber nicht“, entgegnete Pablo. Er war ein hagerer, dunkelblonder Kerl mit krummer Nase, kleinen Augen und schadhaften Zähnen. Cabral, der Decksälteste, hatte ihn immer als die häßlichste Ratte an Bord bezeichnet. Das stimmte. Pablo war nicht nur häßlich, er hatte auch etwas Rattenhaftes an sich. Er wirkte schwach, hatte aber erstaunliche Kräfte, wie er auch dieses Mal wieder bewiesen hatte.
„So“, sagte Luiz hämisch. „Das ist ja ’ne ganze Menge.“
„Wo sind die anderen?“ wollte Pablo wissen.
„Die mit uns abgehauen sind?“
„Ja, die meine ich“, entgegnete Pablo. „Felipe, Marco und die anderen.“
„Einen haben die Haie gepackt“, erklärte Luiz. „Dante.“
„Um Dante ist es nicht schade.“
„Ein paar andere sind getürmt, glaube ich“, fuhr Luiz fort. „Wohl nach Batabanó. Sollen sie selig werden.“
„Auf jeden Fall ist es besser, daß wir uns verholt haben“, murmelte Pablo. „Sonst wären wir jetzt nicht mehr am Leben.“
Machado hatte sie höhnisch weggejagt, nachdem de Mello mit den Kanonen der „San Sebastian“ die Flucht der „Trinidad“ verhindert hatte. Dann hatte sich Machado mit einem Trupp von Kerlen selbst mit der letzten Jolle vom Schiff abgesetzt. An Land hatte er sich mit Cabral und den anderen Deserteuren verbündet. Die meisten hatten in den Schatzhöhlen ihr Ende gefunden.
„Richtig“, sagte Luiz und spuckte ins Dickicht. Dann erhob er sich. „Aber ich frage mich, wieso wir Idioten hier noch herumkriechen.“
„Hast du einen Grund dafür?“ erkundigte sich der andere.
„Ich hab’ mich verlaufen“, erwiderte Luiz.
„Das kann hier leicht passieren.“
„Ja“, pflichtete Luiz ihm bei. „Aber wir vergeuden hier bloß unsere Zeit. Diese Schweine haben uns den schönen Schatz weggeschnappt daran läßt sich nichts mehr ändern.“
„Was sind das für Kerle?“ fragte Pablo.
„Piraten. Korsaren. Irgendwelche Küstenhaie.“
„Vielleicht Engländer?“
„Kann schon sein“, erwiderte Luiz.
„Wenn du einer von ihnen gewesen wärst hätte ich dich abgestochen“, erklärte der Häßliche.
„Was hätte dir das eingebracht?“
„Nichts. Ich hasse sie.“
„Haben sie Wachtposten aufgestellt?“ wollte Luiz nun wissen.
„Ich weiß nicht.“
„Wir könnten zur Bucht schleichen.“
„Und dann?“ Pablo grinste schief. Das Messer hatte er inzwischen wieder in den Gurt gesteckt. „Die passen schon auf. Denen schnappen wir keine müde Perle weg.“
„Ich will ihnen aber was wegschnappen.“
„Schlag dir das aus dem Kopf“, sagte Pablo.
„Willst du’s etwa nicht?“
„Was? Sie beklauen?“ Pablos Augen verengten sich ein wenig und waren kaum noch zu sehen. „Lust darauf hätte ich schon. Aber ich weiß nicht wie ich es anstellen soll.“
„Allein hättest du keine Chance. Aber zu zweit …“
Pablo schüttelte den Kopf. „Hast du nicht gesehen, wie viele es sind?“
„Ich hab’s gesehen. Du auch?“
„Ja.“
„Und trotzdem schleichst du hier noch herum“, sagte Luiz grinsend. „Ich weiß doch, warum. Du gibst dich nicht geschlagen. Wir sind mit heiler Haut davongekommen. Aber daß diese Schweinehunde mit dem ganzen schönen Schatz abhauen sollen, können wir nicht zulassen.“
„Wenn ich nur einen Goldbarren hätte, würde mir das reichen“, sagte Pablo.
„Oder einen Sack voll Schmuck“, sagte Luiz. „Ich würde nach Batabanó gehen und mir einen flotten kleinen Kahn zulegen. Damit ließe sich schon was anfangen.“
„Willst du etwa Fischer werden?“ fragte der andere.
„Ich bin doch nicht blöd“, erwiderte Luiz verächtlich. „Arbeit verkürzt das Leben und schadet der Gesundheit. Nein. Mit einem flinken Einmaster würde ich hier an der Küste ein bißchen herumräubern.“
Pablo kicherte. „Da wäre ich mit dabei.“
„Wir sind uns also einig?“
„Ja.“
Sie reichten sich die Hände und schüttelten sie wie Verschwörer. „Aber wir sind ganz schön besengt“, sagte Luiz dann wieder. „Träumer! Wir haben bloß unsere Messer. Was können wir damit schon ausrichten?“
„Im Dunkeln einiges“, entgegnete Pablo. „Wir murksen ein paar von diesen Bastarden ab, schnappen uns eine Kiste und hauen wieder ab. Ganz einfach.“
„Du kennst den Weg zum Strand?“
Pablo deutete in das grüne Gestrüpp. „Da geht’s lang. Ich verstehe nicht ganz, wie du dich verlaufen konntest. Warum bist du nicht einfach auf einen Baum geklettert?“
„Das habe ich vorhin getan“, erwiderte Luiz. „Aber danach habe ich keinen guten Baum mehr gefunden.“ Er wies auf die Mangrovenbäume und die riesigen Sumpfzypressen. Sie waren von Dornengestrüpp umrankt. Es war unmöglich, an ihnen hochzuklettern.
Pablo grinste. „Da hast du auch wieder recht. Man zerkratzt sich ziemlich. Oder man schlitzt sich was auf. Weißt du was? Dieser Urwald hier ist verdammt gefährlich. Hast du daran gedacht, daß es hier Giftschlangen geben könnte?“
Luiz’ Züge verzerrten sich. „Hör auf! Es gibt sie. Wir müssen hier raus, ehe wir hier vergammeln. Und wir unternehmen was. Heute nacht. Noch haben wir die Chance, reich zu werden.“
„Wo wohl die anderen sind“, sagte Pablo.
„Warum suchen wir sie nicht?“ fragte Luiz.
„Das ist eine Idee“, entgegnete der Häßliche. „Also los, suchen wir sie. Vielleicht finden wir wenigstens einen. Dann sind wir zu dritt, das ist noch besser.“