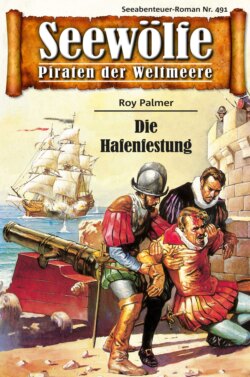Читать книгу Seewölfe - Piraten der Weltmeere 491 - Roy Palmer - Страница 6
1.
ОглавлениеWo war Lopez? Felipe, der Andalusier, stellte sich diese Frage, als er an Bord der Kriegsgaleone „Monarca“ aufenterte. Schließlich hatten Luiz und er Lopez aus dem Kabelgatt der „Sant Jago“ befreit. Später, an Oberdeck, hatten sich die drei zu Marco und Pablo gesellt. So hatten sie die letzte Phase des Gefechts erlebt.
Der Gegner hatte das einst so stolze Flaggschiff „Sant Jago“ glatt auseinandergefetzt. Bis zuletzt hatte Don Diego de Campos, dieser Narr von einem Generalkapitän, geglaubt er könne den Erzfeind Spaniens, El Lobo del Mar, doch noch packen. Aber jetzt sah er, was er sich eingehandelt hatte: der Gegner hatte die „Sant Jago“ in Brand gesetzt und zerbombt. Eben war sie mit einem gewaltigen Donnerhall in die Luft geflogen.
Felipe kletterte auf die Kuhl der „Monarca“. Da waren Luiz, der Schwarzbart, Marco, der Mann aus Murcia, und Pablo, dieser verteufelt häßliche Kerl. Andere Schiffbrüchige lagen oder hockten herum, ein paar waren verletzt.
Inzwischen halfen auch die Männer der „San Sebastian“, die Schiffbrüchigen aus dem Wasser zu bergen. Alles mußte sehr schnell gehen, denn die Haie, die sich zwischen der Unterwasser-Barriere und den Booten bewegten, waren eine ständige Gefahr. Ein paar arme Teufel hatten sie bereits verschlungen, Felipe und Luiz indes hatten höllisches Glück gehabt. Knapp waren sie den grauen Mördern entgangen – Luiz nur, weil sich der Andalusier so tapfer für ihn eingesetzt hatte.
Tropf naß standen sie sich nun auf der Kuhl der „Monarca“ gegenüber. Luiz grinste schwach, als er Felipe erblickte.
„Mann, wie kann ich das jemals wiedergutmachen?“ fragte er.
„Fängst du schon wieder an“, entgegnete Felipe. „Hör doch auf mit dem Quatsch. Sag mir lieber, wo Lopez steckt.“
„Wer? Ach, Lopez“, sagte Luiz. „Keine Ahnung.“
„Wir haben ihn auch aus den Augen verloren, seit wir von Bord gesprungen sind“, erklärte Marco. „Aber ich glaube nicht, daß er auf dem elenden Kahn geblieben ist.“
Von dem „elenden Kahn“ war nichts mehr übriggeblieben. Er war bei der Explosion, die beim Eindringen des Feuers in die Pulverdepots entstanden war, wie ein Spielzeug auseinandergeborsten. Trümmer, Tote und Verletzte waren durch die Luft gewirbelt. Jetzt schwammen rund um das Riff die traurigen Reste der „Sant Jago“ – eine düstere, unheimlich wirkende Szene unter einem sich immer dunkler färbenden Himmel.
„Lopez doch nicht“, brummte Felipe. „Der ist schlau genug. Ich schätze, daß er an Bord ist.“
„Vielleicht aber auch an Bord der ‚San Sebastian‘“, meinte Pablo.
Marco schüttelte den Kopf. „Das glaube ich nicht. Er könnte allerdings verletzt sein.“
„Haibiß?“ fragte Luiz.
Marco hob die Schultern und ließ sie wieder sinken. „Ich will’s nicht hoffen. Aber möglich ist alles. Sehen wir doch mal im Krankenraum nach.“
„Ja, das ist eine gute Idee“, sagte Luiz.
Felipe schnitt eine Grimasse. Allein die Erwähnung des Krankenraumes genügte, um bei ihm die Erinnerung an die letzten Stunden auf der „Sant Jago“ wachzurufen. Auch die Schmerzen waren wieder da, heiß und stechend. Aber der Andalusier biß sich auf die Unterlippe. Scheiß drauf, dachte er, das geht auch wieder vorbei. Hauptsache, du lebst noch.
Nie hatte er den Tod so dicht vor Augen gehabt. In der vergangenen Nacht hatten Luiz und er ausreißen wollen, weil sie das bevorstehende Gefecht fürchteten – nicht zu Unrecht, wie sich herausgestellt hatte. Doch ausgerechnet Don Diego de Campos hatte sie überrascht. Luiz hatte sich zurückgezogen. Felipe hatte den Generalkapitän angegriffen. Dabei hatte er sich ein paar Degenstiche eingehandelt. Nicht zu tief, aber eben schmerzhaft. Man hatte ihn in den Krankenraum getragen und Luiz in die Vorpiek verfrachtet. Am nächsten Tag – an diesem verhexten 10. Juni 1595 – hätten sie beide durch Erhängen sterben sollen, wie de Campos angeordnet hatte.
Aber das war jetzt wohl kein Thema mehr. Felipe grinste unwillkürlich, als sie sich dem Vordeck der „Monarca“ näherten. Teufel, was hatte er doch für ein Glück gehabt! Er war dem Teufel regelrecht von der Schippe gesprungen, gleich zweimal. Luiz auch. Nachdem sie der Exekution entronnen waren, hatten die Haie sie schnappen wollen. Aber Unkraut, schien es, verging eben doch nicht.
Felipe, Luiz, Marco und Pablo marschierten ins Vorkastell, keiner hinderte sie daran. Warum auch? Sie waren freie Männer. Juan de Alvarez, der Kommandant der „Monarca“, hatte nicht das geringste Interesse daran, das Todesurteil an Luiz und Felipe zu vollstrecken. Er lag mit de Campos im Streit, genau wie de Mello.
Die vier von der „Sant Jago“ hatten zwar nicht ganz mitbekommen, was sich da zuletzt auf der „Monarca“ abgespielt hatte. Aber de Alvarez, so hatten sie vernommen, hatte de Campos festnehmen lassen, nachdem dieser allen Ernstes versucht hatte, ihn hinterrücks niederzuschießen.
Recht so, dachte Felipe grimmig, und hoffentlich läßt de Alvarez den Hund in der Vorpiek schmoren. Verrecken soll das Schwein!
Fromme Wünsche – aber nicht nur Felipe dachte so. Die meisten anderen Männer der „Sant Jago“, der „Monarca“ und der „San Sebastian“ haßten de Campos inzwischen wie die Pest. Er hatte seine Männer in einem unsinnigen und aussichtslosen Kampf rücksichtslos verheizt – und dann auch noch als erster sein Schiff verlassen. Eine Schande – ganz abgesehen von den eklatanten Fehlern, die sich dieser Mann schon vorher geleistet hatte.
Der Dreier-Verband hätte Havanna niemals verlassen dürfen. Aber de Campos, der sich selbst zum kommissarischen Gouverneur von Kuba ernannt hatte, nachdem er den verräterischen Alonzo de Escobedo hatte einsperren lassen, hatte es auf den Seewolf abgesehen.
Er hatte Don Gaspar de Mello, den Kapitän der „San Sebastian“, als Feigling hingestellt und alle Argumente de Mellos einfach vom Tisch gefegt. Dann hatte er hastig ausgerüstet und zum Aufbruch gedrängt.
Natürlich – die Bucht bei Batabanó hatte man leer vorgefunden. Leer bis auf die „Trinidad“, die gestrandet war. In den Höhlen waren die Seesoldaten dann auf Luiz, Felipe, Marco und Pablo gestoßen. De Campos hatte die vier sofort zwangsrekrutieren lassen. Das Wichtigste aber: sie hatten einen Hinweis geben können, in welche Richtung sich El Lobo del Mar abgesetzt hatte.
Von Erfolg schien das Unternehmen des Don Diego de Campos gekrönt zu sein, als der Verband bei Middle Caicos auf die Schiffe des Gegners stieß. Irrtum: dieser Gegner zeigte die Zähne und die Krallen. Was de Mello längst befürchtet hatte, war eingetreten. Einen Mann wie diesen Philip Hasard Killigrew jagte man nicht ungestraft. An dem hatten sich schon ganz andere Kommandanten die Zähne ausgebissen.
Aber de Campos hatte es ja so gewollt. Das hatte er nun davon. Sein Flaggschiff existierte nicht mehr. Seine beiden Kapitäne hatten sich offen gegen ihn gewendet, de Campos’ Status war fortan in Frage gestellt. Was nämlich ein Prozeß vor dem Kriegsgericht, den er de Mello und de Alvarez angedroht hatte, ergeben würde, das war noch sehr zweifelhaft.
Die Mannschaften standen nahezu geschlossen hinter de Mello und de Alvarez. Sie würden bezeugen, was sich abgespielt hatte – und dann würde sich das hohe Gericht sicherlich überlegen, wem es die Schuld gab. De Campos riskierte, selbst degradiert und bestraft zu werden.
Gerade trafen wieder die Boote mit Schiffbrüchigen ein. Verletzte wurden an Bord gehievt. De Alvarez’ Erster Offizier schrie nach dem Feldscher. Der Feldscher verließ den Krankenraum und prallte im Gang mit Luiz zusammen.
„He!“ fuhr er ihn an. „Kannst du nicht aufpassen!“
„Tut mir leid“, brummelte Luiz. Rasch trat er zur Seite. Der Feldscher, ein hagerer, unterernährt wirkender Mensch mit einem traurigen Hundegesicht, lief an den vieren vorbei und stürmte auf die Kuhl.
„Der hat gut zu tun“, sagte Pablo.
„Möchte nicht in seiner Haut stecken“, murmelte Marco.
„Wo ist eigentlich unser Feldscher von der ‚Sant Jago‘?“ wollte Luiz wissen.
„Das weiß der Henker“, erwiderte Felipe. „Aber ich will ihm wünschen, daß er’s überlebt hat. Er ist nämlich kein schlechter Kerl. Der Rum, den er mir zu saufen gegeben hat, war verdammt gut.“
Marco öffnete das Schott zum Krankenraum und blickte als erster hinein. Pablo und Luiz schauten ihm über die Schulter. Luiz erbleichte und zog sich sofort wieder zurück. Felipe wollte wissen, was los war, und drängte vor.
Auf dem Behandlungstisch des Feldschers lag Don Diego de Campos. Neben ihm stand sein Erster Offizier. Der Generalkapitän sah nicht zum Schott. Nur der Erste hob den Kopf und blickte zu den vier Männern, die in einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Wut de Campos anstarrten.
Felipes Gesicht hatte sich zu einer Fratze des Hasses verzerrt. Er wollte sich allen Ernstes auf de Campos stürzen. Sein Glück war, daß Marco und Pablo schnell genug reagierten. Sie rissen den Andalusier zurück und hielten ihn fest. Luiz hatte trotz seiner Betroffenheit die Geistesgegenwart, das Schott blitzartig wieder zu schließen.
„Ich bring’ das Schwein um!“ zischte Felipe.
„Still!“ raunte Marco ihm zu. „Bist du wahnsinnig?“
Der Andalusier war kaum zu halten, sein Temperament ging mit ihm durch. Er hatte dem sehr ehrenwerten Señor Generalkapitän geschworen, ihn zu töten, und diesen Schwur wollte er jetzt einlösen. Felipe tobte, wollte sich losreißen und brüllen. Doch Marco und Pablo gelang es, ihn festzuhalten. Luiz stellte sich hinter den Zappelnden und preßte ihm die rechte Hand auf den Mund.
Sie schleppten Felipe weg, zum nächsten Niedergang. Felipe leistete immer noch heftigen Widerstand. Aber das Kräfteverhältnis drei gegen einen war letztlich doch ausreichend. Luiz, Marco und Pablo zerrten ihren Kumpan in einen leeren Raum. Hier drückten sie ihn zu Boden.
„Nicht schreien“, sagte der Schwarzbart. „Sonst haben wir die Hunde gleich alle am Hals.“
Felipe gab einen dumpfen Laut von sich.
„Wirst du schreien?“ fragte Marco.
Felipe schüttelte den Kopf.
Luiz ließ von dem Andalusier ab. Er mußte ausweichen, denn Felipe spuckte vor ihm aus. Marco und Pablo mußten immer noch alle Kraft aufwenden, um den Kerl auf den Planken zu halten.
„Euch geht’s wohl nicht gut, was?“ zischte der Andalusier. „Was fällt euch ein?“
„Wir wollen dich nur vor einer weiteren Straftat bewahren“, erwiderte Marco so ruhig wie möglich. „Wenn du den Generalkapitän erwürgst, muß de Alvarez dich aufhängen, kapierst du das nicht?“
„Nein.“
„Und wir sind auch mit dran“, fügte Luiz hinzu.
Der Andalusier musterte ihn kalt und verächtlich. „Das sieht dir mal wieder ähnlich. Du denkst nur an dich.“
„Du tust Luiz unrecht“, sagte Pablo.
„Halt du doch dein Maul!“
„Hör mal zu“, sagte Marco zu dem Andalusier. „Wir sind mit heiler Haut davongekommen. Wir haben ein Mordsglück gehabt. Warum sollen wir jetzt unseren Kopf hinhalten?“
„Ich will mich rächen“, erwiderte Felipe finster.
„Du mit deinem Stolz“, sagte Luiz.
„Hat jemand was gegen meinen Stolz?“ sagte Felipe angriffslustig. Er hatte aber doch aufgehört, sich gegen den Griff seiner Kumpane zu wehren. Marco und Pablo konnten jetzt seine Arme loslassen.
„Im Prinzip nicht“, entgegnete Marco. „Wir sind ja schließlich Landsleute.“
„Aber ihr wollt mich immer irgendwie reinlegen.“
„Das siehst du falsch“, widersprach der Mann aus Murcia. „Du hast dich da in was verrannt.“
„Wer wollte mich in den Schatzhöhlen denn abmurksen?“ zischte der Andalusier.
„Wir“, erwiderte Marco. „Aber wir sollten das vergessen. Wir haben daraus gelernt.“
„Ja, das stimmt“, pflichtete Pablo ihm bei.
„Und wir gehören zusammen“, sagte Luiz. „Ich bin dir dankbar, Felipe. Für das, was du für mich getan hast. Ich will mich dafür revanchieren. Ich kann’s nicht zulassen, daß du dich einfach so auslieferst.“
„Quatsch, ausliefern“, sagte der Andalusier. „De Campos kriegt nur das, was er verdient.“
„Er dreht sich selbst seinen Strick“, sagte jetzt Marco. „Glaub es mir, Felipe.“
Der Andalusier fixierte ihn aus schmalen Augen. „Wie meinst du das, alter Knochen? Ehrlich, das versteh’ ich jetzt nicht ganz.“
„Ich will es dir erklären. De Campos kehrt nicht lebend nach Havanna zurück.“
„Sondern tot?“ fragte Felipe.
Marco grinste hart. „Ich sage, daß er überhaupt nicht mehr nach Kuba zurückkommt. Er ist viel zu versessen darauf, El Lobo del Mar zu fassen.“
„Immer noch?“ fragte Pablo.
„Hat der die Nase nicht endlich voll?“ brummte Luiz.
„Niemals“, erwiderte Marco. „Er wird doch aus Erfahrung nicht klug. Seht ihr nicht, wie verbohrt er ist? Er sinnt schon wieder darauf, wie er den Gegner erneut angreifen kann.“
„Wahnsinn“, urteilte Felipe.
„Aber Tatsache“, sagte Marco.
„Nur zwei Schiffe gegen vier“, sagte Luiz. „Das ist verrückt. Dabei gehen wir alle vor die Hunde.“
„Eben“, sagte Felipe. „Und genau das will ich verhindern.“ Er traf Anstalten, sich wieder aufzurappeln.
Marco legte ihm die Hand auf die Schulter. „Sei vernünftig. Tu’s nicht. De Alvarez und de Mello werden es schon verhindern, daß der Kerl einen neuen Fehler begeht.“
„Aber sie kommen vors Kriegsgericht“, gab Felipe zu bedenken.
„Das werden wir ja sehen“, sagte der Mann aus Murcia. „Ich glaube es nicht. Vielmehr wird de Campos derjenige sein, der den kürzeren zieht.“
„Da bin ich mal gespannt“, brummte Felipe. Er war immer noch wütend, aber er sah doch ein, daß die anderen recht hatten. Er hatte ja nicht einmal ein Messer. Außerdem setzten ihm seine Blessuren noch zu. Wie sollte er in einem Zweikampf bestehen? Er war, wenn er es sich richtig überlegte, viel zu geschwächt. „Meinetwegen“, sagte er. „Ich lasse das Schwein vorerst in Ruhe. Aber er bleibt ja an Bord. Wenn ich irgendwo ein Messer erwische, jage ich es ihm in seinen fetten Wanst.“
„Fett ist er doch gar nicht“, warf Pablo ein.
Luiz musterte den häßlichen Kerl. „Kannst du nicht mal deine Schnauze halten?“
„Nein, wieso?“
Marco seufzte. „Du hast die blöde Angewohnheit, im unpassendsten Augenblick die dümmsten Sachen zu sagen. Aber du lernst es wohl nie.“
„Was denn?“ wollte Pablo wissen.
„Vergiß es“, erwiderte Felipe mit schiefem Grinsen. Er stand auf und stöhnte. Die Schmerzen meldeten sich wieder. „Verdammter Mist. Was ich brauche, ist ein Schluck aus der Pulle.“
Marco sagte: „Als Medizin? Ja, Rum wäre nicht schlecht. Warum versuchen wir unser Glück nicht mal schnell im Proviantraum?“
Luiz senkte etwas den Kopf. „Und wenn sie uns schnappen?“
„Wir dürfen uns eben nicht schnappen lassen“, sagte Felipe. „Los, packen wir’s.“
Gesagt – getan, sie schlichen zum Proviantraum. Der Proviantmeister der „Monarca“ befand sich an Oberdeck und half beim Verarzten der Verwundeten. Die Kombüse und der Vorratsraum waren verlassen. Diese günstige Gelegenheit nutzten die vier Kerle.
Sie stopften sich Schiffszwieback und Hartwurst in die Münder und spülten mit Wein und Rum nach. Nach dieser kurzen, hastigen Mahlzeit fühlten sie sich schon bedeutend besser.
„So, jetzt können wir weitersuchen“, sagte Marco.
„Ja, verflucht!“ stieß der Andalusier hervor. „Das hätte ich fast vergessen! Wo, zur Hölle, steckt Lopez?“
Die Frage blieb vorläufig unbeantwortet Luiz, Pablo, Marco und Felipe kehrten an Oberdeck der „Monarca“ zurück. Niemand hatte beobachtet wie sie den Proviantraum ein wenig geplündert hatten. Keiner behelligte sie. Sie spazierten auf der Kuhl herum und suchten nach Lopez.
Er war ein ordentlicher Kerl, dieser Lopez. Irgendwie hatten sich die vier von der „Trinidad“ mit ihm angefreundet. Und sie hatten ihn ja auch aus dem Kabelgatt befreit. De Campos hatte den armen Teufel einsperren lassen, weil er nachts angeblich auf der Wache geschlafen hatte.
Das war eine Unterstellung und bodenlose Gemeinheit. Lopez hatte beim Lenzen des Leckwassers mitgeholfen. Die „Sant Jago“ hatte sich mit Wasser gefüllt wie ein Bottich, die Männer an den Pumpen hatten höllisch schuften müssen.
So wären Luiz und Felipe fast ungesehen entwischt. Aber ausgerechnet de Campos hatte ja aufkreuzen müssen! Das war ausgesprochenes Pech gewesen.
Egal, dachte Felipe, als er an den Siebzehnpfündern der Kriegsgaleone entlangmarschierte. Wir haben noch mal Schwein gehabt. Einen Mordsdusel.
Einige Offiziere der „Sant Jago“ waren auf der „Monarca“ eingetroffen. Sie fragten nach ihrem Kommandanten. De Alvarez verwies sie an den Feldscher. Der Feldscher gab Auskunft und deutete auf das Vordeck.
„Er liegt im Krankenraum“, erklärte er. „Ihr Erster Offizier ist bei ihm, Señores.“
Die Señores begaben sich in den Krankenraum, denn es war ihre Pflicht, sich über den Zustand ihres hochverehrten Generalkapitäns zu informieren.
Inzwischen befand sich auch der Feldscher der „Sant Jago“ an Deck. Er half seinem Kollegen von der „Monarca“, die stöhnenden und jammernden Verwundeten zu behandeln.
Luiz, Felipe, Marco und Pablo traten zu ihm.
„Na, das nenne ich einen Zufall“, sagte der Andalusier. „So sieht man sich wieder, was?“
Der Feldscher der „Sant Jago“ schaute zu ihm auf und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Donnerwetter“, sagte er. „Wie geht’s denn?“
„Soweit ganz gut.“
„Die Haie haben dich verschont, wie?“
„Stimmt“, erwiderte der Andalusier. „Und das Seewasser ist gut gegen Degenstiche, nicht wahr?“
Ernst nickte der Feldscher. „Es reinigt die Wunden.“
„Hast du irgendwo Lopez gesehen?“ fragte Felipe.
„Lopez, den Decksmann?“
„Ja, den meine ich.“
„Ich habe ihn nicht gesehen“, antwortete der Feldscher.
Felipe und seine drei Kameraden blickten zum Riff. War Lopez etwa ertrunken? Oder hatten die Haie ihn gepackt und in die Tiefe gezerrt? Das hatte Lopez nicht verdient.