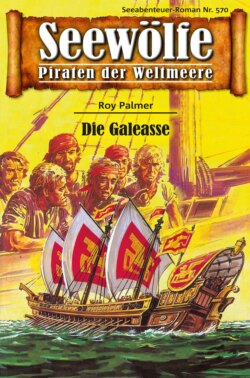Читать книгу Seewölfe - Piraten der Weltmeere 570 - Roy Palmer - Страница 7
2.
ОглавлениеPhilip Hasard Killigrew, der Seewolf, stand auf dem Achterdeck der zweimastigen Dubas und spähte mit dem Spektiv voraus. Vier Tage waren vergangen, nachdem die Arwenacks Piräus verlassen hatten. Sie segelten auf südlichem Kurs und schickten sich jetzt an, die Südspitze von Hellas zu runden.
Der Kutscher hatte dem Seewolf an diesem Morgen gemeldet, daß die Trinkwasserreserven allmählich zur Neige gingen. Hasard wollte frisches Wasser an Bord nehmen, ehe die Vorräte knapp wurden. Vielleicht ergab sich auch die Möglichkeit, jagdbares Wild aufzustöbern. Das wäre eine willkommene Abwechslung für die Mannen gewesen.
Allerdings hatte Hasard nicht vor, die Festlandküste anzusteuern. Eine größere Insel befand sich seines Wissens auf ihrem Kurs. Sie hieß Kithira. Diese Insel wollte er ansteuern. Nach dem Kartenmaterial zu urteilen, das er in Händen hielt, war sie groß genug. Mit Sicherheit gab es dort mindestens eine Trinkwasserquelle. Und wahrscheinlich lohnte es sich auch, auf die Pirsch zu gehen.
Kurz vor Anbruch der Mittagsstunde meldete Bill, der Ausguck: „Land voraus! Eine größere Insel!“
Hasard konnte die Umrisse der Insel jetzt ebenfalls schwach in der Optik erkennen.
„Gut“, sagte er. „Das muß Kithira sein. Kurs auf die Insel, Männer.“
Pete Ballie, der Mann am Ruder, nahm eine leichte Kurskorrektur vor. Die Dubas ging etwas höher an den Nordwind, der vom griechischen Festland wehte, und mit einer Geschwindigkeit von gut sechs Knoten glitt der Zweimaster auf die fremde Insel zu.
Ben Brighton, der Erste Offizier und Bootsmann der Crew, trat zu seinem Kapitän. „Die Frage ist, ob wir auf der Insel Bewohner antreffen“, sagte er.
„Und welche Gesinnung sie vertreten“, fügte der Seewolf hinzu. „Wir werden wie üblich mächtig auf der Hut sein müssen, bis wir nicht alles genau ausgekundschaftet haben.“
„Wie groß ist die Insel deiner Meinung nach?“ fragte Don Juan de Alcazar, der sich inzwischen ebenfalls zu ihnen gesellt hatte, den Seewolf.
„So groß wie die Insel Man?“ fragte Edwin Carberry, der Profos, mit dröhnender Stimme.
„Nicht ganz so groß“, erwiderte Hasard. „Ich würde sie eher mit der Insel Wight vergleichen.“
„Na, das ist ein ganz schöner Brocken“, meinte der Profos.
„Wir werden sie in ihrem ganzen Umfang nicht erforschen können“, sagte Ben.
„Stimmt“, pflichtete der Seewolf ihm bei. „Aber für uns ist die Hauptsache, daß wir eine geschützte Bucht finden, in der wir ankern können. Alles andere entscheiden wir vor Ort.“
Anderthalb Stunden später fanden sie den richtigen Ankerplatz für die Dubas. Der Zweimaster war inzwischen nur noch zwei Meilen von der Insel entfernt. Aufmerksam spähten die Mannen zu dem Land hinüber.
Ein paar kleinere Inselchen waren Kithira im Osten vorgelagert. Sie wirkten wie Wellenbrecher. Zwischen den winzigen Eilanden und der Hauptinsel war das Wasser völlig ruhig. Es wirkte wie eine große, polierte Platte aus Blei. Nur ein schwacher Wellengang leckte träge über den Sandstrand.
Kithira selbst bot ein Bild der Harmonie und Schönheit. Obwohl es November war, grünte auf der Insel noch alles. Das lag an den Olivenbäumen und Schirmpinien, die auf den Hängen wuchsen.
Hier und dort waren auch Orangen- und Zitronenbäume zu erkennen, die jetzt schon Früchte trugen. Aus den Wäldern im Inneren der Insel flatterten Vögel auf. Möwen umkreisten die Dubas.
„Ein feiner Platz“, sagte Big Old Shane, der ehemalige Schmied von Arwenack. „Und die Hügel da sehen ganz danach aus, als ob dort Fasanen nisten.“
„Auf einen Versuch kommt es an“, brummte Old Donegal Daniel O’Flynn. Er schaute sich mit dem bei ihm üblichen Mißtrauen um. „Aber sperrt die Augen und Ohren auf, Freunde. Hier ist es zu ruhig, sage ich.“
„Aha“, meinte Ferris Tucker, als hätte er es nicht anders erwartet. „Witterst du ein böses Omen? Liegt ein Fluch auf der Insel?“
„Red doch keinen Unsinn, Mister Tucker“, entgegnete der Alte mit ärgerlicher Miene. „Streng lieber deinen Verstand an. So eine üppige Insel – glaubst du, daß die ganz unbewohnt ist?“
„Nee“, erwiderte der rothaarige Schiffszimmermann mit einer Grimasse. „Sie ist das ideale Versteck für Schnapphähne aller Art.“
„Siehst du, du hast es schon begriffen“, knurrte Old O’Flynn.
„Andere Schiffe habe ich nirgends entdecken können“, sagte Dan, sein Sohn.
„Das will nichts heißen“, sagte der Seewolf. „Wenn es hier Piraten gibt, könnten sie ihren Schlupfwinkel auch auf der anderen Seite der Insel haben. Und möglicherweise hockt oben in den Bergen ein Späher, der uns längst gesichtet hat. Also – Klarschiff zum Gefecht und höchste Vorsicht!“
„Aye, Sir“, antworteten die Mannen.
Die Drehbassen waren ohnehin geladen. Die Zwillinge füllten die bereitstehenden Kupferbecken mit glühender Holzkohle aus der Kombüse, so daß die Lunten im Falle eines Gefechts sofort entfacht werden konnten. Musketen und Tromblons wurden feuerbereit in Griffnähe auf dem Deck gelagert.
Shane und Batuti, der schwarze Herkules aus Gambia, hängten sich ihre Langbögen aus englischer Eibe um. In den Köchern steckten Pulver- und Brandpfeile. Ferris Tucker plazierte seine Höllenflaschen auf dem Deck.
Hasard gab Al Conroy und Gary Andrews die Anweisung, auch ein paar Brandsätze zu holen. Für alle Fälle – und man konnte ja nie wissen, was sich noch ereignete. Schon oft hatten die Brandsätze, die die Mannen aus China mitgebracht hatten, gute Dienste geleistet und den Ausgang eines Kampfes entscheidend bestimmt.
„Jetzt sind wir gerüstet“, sagte der Seewolf. Er teilte doppelte Ankerwachen ein. Anschließend bestimmte er, wer an Land gehen sollte: Shane, Don Juan, die beiden O’Flynns, die Zwillinge, Carberry, Plymmie und er.
Ihre Aufgabe war es, eine Trinkwasserquelle zu finden. Danach würden sie Verstärkung rufen, und die Mannen sollten die leeren Fässer füllen und an Bord der Dubas schaffen. In der Zwischenzeit konnte Hasard mit seinem Landtrupp auf die Jagd gehen.
Im Südosten der Insel öffnete sich eine geräumige Bucht, die mehr als einem Schiff Platz zum Ankern bot. Hasard beschloß, diese Bucht anzulaufen. Jeff Bowie lotete die Wassertiefe aus – sie war ausreichend.
Durch die breite Einfahrt schob sich die Dubas in die Bucht. Ein breiter Sandstrand schloß sich wie ein Kranz um die Bucht. Oberhalb der Böschung standen windgebeugte Pinien und ein paar Palmen. Wieder flatterten Vögel auf. Weit und breit waren jedoch keine menschlichen Wesen zu sehen.
„Es gibt noch eine Möglichkeit“, sagte der Profos. „Daß nämlich keine Piraten, sondern Fischer auf Kithira leben. Und diese Fischer haben vielleicht griechischen Wein, den sie und verkaufen.“
Hasard lachte. „Das hast du dir ja fein ausgemalt. Na, hoffentlich behältst du recht.“
Kurz darauf drehte die Dubas mit eingeholten Segeln in der Bucht bei. Der Anker fiel. Hasard ließ das Boot abfieren und enterte mit seinen sieben Begleitern ab. Plymmie, die Wolfshündin, sprang mit einem kühnen Satz in das Boot. Sie ließ sich neben den Zwillingen nieder und hechelte.
Philip junior kraulte ihr das Nackenfell. „Na, Lady, du bist wohl auch neugierig auf die Insel, was?“
Plymmie schnaufte. Es klang wie eine Bestätigung.
Neugierig war übrigens auch Sir John, Carberrys Papagei. Zeternd flog er zum Ufer. Der Profos stieß einen Fluch aus.
„Verdammte Nebelkrähe“, knurrte er. „Mußt du immer so einen Höllenlärm veranstalten?“
Arwenack, der Schimpanse, klammerte sich mit trauriger Miene in den Wanten fest. Warum durfte er nicht mit auf die schöne Insel? Er konnte es nicht begreifen. Da half auch die trockene Feige nichts, die Mac Pellew ihm mitfühlend überreichte. Arwenack war beleidigt.
Das Boot glitt zum Ufer, die Mannen landeten. Sofort griffen sie zu den Waffen und sicherten zu den Bäumen. Die Musketenhähne knackten. Aber es geschah nichts. Nach wie vor blieb alles ruhig.
Plymmie lief am Strand auf und ab und suchte nach Spuren. Nichts – auch sie schien keine Gefahr zu wittern. Mit heraushängender Zunge kehrte sie zu dem kleinen Trupp zurück.
Hasard wandte sich zur Dubas um und gab den zurückbleibenden Mannen ein Zeichen. Alles in Ordnung, bedeutete es. Ben Brighton winkte zurück.
Der Seewolf führte seine Begleiter zu den Bäumen. Somit nahm das Unternehmen Kithira seinen Anfang. Der Trupp verschwand im Pinienwald. Die Mannen lauschten, ob sie irgendwo eine Quelle sprudeln hörten. Plymmie lief im Dickicht hin und her und suchte mit.
Die Luft war angenehm warm. Es duftete nach Orangen. Vögel zwitscherten. Ein Idyll – Kithira schien somit das Paradies schlechthin zu sein. Und doch täuschte der Eindruck. Bald sollte hier die Hölle los sein.
Im Inneren der Insel, etwa im Zentrum, erhob sich der höchste Gipfel. Zweihundertfünfzig Yards über dem Meeresspiegel – und am Rande einer Waldlichtung ragte eine riesige Pinie auf, auf die man klettern konnte. Einen besseren Aussichtspunkt hätte es nicht geben können.
Aus diesem Grund hockte auch der Kerl mit dem roten Kopftuch, der zu dieser Stunde Dienst als Ausguck hatte, in der Krone des Baumes. Er beobachtete alles durch seinen Kieker: wie die Dubas in die Bucht von Kithira einlief, wie sie ankerte und sich die acht Männer und der Hund an Land begaben.
Der Kerl mit dem roten Kopftuch hieß Piro. Er kannte sich auf Kithira aus wie kein anderer. Er war hier geboren. Früher hatte er sich seinen Lebensunterhalt als Fischer verdient. Später hatte er dann festgestellt, daß er auf diese Weise nie zu Wohlstand gelangen würde. Aus diesem Grund hatte er den Beruf gewechselt.
Piro stieß einen saftigen Fluch aus. Er spuckte aus, warf noch einen Blick durch das Rohr und schob es dann zusammen. Er verstaute den Kieker in seiner Tasche. So schnell er konnte, hangelte er am Stamm der Pinie nach unten. Dann eilte er nach Westen.
Durch Wald und Buschwerk führte sein Weg. Schließlich hastete Piro einen Pfad hinunter, der zu einer felsigen Bucht führte. In der Bucht ankerten Segler. Vier einmastige Pinassen. In der Felswand öffneten sich gähnende Mäuler – Höhlen. In diesen Grotten hauste die Bande, zu der Piro gehörte.
Der Posten, der vor dem Eingang der Haupthöhle stand, stieß einen Pfiff aus.
„Hallo!“ rief er. „Was gibt’s?“
„Wir kriegen Besuch“, erwiderte Piro.
„Das erzählst du Rosalba am besten selbst“, sagte der andere.
„Was meinst du, warum ich hier bin?“ zischte Piro.
Er betrat die Haupthöhle. In dem Licht, das von außen einfiel, waren die Kerle zu erkennen, die auf dem Boden hockten und würfelten. Es waren gut fünfzehn Mann.
Die übrigen Bandenmitglieder waren auf die anderen Höhlen verteilt. Insgesamt zählte die Meute vierzig Kerle. Kerle, die keine Skrupel und kein Erbarmen kannten, wenn es darum ging, Beute zu reißen.
Doch ihr Anführer war eine Frau. Piros Blick richtete sich auf sie. Rosalba hatte sich auf ihrem Lager ausgestreckt, träge und lasziv. Sie beobachtete die Kerle beim Spielen. Manchmal nahm sie einen Schluck Wein aus einem großen Becher zu sich.
Sie war ein hübsches Weib, diese Rosalba, schwarzhaarig und verführerisch. Aber wehe dem, der sich ihr mit eindeutigen Absichten näherte! Rosalba, die Piratin, traf selbst die Wahl, wenn sie mit einem ihrer Kerle ins Bett gehen wollte. Und das hing ganz und gar von ihrer Lust und Laune ab. Versuchte einer, sie mit Gewalt zu nehmen, so brachte sie ihn um.
Piro konnte sich an eine derartige Episode erinnern. Ein Grieche, der eines Tages neu zu der Bande gestoßen war, hatte geglaubt, ein großer Weiberheld zu sein, auf den die Frauenzimmer nur so flogen. In einer Nacht hatte er sich zu Rosalba geschlichen. Nur wenige Laute waren zu hören gewesen. Dann hatte Rosalba den Kerl in die Bucht geworfen. Als er sie gepackt hatte, hatte sie ihm mit dem Messer, das sie immer bereithielt, kurzerhand die Gurgel durchgeschnitten.
Die Kerle kannten ihre Anführerin. Alle wußten, daß Rosalba unerhört schnell war. Schnell mit der Pistole, schnell mit dem Degen, schnell mit dem Messer. Und schnell war sie auch mit den bloßen Fäusten.
Piro wußte, daß sie einen Kerl mit den Händen umgebracht hatte, als sie erst siebzehn Jahre alt gewesen war.
Mit Rosalba war nicht zu spaßen. Alle hatten einen immensen Respekt vor ihr. Keiner wagte, auch nur einen Witz über sie zu reißen. So hielt Rosalba die wilde Meute im Zaum. Sie regierte mit eiserner Hand. Die Kerle tanzten nach ihrer Pfeife. Sie waren ihr regelrecht hörig.
„Also los, spuck’s aus“, sagte Rosalba zu dem Kerl mit dem roten Kopftuch. „Was liegt an?“
„Ein Schiff“, entgegnete Piro. „Es ist eben in die Südostbucht eingelaufen.“
„Ein großer Kahn?“ erkundigte sich die Frau schläfrig. Die Nachricht schien sie nicht im geringsten zu beeindrucken. Aber Piro wußte, daß sie hellwach war.
„Ein Zweimaster“, erklärte er. „Eine Dubas, schätze ich.“
„Welche Flagge?“
„Es war keine zu erkennen“, antwortete Piro. „Ich weiß also noch nicht, aus welchem Land der Kahn kommt. Es sind etwa drei Dutzend Kerle an Bord. Sie haben auch einen Schwarzen dabei. Und einen Hund. Ach ja, und einen Affen und einen Papagei auch.“
Die Kerle, die lauschend die Köpfe gehoben hatten, stimmten ein brüllendes Gelächter an.
„Was ist denn das?“ johlte einer von ihnen. „Ein schwimmender Zirkus?“
„Fast könnte man’s meinen“, sagte Piro.
Rosalba war mit einem Satz auf den Beinen. Die Kerle verstummten sofort. „Wie sehen die übrigen Kerle an Bord aus?“ wollte sie wissen.
„Es sind Weiße“, erwiderte Piro.
„Glaubst du, daß sie Freibeuter sind?“
„Es könnte sein“, sagte der Mann mit dem roten Kopftuch.
„Wie ist die Dubas armiert?“ fragte Rosalba nun.
„Sie hat sechs Drehbassen“, wußte Piro zu berichten und fuhr fort: „Acht Kerle sind mit dem Beiboot gelandet. Der Hund ist bei ihnen.“
„Ich will mir selbst ein Bild von der Lage verschaffen“, sagte die Piratin.
Sie griff nach ihrem Degen und nach ihrer Pistole. Schnell teilte sie zehn Kerle ein, die sie begleiten sollten. Piro war natürlich dabei. Sofort brach die Gruppe zu dem Aussichtspunkt auf.
Die anderen lüden ihre Waffen und hielten die Augen nach allen Seiten offen. Wenn ein Schiff nahte, konnten auch weitere möglicherweise nicht fern sein, lautete ihre einfache Theorie. Das war Erfahrung.
Manchmal versuchten fremde Schnapphähne, auf Kithira zu landen und Fuß zu fassen. Rosalba und ihre Kerle hatten bisher noch jeden Rivalen verscheucht. Sie taten, als gehöre die Insel ihnen. Seit Jahren hatten sie ihren Schlupfwinkel in den Höhlen über der Felsenbucht.
Die Felsenbucht war ein ideales Versteck. Von der See konnte man nicht in die Bucht blicken und die Pinassen sichten. Hier war die Bande so sicher wie in einer Festung. Deshalb hatte Rosalba auch nie einen neuen Standort gewählt.
Gewiß, die Südostbucht zum Beispiel wäre ein bequemerer und wärmerer Platz gewesen. Aber wenn ein Angriff von See erfolgte, war man dort ziemlich ungeschützt.
Rosalba wußte genau, was sie wollte und was gut und richtig für ihre Bande war. Sie bestimmte die Strategie und Taktik, sie legte alle Pläne für die Raids zurecht, zu denen die Pinassen in unregelmäßigen Zeitabständen ausliefen.
Am liebsten überfielen die Piraten die Orte an der südlichen Festlandsküste. Sie mordeten, plünderten und brandschatzten. Dann verschwanden sie wie ein Spuk.
Bisher war keinem Gegner gelungen, sie zu fassen. Griechische Kriegsschiffverbände, die nach ihnen gefahndet hatten, waren immer erfolglos in ihre Heimathäfen zurückgekehrt.
Hin und wieder brachten Rosalba und ihre Kerle auch Einzelsegler auf. Sie enterten sie bei Nacht, metzelten die Besatzungen nieder und klauten, was es zu klauen gab. Wenn das Schiff etwas taugte, behielten sie es. So hatten sie auch die beiden Pinassen gekapert. Früher hatte der „Verband“ nur aus zwei Einmastern bestanden.
Rosalba, Piro und die anderen Kerle des Spähtrupps stiegen zu der Anhöhe hinauf. Hier kletterte Rosalba mit dem Kopftuchträger auf die Pinie. Aufmerksam betrachtete die Frau die Dubas, die in der Bucht vor Anker lag, durch den Kieker. Sie stieß einen leisen Pfiff aus.
„Griechen, Türken oder Russen sind das nicht“, sagte sie leise.
„Vielleicht Italiener“, meinte Piro.
„Nein. Engländer, Franzosen oder Holländer, von dem Schwarzen mal abgesehen.“
„Warum zur Hölle haben die aber eine Dubas?“ fragte Piro verdutzt. „Warum segeln sie nicht mit einer Galeone oder Karavelle?“
„Das weiß der Henker“, entgegnete die Anführerin. „Aber wir kriegen es schon noch raus, keine Sorge. Von dem Landtrupp ist übrigens nichts mehr zu sehen.“
„Satan“, fluchte Piro. „Die bewegen sich durch das Dickicht, und wir können sie dabei nicht beobachten.“
„Wir werden sie gefangennehmen“, erklärte Rosalba. „Aber wir müssen es richtig anpacken. Anfänger sind das nicht, das sage ich dir. Ich schätze, daß sie erfahrene Kämpfer sind. Irgendeinem billigen Trick gehen sie nicht auf den Leim. Und sie haben einen Hund.“
„Er sieht aus wie ein Wolf“, sagte Piro.
Rosalba ließ den Kieker sinken. „Dann hat er garantiert eine gute Nase. Wir dürfen uns von dem Biest nicht aufstöbern lassen.“
„Was hast du eigentlich vor?“ fragte Piro.
Rosalba grinste. „Ich will die Dubas. Sie ist ein gutes Schiff, das wir gebrauchen können.“
„Und die Kerle an Bord?“
„Die murksen wir alle ab“, erwiderte Rosalba gelassen. „Einen nach dem anderen.“