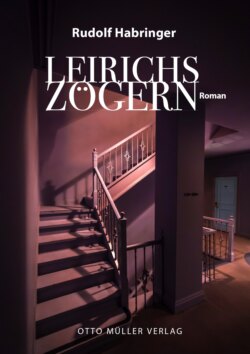Читать книгу Leirichs Zögern - Rudolf Habringer - Страница 7
2
ОглавлениеMorgens erwachte ich in diffuser Stimmung. Ich duschte, ich trank einen schnellen Kaffee, ich sah, dass die junge Frau in der Wohnung schräg gegenüber im Nachtgewand barfuß durch ihre Küche lief. Eine Fleischfliege krachte brummend gegen das Fenster. Mir fiel ein, dass Hanna in der frühen Pubertät versucht hatte, Fliegen mit bloßen Händen zu schnappen. Irgendwann einmal war es ihr zufällig gelungen, eine Fliege beim Abheben zwischen ihren Handflächen einzufangen. Ab da hatte sie an ihre Fähigkeit geglaubt, schnell genug zu sein, um spielend Fliegen zu erhaschen, obwohl ich ihr erklärt hatte, dass Fliegen mit ihren Facettenaugen die Bewegung unserer Hände gewissermaßen wie in Zeitlupe verfolgten und sich daher rechtzeitig aus dem Staub machen konnten. Ob meine Fliegenflugerklärung naturwissenschaftlich gesehen richtig gewesen war, wusste ich bis zum heutigen Tag nicht. Hanna hatte monatelang ihr Fliegenfangspiel fortgesetzt, bis sie begann, Wespen in Marmeladegläser zu sperren und in Gefangenschaft zu beobachten.
Ich ließ die Fliege in Ruhe. Obwohl alles für ein Frühstück in der Wohnung vorrätig war, ging ich aus dem Haus. Ein schöner Spätsommertag hatte begonnen, in einer Bäckerei bestellte ich Kaffee und eine Buttersemmel, die ich im Stehen aß. Ich hatte die irrwitzig egomanische Vorstellung, jemand könnte mir gratulieren, so wie man einem neugebackenen Vater zu seinem Nachwuchs gratulierte. Ich war über Nacht nicht Vater geworden, wohl aber Bruder eines Bruders. Eines offenbar älteren Bruders. Beim Aufstehen hatte ich das Foto noch einmal analysiert. Da lachte mein Vater vom Bildschirm, es war verrückt. Der Erwachsene in mir begriff bald, dass die Gratulationen ausbleiben würden. Die Verkäuferinnen in der Schnellbäckerei waren freundlich wie immer, aber sie gratulierten mir natürlich nicht. Nach dem Frühstück erfasste mich eine Stimmung nervöser Planlosigkeit, in der ich nicht in die Wohnung zurückgehen wollte, obwohl es jetzt endgültig Zeit war, die Unterlagen für die Lehrveranstaltungen durchzugehen. Die Nachricht von gestern hatte mich aber in einer Weise durchgerüttelt, dass ich, so kann man sagen, ordentlich durcheinander war.
Über die Jahre hatte ich mir ein System vorauseilender Schutzgedanken aufgebaut. Ich neigte dazu, jederzeit mit allem zu rechnen. Genauer gesagt, ich hatte Angst davor, ständig mit allem rechnen zu müssen, auch mit dem Schlimmsten. Ich malte mir aus, wie ich reagieren würde, wenn etwas sehr Schlimmes eintrat. Ich überlegte, wie ich mich am besten von vornherein so verhielt, dass das Schlimme nicht geschah. Oder, falls ich das Schlimmste nicht verhindern konnte, dass ich mich wenigstens so weit wappnete, dass ich es nicht mehr als das Schlimmste auffassen musste, weil ich ja bereits damit gerechnet hatte.
Im Internat hatte ich mir einmal in der morgendlichen Eile mit einer erst neu angeschafften Brille am Kopf die Haare gekämmt und die Brille in einem unbedachten Augenblick mit dem Kamm vom Kopf und zu Boden gefegt, wo ein Glas zu Bruch gegangen war. Eine Brille war teuer, natürlich hatten wir keine Bruchversicherung abgeschlossen und außerdem war ich durch den Glasbruch für mindestens einen Tag schwer sehbeeinträchtigt. Noch vor dem Spiegel, die Scherben zusammenklaubend, mit Tränen der Wut in den Augen, schwor ich mir, dass dieser Fall nie mehr eintreten sollte. Ich wertete diese Anekdote weniger als Beleg für ein vermeidendes, vorausschauendes Verhalten als das einer Konditionierung. Die unbedachte Bewegung hatte zur Folge, dass ich für immer lernte, vor dem Kämmen die Brille abzulegen.
Nicht das erste Mal, aber beinahe das erste Mal in meinem Leben, dass etwas wirklich Schlimmes geschah, war, als meine Mutter starb. Der Vorgang ihres Sterbens ereignete sich buchstäblich über Nacht. Das achtjährige Kind wusste zwar, dass die Mutter erkrankt war und am nächsten Tag ins Krankenhaus gehen sollte (die Ursache der Erkrankung war dem Kind unbekannt), daher verabschiedete ich mich von der Mutter mit einer Umarmung und einem Kuss, wie sich ein Kind von seiner Mutter abends verabschiedet. Der Unterschied zu anderen Abschieden lag offenbar in einem Satz, den die Mutter zu mir sprach und der später noch viele und verhängnisvolle Grübeleien im Kind, im Jugendlichen, im Erwachsenen auslösen würde: Du bist ja schon groß.
Es war der letzte Satz gewesen, den die Mutter zu mir gesprochen hatte. Daraufhin war ich in mein Zimmer und ins Bett gegangen. Als ich aufwachte, war die Mutter – nach dramatischen nächtlichen Ereignissen, von denen ich nichts mitbekommen hatte – bereits tot. Einmal noch, am Nachmittag des folgenden Tages, in der Prosektur des Krankenhauses, gab ich meiner toten Mutter einen letzten Kuss auf die Wange. Es war nicht das erste Mal, dass etwas Schlimmes geschehen war im Leben des Kindes, aber dieses Schlimmste war völlig unvermutet und, wie man sagt, aus heiterem Himmel geschehen. Der Himmel hatte sich verdüstert an diesem Tag, in einer Art, mit der nicht zu rechnen gewesen war. Besser: mit der das Kind nicht gerechnet hatte.
Mit diesem Geschehen hatte sich eine Erfahrung in das Kind eingebrannt, die für eine gesamte Lebensexistenz reichte: Es gab Dinge, mit denen zu rechnen war. Man konnte nicht vorsichtig genug sein, gegen das gewappnet zu sein, was einem zustoßen konnte. Meine Neigung, ständig mit dem Schlimmsten zu rechnen, war daher auch die Folge dieser traumatischen Erfahrung und mein Versuch, das Schlimmste vorausschauend zu bannen. Eine Art psychischer Trauma-Panzerung? Eine Trauma-Wappnung? Eine Schreckens-Prävention?
Aber warum bedeutete das Auftauchen eines möglichen Bruders etwas Schlimmes? Hatte ich mir nicht eben noch eingebildet, jemand könne mir zum Auftauchen des bisher nicht Existenten gratulieren? Mich ärgerte, dass ich mich gedanklich wieder einmal zu einer Art Opfer stilisiert hatte, etwas, das ich unbedingt vermeiden wollte. Ein Opfer ist passiv, stumm, dumpf und bewegungseingeschränkt. Als Kind hatte ich mich nicht und niemals als Opfer gefühlt. Ich hatte die Umstände meiner Existenz so akzeptiert, wie sie waren. Ich hatte ohnehin keine Wahl gehabt. Dem Vater waren gleich zwei Mal die Frauen gestorben. Systemtechnisch hatte es sich bei uns schon damals um eine Patchworkfamilie gehandelt, ohne dass der Begriff damals gebräuchlich gewesen war: Ulrike war das Kind aus Vaters erster Ehe, ich und Judith stammten aus der zweiten. Schicksalsmäßig schien das Unglück unserer Familie in den Zusammenhang des Dorfes eingepasst. Das Vergleichen, das Hineinrutschen in schicksalsretuschierende Fantasie-Biografien, mein mich Hineinreklamieren in fremde, erfundene Lebensläufe (mein Vater war Universitätsprofessor, meine Mutter Ärztin, ich habe in Wien, Cambridge und Singapur studiert und ein Auslandsjahr in den Staaten absolviert) begann erst viel später, als der Zustand meines jederzeit kündbaren Status als Lehrbeauftragter unmerklich chronisch zu werden begann.
Als Kind hatte ich also immer mit allem Vorstellbaren gerechnet, ausgenommen einem Krieg – der letzte war gerade einmal fünfzehn Jahre vor meiner Geburt zu Ende gegangen. Schnell begriff ich, dass das Unvorhergesehene, eine Katastrophe, ein Unglück, ein Schicksalsschlag nicht nur die eigene Familie, sondern auch andere, benachbarte treffen konnte. Da ereigneten sich tödliche Raserunfälle junger Burschen, da verstarben Kinder plötzlich im Kleinkindalter, da starb ein junges Mädchen beim Bad am Samstagnachmittag wegen einer defekten Gasleitung, während die ältere Schwester den Unfall, bewusstlos geworden, überlebte, da wurde der beliebte Pfarrer während der Silvesteransprache vom Schlag getroffen und verstarb eine Woche später.
Alles also war denkbar. Mit vielem hatte ich in der Folge gerechnet. Dass ich nun einen Bruder hatte, konnte daher keine Katastrophe bedeuten, war aber eine überraschende Pointe, mit der ich nicht gerechnet hatte. Ich war vorläufig froh, dass eine Hemmung (nicht zu wissen, wem ich die Geschichte meines neu aufgetauchten Bruders mitteilen sollte) eine andere aufhob (dass ich nämlich die Vorbereitung auf das neue Semester vor mir herschob).
Wenig später war ich am Institut. Zu Semesterbeginn wehte mich dort eine Stimmung an, als könne alles, und also auch das eigene Berufsleben, noch einmal von vorn beginnen, als gewährten einem Herbst- und Schulbeginn eine Chance auf einen Neuanfang. Diese Hochstimmung hielt wie ein warmer Föhnsturm aber bloß ein paar Tage an und flaute dann rasch ab. Denn allen kindlichen, kindischen Erwartungen zum Trotz lief natürlich der Institutsbetrieb nach kurzer Zeit wie gewohnt und die Stimmung kippte, die notorisch gut aufgelegten Sekretärinnen ausgenommen, in einen Modus, über den ich in der Lage gewesen wäre, ein Stück zu schreiben. Einen Titel für dieses Schauspiel – eine tragische Komödie? – hatte ich mir bereits zurechtgelegt: Die Fliehenden. Wer auch immer als Lehrender ohne fixe Anstellung an der Uni zu tun hatte, der wurde schon nach wenigen Wochen Unterrichtstätigkeit von einem schwer zu zügelnden Fluchttrieb ergriffen, als würde es sich bei der Universität um eine gefährliche Zone handeln, um ein kontaminiertes Gelände, auf dem man sich eine ansteckende Krankheit einhandeln konnte. Der heftigste Wunsch aller Lehrenden bestand tatsächlich darin, nach Ende der jeweiligen Unterrichtstätigkeit so rasch als möglich zu fliehen. Egal wohin. Nach Hause, in einen Garten eines Einfamilienhauses in der Vorstadt, in ein Fitnessstudio, auf ein Mountainbike, zu einem abstrusen Hobby, zu einer heimlichen Nebenbeziehung oder vielleicht sogar an einen heimischen Schreibtisch, wo eine unabgeschlossene wissenschaftliche Arbeit lag.
Nichts von dieser Flucht-Atmosphäre war an diesem Tag zu spüren. Noch hatte es keine nervige Konferenz gegeben, manche waren noch gar nicht aus ihren jeweiligen Urlauben zurückgekehrt und reizten die freie Zeit bis zum letzten Tag vor Vorlesungsbeginn aus.
An den Anschlagtafeln waren die Zettel des vergangenen Semesters längst abgenommen worden, jetzt hing dort wieder Zukunft: Die Stundenpläne des folgenden Studienjahres mit den Kürzeln der Lehrenden.
In der Teeküche und auf dem anschließenden Balkon standen einige Kollegen, darunter Gabriele, tiefgebräunt, und Holger Wuttke, der Hobbyradleistungssportler, offenbar über den Sommer noch eine Spur schlanker geworden. Ich schnappte Sätze auf, die eine Art Kurzzusammenfassung von Sommerurlauben waren: war nicht ganz so toll, aber das Wetter hat uns entschädigt / ein paar Höhenmeter habe ich schon zusammengebracht / du kannst hinkommen, wo du willst, die Deutschen sind schon da (ein Satz, der gegen Holger gerichtet war) / und das Beste war dann, als … / das Übliche halt / Familie, verstehst du …
Jemand drückte mir einen Becher in die Hand und goss Kaffee ein, jemand legte mir kurz die Hand auf die Schulter: Und bei dir?
Bei Gabriele riskierte ich einen zweiten Blick. Sie war umringt, sie war besetzt, aber sie zwinkerte mir kurz zu: Ich interpretierte ihr Zwinkern als Zeichen eines Einverständnisses über unser sommerliches Erlebnis. Im Vorbeigehen drückte sie mir den Oberarm, eine Berührung, die ich als angenehm empfand. Ich überlegte kurz, wie viele der Anwesenden mich je anfassten, wen ich überhaupt nicht anfassen würde und bei welchen Kolleginnen eine Berührung vielleicht sogar als Übergriff interpretiert werden und notgedrungen eine unmittelbare Nachberührungsentschuldigung nach sich ziehen würde.
Ich klinkte mich aus der lauten und unstrukturierten Unterhaltung aus, noch ehe ich richtig eingestiegen war. In der Straßenbahn hatte ich in der Gratiszeitung von einer Umfrage gelesen, laut der ein Drittel der Österreicher im Urlaub einmal eine Romanze erlebt hatte. Was genau mit dem Begriff Romanze gemeint war, war dem Artikel nicht zu entnehmen gewesen. Der Titel des Textes hatte etwas holprig Ein Drittel der Österreicher hatte schon eine Romanze im Urlaub gelautet. Für einen Moment sah ich mich im Lehrsaal zu meinen Studierenden sprechen: Die Art und Weise, wie wir über Wirklichkeit sprechen, ist Konstrukt. Genauso richtig (und so holprig) wäre es gewesen, Zwei Drittel der Österreicher hatten noch keine Romanze im Urlaub zu titeln. Die Überschrift war natürlich nicht gegendert gewesen. Ich sah noch einmal zu Gabriele hinüber und fragte mich, zu welchem Drittel sie wohl in diesem Sommer gezählt hatte. Ihr Mann arbeitete als Geschäftsführer einer Firma, die Kinder waren aus dem Haus, ihr Leben, gesettelt und abgesichert, war aber von einer steten unglücklichen Unruhe angekränkelt.
Unvermutet fielen mir mein Vater ein und sein offenbarer Sohn: Hatte es vielleicht in Vaters Leben eine Romanze gegeben, von der ich bisher nichts gewusst hatte? Wer war denn die Mutter gewesen? Und wenn Preinfalk Vaters erster Sohn war, war ich wohl ab jetzt der Zweitgeborene. Der Gedanke mutete seltsam an.
Beim Fußweg zurück zur Straßenbahn durchströmte mich ein kurzes Gefühl der Dankbarkeit, dass ich Holger Wuttke für diesen Tag ausgekommen war. Gleichzeitig schlug mein Vorurteilsbarometer aus. Auf meiner privaten Ressentiment-Skala stand Wuttke relativ weit oben. Es gab kaum eine Sitzung, in der einem Wuttke nicht einen Ratschlag erteilte, wie etwas zu bewerkstelligen, einzuschätzen, abzuhandeln, zu wuppen war, wie er gern sagte. Egal ob es sich um Fachliches oder Privates handelte, Wuttke wusste (auch unaufgefordert) Bescheid. Unsere gegenseitige Sympathie hielt sich in engen Grenzen, obwohl ich den offenen Konflikt mit ihm vermied. Für mich war er ein Klugscheißer, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob meine Abwertung nicht doch einem Minderwertigkeitsgefühl entsprang: ich war nicht so eloquent, nicht so taff, nicht so schlagfertig wie Wuttke. Er wusste Bescheid, ich hatte oft keine Ahnung. Er wusste, wie das Leben (auch anderer) zu optimieren war, ich wusste es nicht einmal für mich, ich lavierte mich wie ein blinder Maulwurf dilettierend durch die enge Röhre meines Lebens. Wie Wuttke mich einschätzte, wollte ich lieber gar nicht wissen.
In der Straßenbahn betrachtete ich eine Frau mit Kopftuch, die mir gegenüber saß. Das Tuch, das ihr Haar vollständig verhüllte, betonte ihre schönen, dunklen Augen. Kurz trafen sich unsere Blicke. Schnell schaute sie weg. Ein paar Stationen noch betrachtete ich ihr Gesicht, wie es sich im Fenster spiegelte. In meiner Fantasie betrat gleich darauf eine Abordnung der Moralpolizei das Abteil und unterzog mich einer Kontrolle. Für einen Moment hatte ich eine mir fremde Frau zu lange angeschaut und das Delikt Blickbelästigung ausgelöst. Die Welt war kompliziert. Ich wurde gerade noch einmal abgemahnt.
Im Internet war ich auf eine Liste von 13 Dingen gestoßen, die mental starke Menschen unbedingt vermeiden sollten. Beim Surfen im Netz ging ich immer wieder den Listen und Aufzählungen über Dinge und Sachen auf den Leim, die man entweder kennen, kosten, besuchen, kaufen, essen oder strikt vermeiden sollte. Zahlen spielten in diesen Auflistungen eine große Rolle, etwa die Zahl 111, oder aber, wie in diesem Fall, die Zahl 13. Hier schwang die Bedeutung als Unglückszahl mit. Das Netz war voll von moralischen Imperativen. Früher waren diese strengen Vorschriften von den Kirchenkanzeln verkündet worden. Heute hatte das Netz die Funktion einer moralisierenden Instanz übernommen. Jetzt posteten viele Menschen, die sich längst von den moralischen Anmaßungen der Amtskirchen verabschiedet hatten, freiwillig diese Verhaltenslisten, die das Leben in Anweisungen und Verbote schieden. Ich notierte im Kopf den Begriff Säkularkatechismus.
Von den Dingen, die jeder mental Starke unbedingt vermeiden sollte, hatte ich nichts über das Anschauen/ Anstarren/Beobachten in der Straßenbahn gelesen. Dafür gab es den Hinweis, dass man keine Zeit daran verschwenden sollte, in Selbstmitleid zu baden. Vielleicht badete ich allein durch den Vorgang, dass ich mich innerlich rechtfertigte, die fremde Frau zu lange betrachtet/angesehen/angestarrt zu haben, in Selbstmitleid, das sich als Selbstzensur tarnte.
Ein weiterer Punkt, den ein mental starker Mensch unbedingt vermeiden sollte, war, auf der Vergangenheit herumzureiten, so wörtlich. Ich überlegte, wie sich diese Anweisung auf meine Profession, die Geschichtswissenschaft, auswirken würde. Ob man sagen konnte, dass ein Historiker auf der Vergangenheit herumritt (warum war für dieses Verdikt eigentlich eine Metapher aus der vorindustriellen Zeit verwendet worden?)? Oder aber es war unausgesprochen klar, dass es sich gerade bei Historikern um eine mental schwache Gruppe handelte. Ich versuchte, mir einen redlichen Historiker vorzustellen, der nicht in der Vergangenheit herumritt. Kurz darauf stellte ich mir einen Selbsthilfegesprächskreis mental schwacher Historiker vor, bei dem die Teilnehmer (und innen!) gegenseitig an, auf und in ihren Vergangenheiten herumritten. Ich brach meinen Versuch wegen Ermüdung ab.
Kurz nachdem die Frau ausgestiegen war (ich hatte sie nach der Begegnung mit der Moralpolizei weder direkt noch gespiegelt im Fenster ein weiteres Mal betrachtet), fiel mir ein, dass ich unversehens eine Hauptrolle in dem Stück Die Fliehenden übernommen hatte. Ich war nämlich der Erstfliehende gewesen, ich hatte die kaffeetrinkende, ihre gefilterten Urlaubserinnerungen als konstruierte Erzählungen vor sich hertragende Gruppe als erster verlassen und war als Erstfliehender sogleich in das Netz meiner herbeifantasierten Tugendaufsicht geraten.
Bei der Fahrt über die Donaubrücke überlegte ich, wie ich mit der Nachricht von gestern weiter vorgehen sollte. Ich ertappte mich dabei, zu sehr in aufschiebende Fantasien zu fliehen. Ich nahm mir vor, am Abend meine Schwester Ulrike anzurufen. Gleichzeitig fehlte mir der Plan, wie ich ihr die Nachricht stecken sollte. Weißt du eigentlich, dass wir noch einen Bruder haben? Allein diesen Satz auszusprechen, kam mir nahezu unmöglich vor. Ich blickte mich um. Vielleicht saß der neue Bruder ein Stück weiter vorne in der Straßenbahn. Oder ein naher Angehöriger von ihm. Vielleicht war ich diesem Bruder in meinem Leben schon einmal begegnet, ohne es zu ahnen. Wo? In der Straßenbahn? Im Supermarkt?
Dann läutete mein Handy. Entgegen meiner Gewohnheit, in der Straßenbahn nicht zu telefonieren, hob ich ab. Am anderen Ende der Leitung war Herr Meilinger, der Veranstalter meines Vortrags vom Vortag.
Schöner Abend gestern, sagte Meilinger. Und der Besuch war ja auch ganz ok.
Vielen Dank, sagte ich. Jetzt fiel mir ein, dass ich am Vortag ein seltsames Zucken in seiner Wange bemerkt hatte.
Weswegen ich anrufe, sagte er: Sie haben einen Knirps liegen lassen. Sie können sich den jederzeit bei uns abholen. Wir haben ihn in der Sakristei verwahrt. Für den Fall, dass niemand da sei: Vielleicht ist ja die Reserveorganistin der Pfarre zugange, so Meilingers Ausdrucksweise. Die sitze fast jeden Tag an der Orgel.
Jetzt war ich erstaunt. Tatsächlich hatte ich einen Knirps bei mir gehabt, aber geglaubt, ich hätte ihn in meiner Tasche verstaut.
Vergisst man ja leicht, sagte Meilinger.
Kurz überlegte ich, ihm von der Frau zu erzählen, die mich gestern angesprochen hatte. Vielleicht kannte er sie. Noch während ich überlegte, hatte er auch schon wieder aufgelegt. Er sei in Eile.
Pflichtbewusst – ich wollte ja abnehmen – verzichtete ich auf den Lift und ging zu Fuß in meine Wohnung hinauf. Um mich vom anstrengenden Aufstieg abzulenken, kippte ich in das Spiel, wen und ob ich dieses Mal jemand im Stiegenhaus antreffen würde. Es wohnten Leute im Haus, denen ich monatelang nicht begegnete. Dann wieder traf ich einen Nachbarn gleich mehrere Tage hintereinander. Viele, die in den oberen Stockwerken wohnten, sah man noch seltener, sie fuhren ja Lift.
Dieses Mal begegnete ich Hüsch, der abwärts ging. Wenn ich ihn sah, musste ich nicht nur an seine Frau, sondern auch an den vor einigen Jahren verstorbenen Kabarettisten gleichen Namens denken und überlegen, ob die beiden vielleicht miteinander verwandt waren. Hüsch trug einen Namen, der zu seinem schleichenden Gang ideal passte: Er huschte regelrecht über die Stufen, gerade dass er nicht, wie wir es als Jugendliche im Internat gemacht hatten, in Pantoffeln die Treppen hinunterrutschte. Wie immer trug er einen grauen Anzug, dazu eine schmale, aus der Mode gekommene Krawatte. Er wirkte wie eine aus dem Fundus geholte Figur aus einem Bürofilm der frühen sechziger Jahre. Er trug tatsächlich eine abgewetzte Aktentasche, die vollends dem Klischee entsprach. Die Tasche hielt er ängstlich an die Brust gepresst. Es hätte nicht gepasst, dass wir uns laut grüßten, kurz trafen sich unsere Blicke.
Später ging ich in die Küche und bereitete mir ein Käsebrot zu, das ich im Stehen aß. In der Wohnung schräg gegenüber saß die Nachbarin am Küchentisch und telefonierte. Sie fuhr sich mehrmals mit der Linken durch ihren blonden Schopf. Die nackten Füße hatte sie auf den Tisch gelegt. Vom Fenster der Toilette sah ich in den Innenhof hinunter. Unten im Büro der Privatdetektei brannte Licht. Das Büro im Erdgeschoß im Haus gegenüber hatte einiges mitgemacht. Früher hatte sich dort ein Sexshop befunden, mit dem Niedergang der Videoindustrie hatte der Laden Pleite gemacht. Ein Bestattungsunternehmen hatte sich kaum ein Jahr lang gehalten, aus mir unbegreiflichen Gründen. Gestorben wurde ja nach wie vor. Anschließend war ein Privatdetektiv in den Laden eingezogen, der vor wenigen Jahren einen spektakulären Abgang geliefert hatte. Der Mann, ein auffälliger Glatzkopf, dessen Name skurrilerweise mit dem eines österreichischen Olympiasiegers im Judo ident war, war bei einer Observierung erschossen und in einem Waldstück an der tschechischen Grenze aufgefunden worden. Der Mord war bis zum heutigen Tag nicht aufgeklärt worden. Ein junger Türke führte den Laden seither weiter.
Dann nahm ich mir doch die Mappe mit meinen Semestervorbereitungen vor, ein Vorgang, der mich beruhigte. Ich hatte die Proseminare sorgfältig erarbeitet. Es würde mir leicht fallen, sie routiniert abzurufen.
Draußen war es bereits ganz dunkel geworden. Die junge Frau in der Wohnung gegenüber hatte das Licht in der Küche abgedreht, aus einem anderen Raum fiel ein schmaler Streifen Licht, den ich an der Decke wahrnehmen konnte.
Später rief ich Ulrike an, meine ältere Schwester, die seit über zwanzig Jahren in Passau lebte und dort an einem Gymnasium unterrichtete. Manchmal telefonierten wir wöchentlich (als es mit Ariane und mir abwärts ging), dann gab es wieder Zeiten, in denen wir monatelang nichts voneinander hörten.
Sie klang verwundert, als sie abhob. Hast du kurz Zeit, fragte ich.
Aus irgendeinem Grund verschlug es mir plötzlich die Stimme: einerseits wortwörtlich, denn ich musste mich plötzlich räuspern, andererseits im übertragenen Sinn. Kaum hatte sie gesagt, dass sie Zeit zum Reden hätte, wusste ich, dass ich ihr noch nicht berichten konnte, was mich seit gestern beschäftigte. Ich entschied mich blitzartig für höfliches Plaudern. Mir erschien alles noch zu diffus, zu unklar. Ich wollte erst mehr Informationen haben. Mehr über den Vater erfahren, mehr über den Bruder. Mit so einer Bombenmeldung wollte ich Ulrike nicht am Telefon kommen. Ich wollte sie nicht belasten. Ich würde ihr erst von der Geschichte erzählen, wenn ich mir selbst ein Bild über den Bruder gemacht hatte.
Wie geht’s dir, sagte ich.
Geht so, sagte sie. Das Schuljahr läuft. Sie haben mir wieder mehr Musikstunden draufgedrückt, sagte sie. Bring du mal Dreizehnjährige zum Singen. Sie lümmeln herum, starren dich an oder bearbeiten ihr Handy. Aber als Sozialarbeiterin werde ich nicht bezahlt, sagte sie.
Und Kurt, fragte ich. Kurt war Beamter im Rathaus. Dort war er in der Verrechnung tätig. Irgendwie hatten wir es über die Jahre nicht geschafft, miteinander in Kontakt zu kommen. Wenn wir einander trafen, redete ich ihn auf das letzte Hochwasser an (ein letztes Hochwasser hatte sich in Passau immer ereignet), er wiederum stichelte in Sachen Fußball. Er als Bayernfan tat sich leicht, für ihn gehörte ich zu den Ösis, die seit ewig nicht mehr gegen die Deutschen gewonnen hatten. Und unser städtischer Fußball lag seit Jahren darnieder. Die Mannschaft war sogar in die dritte Liga abgestiegen und hatte gerade erst wieder den Aufstieg in die zweite Liga geschafft.
Ulrike rapportierte kurz, dass Kurt am Knie operiert worden wäre, aber sich schon wieder aufs Rad geschwungen hätte, und schwenkte dann auf ihre Kinder um. Ich hatte die zwei, beide etwas älter als Hanna, völlig aus den Augen verloren. Der Sohn studierte offenbar in Berlin und die Tochter war dabei, trotz Baby ihr Soziologiestudium abzuschließen.
Ulrike erzählte und lachte ein bisschen, ihrem dunklen Alt hörte ich gern zu. Jedes Mal fiel mir auf, wie sich ihr Akzent dem Bairischen mehr und mehr annäherte, obwohl auch sie, die so lange schon in Passau lebte, dort noch immer als die Österreicherin wahrgenommen wurde. An ihrer Schule galt sie als Expertin für österreichische Literatur. Gemeinsam mit einem Kollegen führte sie auch den Theaterkurs. Einmal hatte sie sogar Nestroys Die schlimmen Buben in der Schule aufgeführt: Die Bayern packen’s halt nicht ganz, das Wienerische, hatte ihr Kommentar damals gelautet.
Und was ist mit dir, fragte Ulrike dann.
Das Semester beginnt, du kennst das ja, sagte ich ausweichend.
Dann kam auch schon ihre peinigende Frage: Und wie geht’s dir mit den Frauen? Das schien Ulrike immer am meisten zu interessieren. Eine Frage, die mir umso unangenehmer wurde, je länger die Scheidung zurücklag.
Die Organisation unseres Alltags, das Gefühl, dass keiner mehr zu dem kam, was ihn ausmachte, hatte die Beziehung zu Ariane zermürbt. In diesem Gezerre um Zeit hatte ich, so sah ich es, den Kürzeren gegen meine taffe Frau gezogen. Jahrelang konnte ich veröffentlichten Studien entnehmen, dass Frauen weniger als ihre Männer verdienten, sich mehr um ihre Familien kümmerten, dass die Gesellschaft männlich dominiert war und so weiter. Statistisch gesehen hatte ich gegen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nichts vorzubringen. Mich ärgerte nur, dass ich laut diesen Statistiken so gut wie nicht existierte. Ökonomisch war bei uns nämlich das Gegenteil der Fall. Ariane hatte immer eine volle Anstellung gehabt, ich hatte mit meinen paar Stunden Lehrauftrag gerade einmal die Grundlage für meine Sozialversicherung geschafft gehabt, mich ansonsten aber auf jahrelanges Jobben auf Werkvertragsbasis eingelassen: eine Sackgasse, wie ich leider zu spät bemerkte. Ich werkte da an einem Beitrag für einen Ausstellungskatalog, arbeitete dort an einer Recherche für eine Ausstellung oder zeitlich begrenzt an einem Forschungsprojekt eines zeitgeschichtlichen Institutes. Gemeinsam war diesen Tätigkeiten, dass sie alle schlecht bezahlt waren. Am Ende dieser Einbahn winkte die Mindestrente.
Aber ich wollte schon lange nicht mehr auf diese Phase meines Lebens angesprochen werden. Und auch nicht auf meinen anhaltenden Status als Single.
Ich merkte, dass ich Ulrike gar nicht mehr richtig zuhörte. Vielleicht sollte ich auch etwas sagen. Wie wäre es, wenn wir uns wieder einmal treffen, vielleicht auch außerhalb der Feiertage, fragte ich. Was meinst du dazu? Ulrike schien erstaunt, aber nicht abgeneigt.
Judith, unsere jüngere Schwester, würde ich benachrichtigen. Vielleicht konnten wir uns an einem der nächsten Wochenenden zu einer Wanderung irgendwo im Donautal verabreden.
Das fällt dir jetzt einfach so ein, fragte Ulrike verwundert.
Eigentlich schon, sagte ich ausweichend.
Oder hat es doch was mit einer Frau zu tun, bohrte sie nach. Sie konnte es nicht lassen. Wir vereinbarten, dass wir uns per Mail verständigen würden. Kurz darauf legte ich auf.
Ich ging unruhig in der Wohnung herum. Draußen war es stockdunkel geworden. Für heute schien es mir zu spät, ich hatte keine Lust mehr, jetzt noch Judith anzurufen, die abends selten zu Hause war. Sie lebte als Single mit einem starken Bedürfnis nach Menschen. Ihr Verschleiß an Bezugspersonen und unglücklichen Männerbekanntschaften war groß.
Ich schaltete den Fernseher ein und zappte/tappte in eine Sendung, in der in einer abgelegenen, dünn besiedelten Gegend in Deutschland besorgte Bürger vor ihren Einfamilienhäusern mit Doppelgaragen standen und freimütig vor der Kamera bekannten, dass sie sich vor Überfremdung fürchteten. Viele Bewohner von Vorpommern, glaubte ich zu wissen, hatten sich noch während und nach dem Krieg als Flüchtlinge aus Polen, Schlesien und Ostpommern im Osten Deutschlands angesiedelt. Ich wunderte mich, warum mir in diesem Moment der selten gewordene Ausdruck freimütig eingefallen war, und schaltete den Fernseher aus. Jetzt streifte mich die Vorstellung, ich kuratierte eine Ausstellung mit aus der Mode gekommenen Ausdrücken, zu denen unter anderem die Worte gnadenlos, ungnädig und freimütig gehörten. In einer eigenen Vitrine sollten Worte präsentiert werden, die Ausdruck eines freudigen Erstaunens waren, also Stimmungsaufheller. Darunter sollten ebenfalls Worte sein, die früher auf dem Land verwendet worden waren: Höllteufel! Kreuzteufel! Sapperlot! Sie waren längst von wow, cool, krass, abgefahren oder heftig abgelöst worden. In einem speziellen Giftraum sollten die Worte ausgestellt werden, die angesichts der sogenannten Flüchtlingskrise durch die Medien kursierten, Vokabel des neuen Volksbewusstseins: Flüchtlingsstrom, Flut, Gutmensch, Asyl-Industrie, Welcome-Klatscher, Kulturbereicherer, Human-Neurotiker und- soweiter.
Als ich das Fenster öffnete, hörte ich das Folgetonhorn eines Rettungswagens. Mit der kühlen Abendluft kamen leider auch einige Stechmücken ins Zimmer. Ich schloss das Fenster, setzte mich ans Klavier und spielte ein paar Takte von Both Sides Now von Joni Mitchell. Vor ein paar Tagen hatte ich eine Aufnahme dieser Nummer des Pianisten Fred Hersch im Netz gefunden, der aus diesem Hit der Folksongwriter-Ära eine gefinkelt harmonisierte Jazzballade im Dreivierteltakt gemacht hatte.
Später ging ich in die Küche und holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank. Ich stellte es auf die Anrichte und suchte nach dem Öffner. Ich sah meinen Vater vor mir, der sein Abendessen gern an der Kredenz stehend eingenommen hatte. Ich sah mich auf der Eckbank in der Wohnküche unseres Hauses sitzen, wie ich den Vater betrachtete, der jausnend an der Anrichte stand. Mit dem Alter war er langsam und bedächtig geworden, er war schnell gealtert, nicht vergleichbar mit den fitten und aktiven Senioren von heute.
Ich erinnerte mich daran, wie ich mich um ihn bemüht hatte, als ich etwa zwanzig Jahre alt gewesen war. Vater hatte sich in sich verkrochen, war einsilbig geworden. Judith gegenüber hatte er einmal angedeutet, dass er sich einsam fühlte. Wahrscheinlich hätte heute ein Arzt eine Depression diagnostiziert und ihm Stimmungsaufheller verschrieben. Ich studierte in Wien und war selten zu Hause, mein Freundeskreis bestand ausschließlich aus Studenten, daheim fehlte mir der Anschluss an Gleichaltrige. Judith lebte bei Vater daheim, sie war bereits befreundet mit einem Mann, mit dem sie später ein paar Jahre zusammenwohnte. Sie verbrachte ihre Zeit oben in ihrem Zimmer, Vater hauste in der Küche. Dennoch war sie aber am meisten von uns in unsägliche Kämpfe mit ihm verwickelt, seinen Launen, seinen gelegentlichen jähen Ausbrüchen ausgeliefert.
Wenn ich nach Hause kam, versuchte ich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich spürte, dass den Vater am Ende seines Lebens etwas bedrückte. Etwas, das man wohl die Summe seines Schicksals nennen konnte. Natürlich brachte ich seine Niedergeschlagenheit oft mit dem frühen Tod seiner Frauen in Zusammenhang. Der junge Mann, der ich war, wollte seinem Vater nahekommen. Beim Kartenspielen war er manchmal aus der Reserve zu locken. Während wir spielten, begann ich Fragen zu stellen. Über seine Jugend, über seine Erfahrungen im Krieg. Gelegentlich legte ich meinem Vater, der immer auch geschichtlich interessiert gewesen war, obwohl er keine höhere Schulbildung erhalten hatte, ein Buch auf den Tisch. So hatte er etwa die Erinnerungen von Simon Wiesenthal gelesen, ich hatte ihm, der im Krieg als Sanitäter gedient hatte, Die Prüfung von Willi Bredel, Anna Seghers’ Das siebte Kreuz und Feuchtwangers Die Geschwister Oppermann zu lesen gegeben.
Wir spielten Karten und ich stellte Fragen und versuchte, etwas aus dem Vater herauszubekommen. Ohne zu wissen, wie das ging, bemühte ich mich, seine Stimmung aufzuhellen. Einmal während der Weihnachtsferien – an der Universität war ich gerade mit der Methode der Oral History vertraut gemacht worden – schlug ich ihm vor, ihn über seine Lebensgeschichte zu befragen. Ich stellte einen Kassettenrekorder auf und bat den Vater zu einem Interview. Das erste Interview hatte vielleicht eine Dreiviertelstunde gedauert. Dann hatte es eine Unterbrechung gegeben. Wir hatten eine Fortsetzung vereinbart, zu der es nie gekommen war.
Aus nicht geklärten Gründen hatte sich die Kassette dann zu denen gesellt, mit denen ich Musik aus dem Radio, Jazzsendungen des Bayerischen Rundfunks und des ORF, aufnahm. Unglücklicherweise und unbedacht hatte ich später ausgerechnet das Interview mit dem Vater fast zur Gänze gelöscht. Geblieben waren bloß die letzten Minuten vor der Unterbrechung. An dieses verbliebene Aufnahmefragment mit meinem Vater musste ich denken, als ich durch die Wohnung ging. Irgendwo in einer Kiste, irgendwo in einem Regal, musste diese Kassette liegen, eine der wenigen Tonaufnahmen, auf der die Stimme des Vaters gespeichert war. Heute war auf den Festplatten der Welt alles aus dem Leben einer Familie tausendfach festgehalten, von der Wiege bis zur Bahre. Aus dem Leben des Vaters existierten ein paar wenige Fotos aus einem Kriegslazarett, aber keine einzige Aufnahme aus der Kindheit, und nur ein paar wenige Fotos aus der Zeit mit seinen Frauen.
Ich zog ein paar Schubläden aus den Schränken und begann plötzlich, diese Aufnahme zu suchen. Mir war damals wahrscheinlich nicht ganz klar gewesen, warum ich den Vater befragen wollte. Vielleicht wollte ich nur ein Tondokument sichern. Vielleicht trug ich eine Ahnung eines Familiengeheimnisses in mir, vielleicht hoffte ich, der Vater, der in seinen letzten Jahren traurig wirkte und sich mit Rotwein abdämpfte, würde sich mir öffnen oder ich könnte durch meine Befragung für ihn eine Tür zu dem Raum aufstoßen, in dem er sich lebendig fühlte. Ich als Sohn hatte die wahnwitzige Vorstellung gehabt, meinem Vater helfen zu können. Die Kassette fand sich nicht, in einer Lade fiel mir aber ein zusammengefalteter Packen Papier in die Hand, den ich jahrzehntelang nicht beachtet hatte.
Anlässlich seiner Pensionierung hatte der Vater sich von den Bewohnern der Gemeinde, in der er als Sekretär und also rechte Hand von zwei Bürgermeistern fast dreißig Jahre lang tätig gewesen war, mit einer persönlichen Lebensskizze verabschiedet, die er an jeden Haushalt verschickt hatte. Ich war damals gerade frisch an die Universität gekommen und hatte die Pensionierung meines Vaters nur nebenbei miterlebt und auch nicht begriffen, welche Rolle dieser Einschnitt in seinem Leben gespielt hatte. Seinen Lebenslauf hatte ich damals eher beiläufig gelesen, aber wenigstens nicht weggeworfen, sondern in irgendeine Lade gesteckt. Diese Biografie war bis zum heutigen Tag eines der wenigen Dokumente, die mich direkt an ihn erinnerten.
Nach vielen Jahren nahm ich nun Vaters Lebenserinnerungen wieder in die Hand und begann zu lesen. Seine sechzehnseitige Broschüre war gestaltet wie das Informationsblatt, das damals in der Zeit vor Computerprogrammen und Druckern regelmäßig an die Bewohner der Gemeinde ausgesandt wurde. Die Blätter waren auf Matritzen abgezogen worden. Die Abzugmaschine dazu stand in einer Ecke des Amtsraumes. Auf dem Fensterbrett im Amtsraum, mit Blick in den Garten hinter dem Gemeindeamt, war ich als Kind oft gesessen und hatte dort in Büchern geschmökert. Der Platz hinter der Abzugmaschine war für mich der ideale Ort für Lesenachmittage. Dort verschlang ich meine ersten Karl-May-Romane. Nebenbei verrichteten die Kollegen meines Vaters ihre Arbeit. Ich saß also in einem öffentlichen Amtsraum.
Der Vater richtete sich mit seiner Lebensskizze an alle Gemeindebewohnerinnen, nannte zuerst die Frauen, dann die Männer und sprach ausdrücklich auch die Jugend und die Kinder an. Die ersten Sätze dieser Skizze lauteten: Wie allgemein bereits bekannt ist, werde ich mit 1. Juli 1980 in den dauernden Ruhestand gehen. Aus diesem Anlass erlaube ich mir, Euch allen eine kleine Biografie von mir zu widmen.
Der Vater hatte seine Aufzeichnung in mehrere kleine Unterkapitel unterteilt, von denen das erste mit Die Kinderzeit! überschrieben war. Manche Details seines Lebens waren auch mir neu, oder ich hatte sie vergessen oder nicht beachtet, weil sie mir unbedeutend erschienen waren.
Mein Vater war als neuntes Kind einer armen Kleinhäuslerfamilie, so wörtlich, am 5. Jänner 1920 geboren worden. Augenblicklich begann ich mich meiner Onkel und Tanten väterlicherseits zu erinnern, ich kam einschließlich meines Vaters auf sieben Kinder, die ich gekannt hatte und von denen heute niemand mehr am Leben war. Zwei Geschwister meines Vaters mussten also als Kleinkinder oder als Kinder sehr früh gestorben sein, der Vater erwähnte sie in seiner Skizze nicht einmal. Auf nicht mehr als einer halben Textseite beschrieb er seine ersten Lebensjahre, deutete die politische Situation der Nachkriegsjahre an – die Monarchie war aufgelöst, 1920 trat eine totale Geldentwertung ein, die Gemeinden zwang, Notgeld zu drucken. Der Vater summierte: In dieser schweren und harten Zeit wuchs ich auf und kannte nichts als ein hartes, karges Leben.
Ein einziges seiner Geschwister erwähnte der Vater in diesem ersten Kapitel nach einem Hinweis, dass es damals noch keine gesunde Kinderernährung gab und viele Kinder früh an Krankheiten starben. Es war der Satz, an dem ich hängen blieb: Es ergab sich, dass ich und mein älterer Bruder diese Zeit überdauerten.
Und dann, ein paar Zeilen später die Anmerkung: Uns beiden Brüdern wurde das Los zuteil, dass wir schon vor der Schulpflicht zu Bauern in der Nachbarschaft Viehhüten und Ochsenweisen gehen mussten.
Formulierungen waren das, die völlig aus der Zeit gefallen anmuteten. Der Historiker in mir versuchte, den Text analytisch zu verstehen. In einer Zeit, in der die Autonomie des Subjekts und die Wahlfreiheit des Individuums betont wurde, in der wir selbstverständlich von der freien Wahl von Partnern, Beruf, Wohnort ausgingen, in der einem jungen Menschen von heute mindestens der ganze Schengenraum offen stand, in einer Zeit, in der viel von Ich-AGs die Rede und eine ständige Selbstoptimierung in den Medien angesagt war, hörten sich die Sätze des Vaters, vor gut fünfunddreißig Jahren geschrieben, seltsam an. Da resümierte ein Mensch, der vor beinahe hundert Jahren geboren worden war, die Tatsache seiner Geburt und Existenz mit einer lapidaren Wortwahl, die mich an die biblische Weihnachtsgeschichte denken ließ: Es ergab sich, dass ich und mein älterer Bruder diese Zeit überdauerten. Nicht erlebten. Nicht überlebten. Überdauerten. Wie bewusst hatte der Vater damals diese Formulierung gewählt und was verbarg sich für ihn dahinter? (Zeitlebens hatte der Vater Texte verfasst, berufsbedingt, Amtsschreiben, Protokolle, Niederschriften, aber auch aus Neigung, Gedichte, literarische Gebrauchstexte, Sketche, und über Jahrzehnte auch Berichte über das lokale Geschehen für mehrere regionale Zeitungen.) Wie überdauerte man eine Zeit, die die Kindheit war?
Wie viel Unfreiheit steckte in dieser Formulierung, wie viel Gefühl von in die Welt geworfen sein aus Zufall? Glück? Schicksal? Fügung?
Wenige Zeilen später dann der Hinweis, dass ihm das Los zuteil wurde.
Zum Leben wurde man eingeteilt, schon als Kind. Als noch nicht schulpflichtiges Kind zur Arbeit verpflichtet. Keine behütete Kindheit. Keine Wahlfreiheit. Nichts anderes gekannt. Das Leben, ein Los. Dieses Los wurde einem zugeteilt.
Ich mochte nicht an eine zufällige Formulierung glauben. In Sätzen steckt Obrigkeit, heißt es in einem Buch von Handke. Die Obrigkeiten dieses Lebens in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren eine autoritäre Gesellschaft, ein strenger Vater, die Enge einer dörflichen Gemeinschaft und die rigiden Vorschriften der Kirche.
Beim Lesen seiner Zeilen hatte ich das Gefühl, diesem Kind nahe zu kommen, das mein Vater vor fast hundert Jahren gewesen war. Hanna fiel mir ein, die, vielleicht war sie fünf Jahre alt gewesen, einmal um mich herumgestrichen war und mich dann aus ihren blauen Augen groß angeschaut hatte: Papa, es ist eigentlich komisch, dass es uns gibt. Ich war Zeuge eines ersten philosophischen Anfalls geworden, bei dem Hanna, die unter ganz anderen Bedingungen als ihr Großvater aufgewachsen war, über ihr Leben, über die Realität ihrer puren Existenz nachgedacht hatte.
Ihr, die ihren Opa nur vom Hörensagen kannte, hatte ich damals die Geschichte seiner Errettung durch einen Kameraden im Krieg erzählt, die für mich und meine Geschwister immer eine Ursprungsgeschichte unserer Familie gewesen war. Am 22. Juni 1941, gleich am ersten Tag des Russlandfeldzuges, war unser Vater schwer verwundet worden. Ein Unterarzt, der ihn notdürftig erstversorgt hatte, starb wenig später neben ihm im Schützengraben. Nach einer kurzen Bewusstlosigkeit, war der Vater wieder aufgewacht. Er hatte bereits russische Infanteristen über einen Wiesenhang laufen gesehen, sich aber wegen seiner schweren Verwundung nicht bewegen können. Auch der Satz stand in seinem Lebensbericht: Wie durch ein Wunder wurde ich gerettet. Ein Kompaniesanitäter aus Freistadt, den mein Vater von der Sanitätsausbildung her kannte, entdeckte den Verwundeten und organisierte den Abtransport. Der Vater wurde in eine Zeltplane eingepackt, an ein Geschützrohr gehängt und aus dem Gefahrengebiet herausgebracht. Die Episode gehörte für uns Kinder zu den wenigen Kriegserinnerungen, die er uns öfter erzählt hatte. Der Freistädter Gendarm war dabei vom Vater immer als sein Lebensretter tituliert worden. Ich glaube, dass der Vater nach dem Krieg viele Jahre Kontakt zu dem Mann pflegte, der in Freistadt bis zu seiner Pensionierung bei der Gendarmerie beschäftigt gewesen war.
Auch für Hanna erzählte ich die Geschichte mit einer Frage am Ende: Was wäre geschehen, wenn dein Großvater, also mein Vater, damals nicht gerettet worden wäre?
Mein Vater hatte die harten Jahre seiner Kindheit überdauert und den Krieg überlebt. Nur deshalb konnte ich Jahre später vor seiner Skizze sitzen, um sie zu lesen.