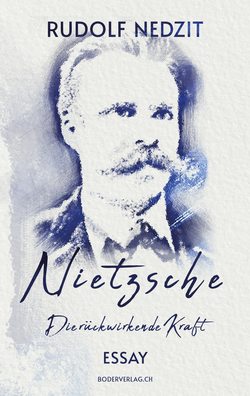Читать книгу Nietzsche - Die rückwirkende Kraft - Rudolf Nedzit - Страница 5
Wer Philosophie und somit A sagt ...
Оглавлениеder muss auch Nietzsche und somit B sagen. Philosoph, Dichter, Philologe, Psychologe und (um es nicht zu vergessen) Musiker. Eine einzigartige Kombination, gepaart mit einem einzigartigen Genius. Diesem Menschen konnte also gar nichts anderes übrig bleiben, als die alte, herkömmliche Philosophie in Grund und Boden zu stampfen, den bisherigen so genannten Philosophen gründlich den Kopf zu waschen, eine neue Sprache und ein neues Denken in dieses von Jahrtausende altem Staub bedeckte Metier einzubringen, eine Feuerwalze über das gesamte Brachland des noch Notwendigen zu jagen. Mit seinem Erscheinen auf der Bildfläche der menschlichen Projektionen wurde eine neue Fackel angezündet, an der sich immer noch und auf unabsehbare Zeit viele die Finger verbrennen: ein Brand, der nicht zu löschen ist.
Der Mensch Friedrich Nietzsche, dieser große Befreier, hat, so müssen wir einerseits vermuten, andererseits ist es gewiss, die Rezeption seines urgewaltigen Werkes nicht erlebt. Aus zwei Gründen. Der erste: in seinen letzten elf Jahren war er zwar Träger seines Geistes, nicht mehr aber dessen Herr. So entwickelte sich, angeregt und entfacht durch das öffentliche, schön-grausige Spiel mit dem Wahnsinnsgedanken, schon kurze Zeit nach seinem Zusammenbruch beginnend, ein umgekehrter Populismus in der Beschäftigung mit seinen Werken, erreichen konnte ihn dieser gleichwohl nicht mehr, abgeschnitten von der einen Welt, verwoben in eine, seine andere, wie er war, für seine Umwelt nur noch körperlich präsent. Der zweite: ein solches Gedankenuniversum, wie von ihm geschaffen, benötigt für seine vollständige Verarbeitung viele Jahre, mehr Jahre als gewöhnlich der ersten Empfängergeneration zur Verfügung stehen, die ihrerseits wiederum, zumal in solch extrem seltenen Fällen geistiger Höchstleistungen, auf Nacharbeit und Weiterentwicklung durch ihr nachfolgende Generationen angewiesen ist. So betrachtet und allgemein gesagt ist ein Rezeptionserlebnis für den Autor selbst unmöglich, bei grandiosen Schriften speziell und auf den Punkt gebracht sogar nicht wünschenswert, nicht erlaubt, weil im strengen Sinne Werk verkürzend.
Spielt ein nicht gegebenes Rezeptionserlebnis aber überhaupt eine Rolle, und wenn ja, welche? Doch schon in der Fragestellung an sich, liegt bereits deren Antwort. Natürlich spielt es eine Rolle. Es liegt in der Natur der Sache. Nämlich: dass man keinen Rücksichtnahmen unterliegt, keinen Zwängen ausgesetzt ist, wie die auch immer geartet sein mögen, dass man sich nur auf eines zu konzentrieren hat, auf eines, was einem ohnehin am meisten am Herzen liegt, mögen andere davon halten, was auch immer: die Manifestation seiner Gedanken, Gefühle, Ideen, Feststellungen, Vermutungen – und Empfehlungen, Ratschläge, Aufforderungen, Anordnungen! Gut ist es dann, keine Resonanz zu erfahren, keine Verunsicherung erleiden zu müssen, weder Spott noch Lob ausgesetzt zu sein, denn was sollte mit diesen auch anzufangen sein, diesen unnützen, zu nichts Produktivem verwendbaren Ablenkversuchen. Besser ist es, bei sich zu bleiben, seinen Weg zu kennen und auszuleuchten, unbeirrt, in sich ruhend. Am besten aber: von nichts wissen, was einen stören könnte. Es ist eine Aufgabe zu bewältigen, sie ist schwer genug, kein anderer soll sich in deren Ausführung einmischen. Man bleibt allein, man muss es sein. Nietzsche blieb es bis zum Schluss. Dem Schicksal, seinem, unserem ist dafür zu danken.
Und welches Schicksal wurde ihm auferlegt! Es ließ ihn in Eis und Hochgebirge leben, er war stark genug, es freiwillig zu tun; es zeigte ihm Wahrheiten, die zuvor kaum ein anderer zu Gesicht bekommen hatte, er ertrug sie, wagte sich an sie heran; es machte ihn unverwechselbar, er wusste, dass er der und der war. Sein Schicksal sprach zu ihm: Ecce homo. Und zu uns Heutigen sagt es: Ihr seid sein Übermorgen. Es sagt es zu allen, doch nicht alle können oder wollen es hören. Wie sollte das auch möglich sein? An nichts scheiden sich die Geister mehr als an einem Freigeist. Wer mit sechs Jahren seine ersten Kompositionsversuche macht, wer mit zwölf seine erste philosophische Abhandlung schreibt, mit vierzehn seine erste Autobiographie, mit vierundzwanzig Professor wird – der ist etwas ganz Besonderes. Vorneweg schon mal. Doch selbst damit ist es noch nicht getan, noch nichts endgültig bewirkt. Man hat es auszubauen, will man tatsächlich eine spätere Wirkung erzielen, innen wie außen, und man muss es den Rest seines Lebens tun, wenn man es denn durchhält, als Einsamer, denn sonst ist es nicht zu bewältigen. Und mit Gewalt hat es auch wirklich zu tun, innerer und äußerer. Es ist nicht weniger als die Gewalt des Lebens, der man sich auszusetzen hat, sie erleiden, ertragen, zeitweilig überwinden muss, sie vielleicht sogar dauerhaft zu mindern hofft. Wem oder was aber könnte man eine solche Riesenarbeit mit irgendeiner Aussicht auf Erfolg aufbürden, wenn nicht einem freien Geist?
Greifen wir vor und halten bereits an dieser Stelle fest, dass Nietzsche sich nicht damit begnügte, ein Einsamer zu sein, sondern sich zu einem Einzelnen weiterentwickelte, hinaufstieg, mit derartiger Wucht in den Tempel des Denkens stürmte, dass die abendländische Philosophie eine weitere moderne Zäsur erfuhr: nicht mehr ausschließlich die in vor- und nachkantisch, sondern darüber hinaus auch die in abnietzscheanisch.
Ein Vorgriff in zweierlei Hinsicht: Nietzsche betreffend, die Philosophie betreffend.
Was Nietzsche angeht: Er wusste, dass eine weite Zukunft vor ihm liegt. Er wusste es mit solcher Intensität, wie diese einem Menschen möglich ist, der von der Zukunft nichts wissen kann. Also doch nur eine Ahnung? Aber was heißt hier schon nur? Sie genügt allemal, wenn man sich seines Selbstwertes bewusst ist – und es bleibt. Denn Durchhaltevermögen gehört schon dazu, will man eine Tür aufstoßen, an der bisher lediglich gekratzt, an die in der Vergangenheit nur zaghaft und ängstlich geklopft wurde. Und der Wille, ein über die ganze, bewusste Lebensspanne währender Wille, diese imaginäre Tür einzutreten, sollte einem nicht geöffnet werden, gehört auch dazu. Ein schweres Los, dem falsche Rücksichtnahme auf Zeitgeist, Gott und die Welt als Ratgeber nicht zur Seite stehen darf, soll es sich erfüllen. Da gilt es anzuschreiben gegen alles und jeden, da müssen Schlussstriche gezogen werden, wo sie hingehören, da ist zu sagen, was nicht verschwiegen werden darf, da muss mit dem Hammer zertrümmert werden, was mit guten Worten und halbherzigen Taten nicht zu beseitigen ist. Und was tut es zur Sache, dass man nicht gehört, nicht gesehen wird? Dass die eigenen Schriften und Notizen ins Unermessliche wachsen und immer tiefer ins Ungeheure hinein und kein anderer sich darum zu scheren scheint, nicht in den Abgrund zu blicken wagt, der sich doch förmlich der Erkenntnis aufdrängt? Noch ist die Menschheit nicht soweit, seinen Gedanken zu folgen, sie auch nur ansatzweise sich einzuverleiben; doch wie gesagt: noch nicht. Diese Zeit aber wird kommen, seine Zeit wird kommen. Er weiß es, er braucht es nicht zu beschwören, er weiß es einfach, und darum schreibt er um sein Leben, er lebt sein Schreiben, er denkt seine Existenz über den Punkt hinaus, bis zu welchem er ihm selbst folgen können wird. Er macht sich so breit, dass neben ihm nichts anderes mehr Platz finden kann. Er investiert nicht mehr und nicht weniger als – sich. Mag er seiner Zeit voraus sein; die darauf folgende wird ihn schon einholen, überholen, wiederholen.
Was die Philosophie angeht: Gäbe es für diese eine allgemeinverbindliche Definition, bräuchten wir sie nicht, die Philosophie. Denn sie wäre dann einem Korsett vergleichbar, in welches sich alle Denker zu zwängen hätten und manchem von diesen würde dabei die Luft ausgehen, gerade die Höhenluft, der er bedürfte, um von höheren Sphären herab, seine Analyse des umtriebigen, letztendlich doch immer bodenständig bleibend müssenden Lebens und Denkens des Menschen betreiben zu können, bei aller Metaphysik, der man sich zu verschreiben genötigt fühlen mag. Denn da man selber Mensch ist, kann man nur wie ein Mensch denken, und da man darüber hinaus noch ein einzigartiger ist, nämlich man selbst, was kein anderer sein kann, so ergibt es sich aus sich heraus, dass man keinem theoretischen Endpunkt verpflichtet sein darf, will man über das Ende hinaus denken. Würde das Ende erreichbar sein, so muss es irgendwann erreicht werden. Dann aber käme die Philosophie an ihr eigenes Ende – und gerade das ist es, was sie nicht will. So will sie also auch keinen Namen, der ihr Herkunft, Bestimmung und Vollendung anhaften würde. Sie will namenlos bleiben, im Interesse ihrer selbst. Der Begriff Philosophie ist also lediglich ein Etikett, welches auf etwas Unbestimmtes aufgeklebt wird, um sich dieses Unbestimmte gedanklich überhaupt erschließbar machen zu können. – Mit der aus diesem eigenwilligen Selbstverständnis der Philosophie heraus resultierenden Selbstbeurteilung haben dann auch alle so genannten Philosophen zu kämpfen, die, wenn sie denn Wert darauf legen sollten, dass ihre Gedanken die Zeit überdauern, sich eben auf die Zeit einlassen müssen, und zwar im großen, strengen Maßstab, nämlich gerechnet in Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Früher dürfen sie kein Urteil erwarten und wurde es dann irgendwann gefällt, ist damit noch nicht garantiert, dass keine Revision mehr erfolgen wird. So geht es auch Nietzsche, so wird es auch ihm gehen müssen. Und doch nimmt er eine Sonderstellung ein: er führte in die altehrwürdige Wissenschaft des Denkens ein Konglomerat bisher unbekannten Ausmaßes ein: tiefsten Geist, rücksichtslose Frivolität, vollendeten Sprachgebrauch. Unsere Erkenntnis ist noch auf dem Wege. Die Sprache kennt noch nicht alle Wörter. Man könnte, nach Nietzsches Leben, Tod und Wirkung, sich der Meinung hingeben, dass sie auch keine neuen mehr finden kann.
Die von Nietzsche betriebene Expansion der Sprache war kein Selbstzweck, wenn sie auch das perfekte Instrument für die Vermittlung seiner Ideen und Gedanken war. Sie war kein Selbstzweck, da sie nicht um ihretwillen betrieben wurde, sondern im Interesse einer weitestreichenden Erschließung des Gedankenraumes. Wo nichts mehr formuliert werden kann, hört das Denken auf. Das Denken soll aber nicht dort aufhören, wo es bereits gewesen ist, sondern es muss weiteren Boden gutmachen. Wie aber soll das noch gelingen können, wenn der Vorrat an verwendbaren Beschreibungen bereits verbraucht ist? – Indem man davon ausgeht, davon überzeugt ist, dass der Vorrat noch nicht erschöpft ist, noch nicht! Denn Nietzsche hat so vieles zu sagen, dass es ihm, dem Meister der Sprache, unerträglich wäre, wenn es gerade an der Sprache läge, dass nichts mehr gesagt werden könnte. Es gilt also ein neues Spiel zu eröffnen: das unerschöpfliche, leichte und befreiende Spiel mit der Sprache. Viel zu lange schon wurde das Gewicht der Philosophie ermittelt aufgrund der Schwerfälligkeit ihres Ausdrucks. Je unverständlicher für den Laien, den Nicht-Weisen, desto schwerer, folglich gewichtiger. Damit muss Schluss sein. Es ist an der Zeit, dass das Medium der Sprache in seiner höchsten Potenz angewandt wird. Keine Abstriche mehr, keine Abwägungen egal welcher Art, kein Hinschauen auf was auch immer – sondern pures Hinhören. Gedanken müssen Botschaften sein, sie müssen gehört werden. Wer verlangt, dass sie von Anfang an verstanden werden müssten? Aber sie müssen doch von Anfang an gehört werden! Der Vorrat der Sprache besteht nicht aus der ihr verfügbaren Anzahl von Wörtern, sondern liegt in ihren Variationsmöglichkeiten, die, hat man das Zeug zu einem Dichter, mehr, ist man ein Dichter, so überwältigend sind, dass man diese erst unter seine Gewalt bringen muss, um sich ihrer vollsten Wirkmächtigkeit bedienen zu können. Dies wiederum aber, sogar unter Dichtern, ist nur den wenigsten gegeben, muss auch gegeben sein, denn zu beeinflussen, geschweige denn zu erzwingen, ist es nicht. Es ist eine Gabe. Eine, der man sich bewusst sein muss und sie dann entsprechend einzusetzen hat: im Falle Nietzsches als Zündschnur zu dem Dynamit seines Denkens. Mit Hilfe seiner Sprache, die nominell zwar auch diejenige seiner Mitmenschen ist, aber wie aus einer anderen Sphäre zu kommen scheint, führt er seine Gedankenexplosionen herbei, welche die Fundamente der alten Philosophie zutiefst erschüttern werden. Es ist zunächst einmal das Faszinosum seiner perfekten Sprachbeherrschung und des unglaublichen Formulierreichtums, was jeden Leser anrührt, und durch welches sich diesem quasi schlagartig das Hirn des Schreibenden offenbart und ihn in dessen Welt hineinzieht. Was hinzukommt, hinzukommen muss, gerade und unverzichtbar für Nietzsche selbst, ist die Heiligsprechung des artistischen Sprachgebrauchs durch die große Tiefe des darin zum Ausdruck gebrachten Gedankens.
So wie die Sprache, die Sprachhandhabung kein Selbstzweck sein darf, so darf auch das Denken sich nicht in sich selbst verlieren, sich im Kreise von Selbstbezügen drehen und winden. Es muss vielmehr diesen Kreis sprengen, aus sich heraustreten und den beflügelnden Duft einer Transzendenz schnuppern; nicht im Sinne eines Jenseits, sondern eines reflektierten Diesseits, welches ungeahnte Höhenflüge erlaubt, wenn man keine Angst vorm Fliegen hat. Da Gott tot ist, bereits seit geraumer Zeit sogar, sollte man die eigene Lebens- und Denkkraft nicht mehr weiterhin damit verschwenden, einem Leichnam zu huldigen, sondern alles daran setzen, das Zepter der Lebensführung, -gestaltung und -steigerung fest in die Hand zu nehmen. Um das erreichen zu können, muss man kein Übermensch sein, es genügt vollkommen, einer werden zu wollen. Dieses Wollen aber muss mit Macht geschehen. Sollte die eigene, die erste Natur davor zurückscheuen, so muss an einer zweiten gearbeitet werden, beständig, kompromisslos, Ziel führend. Das Ziel liegt in der Spitze, nicht in der Breite. Der beschwerliche Aufstieg dorthin muss uns nicht vorneweg entmutigen; alles Gleiche kehrt ewig wieder, immer wieder werden sich neue Chancen auftun – dieser Augenblick aber gehört uns: so nutzen wir ihn denn!
Mit der Sprache wird also über das Denken gesprochen, erst mit dem Geist aber das Denken erhaben gemacht. Nietzsche, der sich seines Geistes frühzeitig dergestalt bewusst ist, dass er damit rechnet, einmal Centauren zu gebären, weiß nur zu gut, wo er anzusetzen hat, um etwas zu bewegen: bei sich, diesem Schwungrad seiner Existenz. Ununterbrochen drehend speichert es Energie und gleicht Antriebe aus, bis hin zu
Warum ich ein Schicksal bin
Ich kenne mein Los. Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen –
Wie leicht haben wir es doch heutzutage, dem allen beizupflichten, in mehr oder minder starker Ausprägung, je nach persönlicher Präferenz, die eben darum zwar bei dem einen oder anderen bis hin zur Abneigung gehen mag, was aber wiederum ein Zeichen der Ausprägung ist, im Hinblick auf den Umgang mit diesem großen Philosophen, der er nun mal ganz einfach ist; wir brauchen ja nur Nietzsches Nachwirkungen, eben bis auf den heutigen Tag, zur Kenntnis zu nehmen. Doch wie mag es in Nietzsche ausgesehen haben zum Zeitpunkt der Niederschrift der Sätze? Er weitgehend unbekannt, seine Bücher kaum gelesen. Und wenn schon gelesen, auch verstanden? Kein leichtes Los. Und es gehört Größe, keine geschminkte, sondern wahre dazu, ein solches Los, zumal es das eigene ist, nicht nur zu kennen, sondern vor allem: kennen zu wollen – und nicht selbst davor zu erschrecken, im Gegenteil: es über den Tod hinaus zu ersehnen.
... an eine Krisis, wie es keine auf Erden gab, an die tiefste Gewissens-Kollision, an eine Entscheidung, heraufbeschworen gegen alles, was bis dahin geglaubt, gefordert, geheiligt worden war.
Wahrlich, ein Ausspruch, ein Anspruch höchsten Grades! Doch nicht höher, als es für Nietzsche selbst vertretbar war: denn alles darunter wäre Selbstbetrug gewesen, Feigheit, Angst vor dem Ungeheuren. Die Entscheidung, die er zu treffen hatte, und die er dann auch traf, lange zuvor schon getroffen hatte, war die, sein Menschsein als Einsatz im Spiel des Lebens zu investieren, nicht im Hinblick auf Rendite, sondern als Wette, als nichts oder alles, als Experiment, als Fragestellung, ob die Spielregeln, nach welchen bisher immer gespielt worden war, denn überhaupt die richtigen, zumindest die einzig denkbaren seien. Es gibt Heiligtümer, das wird nicht in Frage gestellt – nur, dass sie nichts taugen, darum geht es, das muss vor Augen geführt werden, das ist die Krisis, die Nietzsche erlebt, die ihn bedrängt, die ihn aufstehen lässt gegen alles. Seht her! Hier steht jemand, der zu euch spricht. Hört ihn! Versteht ihn! Nicht um seinetwillen – um der Sache willen, des Lebens willen!
Ich will keine »Gläubigen«, ich denke, ich bin zu boshaft dazu, um an mich selbst zu glauben, ich rede niemals zu Massen ...
Denn um den Glauben geht es nicht, im Gegenteil. Gerade den Glauben, dem so vieles geopfert wird, dem so viele zum Opfer fallen, will Nietzsche ja an den Pranger stellen. Er will, er darf deswegen auch keinem Selbstglauben verfallen, bei aller Gewissheit, bei aller Überzeugung sich keinem Blendwerk hingeben, sich keinen äußeren Belangen beugen, nicht nach Jüngern Ausschau halten. Alles, was ihn ablenken könnte, schadet seiner großen Sache. Den Weg, den er sich bereitet hat, muss er auch beschreiten, bis ans Ende, zur Not alleine, gerade alleine! Da gehört dann tatsächlich ein gutes Stück Boshaftigkeit dazu, sich folgerichtig zurückzunehmen, in den Hintergrund zu treten: aber nur keine falsche Güte gegen die eigene Person, keine Ablenkungen zulassen, kein Hinschielen auf Belangloses! Wo Stolz und Selbstwertgefühl sich melden, müssen sie in ihre Schranken verwiesen werden; man muss sich auch boshaft gegen sich selbst verhalten können, dort, wo es nötig ist. Weil Nietzsche weiß, was er will, weiß er, was er nicht will.