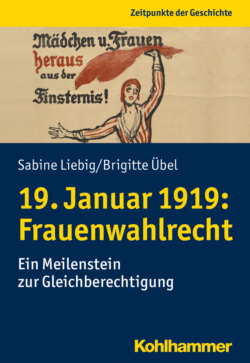Читать книгу 19. Januar 1919: Frauenwahlrecht - Sabine Liebig - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
Оглавление»Erhebt Euch und fordert das Stimmrecht«1
Mit diesen Worten regte die Feministin und Autorin Hedwig Dohm im Jahr 1876 die Frauen an, das Frauenstimmrecht zu fordern, denn sie hatte klar erkannt, dass Frauen ohne die politische Mitbestimmung keine Möglichkeit besaßen, ihre rechtliche, gesellschaftliche und politische Benachteiligung sowie ihre Ungleichbehandlung zu beenden.
Wie Hedwig Dohm nutzten andere Stimmrechtlerinnen ihre Handlungsspielräume. Sie schafften es, befördert durch den Druck der Massen während der revolutionären Umbrüche im November 1918 und den im Raum stehenden Demokratisierungswillen, dass die deutschen Frauen in den ersten demokratischen Wahlen am 19. Januar 1919 endlich das lang geforderte aktive und passive Wahlrecht ausüben durften. Sie erschienen trotz Minustemperaturen und Schneeregen in großer Zahl und reihten sich in die langen Schlangen vor den Wahllokalen ein, um ihr neu erworbenes Recht in Anspruch zu nehmen und sofort an allen anstehenden Entscheidungen in den neu gewählten politischen Gremien mitzuwirken – manchmal erfolgreich, manchmal ausgebremst durch die Übermacht der Männer. Gerade das Frauenwahlrecht markierte eine wichtige Zäsur auf dem Weg aus der gesellschaftlichen und rechtlichen Ungleichheit hin zu mehr Gleichberechtigung.
Im ersten Teil des Buches steht die Einführung des Frauenwahlrechts und dessen unmittelbare Vorgeschichte im Vordergrund. Die Einbettung des Ereignisses in einen breiten Kontext belegt, dass die Einführung der Erfolg einer jahrzehntelangen Agitation verschiedener bürgerlicher und proletarischer Frauenverbände, sowie einzelner Frauen war, die national wie international vernetzt, sich unterstützten und gegenseitig beeinflussten. Aber nicht alle Frauen wollten das Wahlrecht und so fanden die männlichen Gegner – vor allem Mitglieder der konservativen Parteien, Verbände und Kirchen – in vielen bürgerlichen Frauen Mitstreiterinnen, um den Stimmrechtsforderungen vehement entgegenzutreten. Von den politischen Parteien hatte einzig die SPD schon 1891 das Frauenstimmrecht gefordert, doch blieben die Parteigenossen in der Umsetzung höchst zögerlich, obwohl gerade sie im November 1918 durch ihre Regierungsbeteiligung die Chance zur Umsetzungen gehabt hätten. Die Revolution und die Entscheidung für eine demokratische Staatsform forcierten das Frauenwahlrecht, sodass die maßgeblichen Politiker es einführen mussten.
Im zweiten Teil werden die Auswirkungen des aktiven und passiven Wahlrechts diskutiert. Mit Stolz und Ehrfurcht vor dem Amt nahmen die neugewählten Parlamentarierinnen ihre Aufgaben in Angriff. Aktiv und teilweise fraktionsübergreifend arbeiteten sie an der Neugestaltung des Staatswesens mit, was besonders deutlich in ihrer Haltung zum Versailler Vertrag und in den sogenannten »Frauenparagraphen«2 der Weimarer Verfassung zum Ausdruck kam. Schnell mussten die Politikerinnen erfahren, dass ihre Arbeit auf vermeintlich weibliche Themen reduziert wurde, während die mit viel Gestaltungsmacht verbundenen Ressorts der Wirtschaft, Außenpolitik, Justiz und Finanzen in der Hand der Männer blieben.
Die weiblichen Abgeordneten waren voller Idealismus und mit der Meinung angetreten, dass Frauen die Arbeit in den Parlamenten friedfertiger und sozialer machen würden. So traf die Realität sie mit besonderer Wucht. Gerade die harten politischen Auseinandersetzungen untereinander und in den Parlamentsdebatten sowie der Rechtfertigungsdruck gegenüber Kollegen und Wählerinnen machten ihnen zu schaffen. Zudem kam Kritik an ihrer Arbeit von allen Parteien und gesellschaftlichen Richtungen.
Wie an den Statistiken zu sehen ist, sank im Laufe der 1920er-Jahre die Zahl der Wählerinnen und die der Parlamentarierinnen. Es waren vielschichtige Gründe, die dazu führten, dass die Frauen immer weniger Einfluss auf die politische Mitgestaltung ausüben konnten. Die zunehmende Parteienzersplitterung sowie der Rechtsruck in der Parteienlandschaft taten das Übrige. Gestartet mit der großen Hoffnung alle Frauen zu politisieren und viel zu verändern, mussten die engagierten Politikerinnen erleben, dass ihnen nur begrenzte Möglichkeiten blieben. Dennoch eröffneten sich für Frauen neue Handlungsspielräume, obwohl sich verkrustete Strukturen, bestehende Rollenmuster und weibliche Stereotype als recht langlebig erwiesen.
Dass die Errungenschaften der Frauen in der Weimarer Republik nicht von Dauer waren, verdeutlicht die Zeit des Nationalsozialismus, der in diesem Band nur eine knappe Erwähnung findet, da zu Frauen im Nationalsozialismus eine eigene Publikation geplant ist. Wichtig ist an dieser Stelle, dem Vorurteil zu begegnen, Frauen hätten Hitler an die Macht gebracht.3 Bis 1933 wählten die Frauen eher die gemäßigten oder konservativen Parteien. Als die Nationalsozialisten an der Macht waren, verdrängten sie die Frauen aus dem öffentlichen Leben. Doch selbst dieser frauenfeindliche Staat benötigte die Mitarbeit der Frauen in vielen Bereichen, nicht nur als Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg eingezogenen Männer.
Mit der Zeit nach 1945 beginnt der dritte Teil des Buches. In den Nachkriegsjahren knüpften die Frauen an die Erfolge der Weimarer Republik an bzw. hatten aus dieser Zeit gelernt. Sie kämpften vehement dafür, dass das Wort »grundsätzlich« nicht mehr in den Artikel 3 »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« des Grundgesetzes vom 23.05.1949 Eingang fand. Während der Weimarer Republik hatten sie nämlich erfahren müssen, wie leicht mit dem Wort »grundsätzlich« in Artikel 109 die Gleichberechtigung wieder ausgehebelt werden konnte. Die Parallelen in der Auseinandersetzung um Gleichberechtigung und Chancengleichheit machen deutlich, dass der so lange geführte Kampf für Gleichberechtigung nicht zu Ende ist, wie jedes Jahr beispielsweise am Equal Pay Day zu sehen ist. Zum Thema Frauen in Deutschland (BRD und DDR) nach 1945 wird es eine eigene Publikation in dieser Reihe geben.
Der Text basiert auf der Verwendung unterschiedlicher Quellen. Zeitgenössische Publikationen, Reichstags- und Landtagsprotokolle, Gesetze, Zeitschriften, Zeitungen und Lebenserinnerungen fließen in dieses Buch ebenso ein wie Grundlagenliteratur und aktuelle Forschungsliteratur. Einflussreiche bürgerliche Frauen haben ihre eigene Geschichte sehr subjektiv aufgeschrieben und beeinflussten so die Erinnerungskultur auf die bürgerliche Frauenbewegung. Dabei klammerten sie Themen und Personen aus, die nicht in ihr Konzept passten. Um dieser einseitigen Darstellung entgegenzuwirken, stehen immer wieder weniger bekannte Vertreterinnen von parteiübergreifenden und konfessionellen Frauenverbänden im Fokus. Um einigen der Frauen ein Gesicht zu geben, werden sie in Kurzbiographien vorgestellt. Darüber hinaus dienen weitere Kästen der Erläuterung bestimmter Begriffe und Institutionen. Außerdem werden bisher in der historischen Forschung vernachlässigte Themen wie z. B. das Lehrerinnenzölibat aufgearbeitet.
Mit dem Kampf um mehr Gleichberechtigung der Frauen rückte die Kategorie Geschlecht in den Fokus der Öffentlichkeit, womit u. a. die Grundlage gelegt wurde, dass weitere Geschlechter im Laufe der Zeit den Mut fanden, für ihre Rechte einzutreten. Den Anfang machten homosexuelle Männer und Frauen, Menschen mit diversen Geschlechtern folgten mit der Forderung nach Anerkennung und Gleichstellung sowie Gleichbehandlung.
Ein Hinweis zu den Anmerkungen: Sie sind zur besseren Lesbarkeit so übersichtlich wie möglich gestaltet, sodass AutorInnen, Jahr und Seitenzahlen oder die Bezeichnung der Protokolle in den Fußnoten aufgeführt sind. Unter den Namen bzw. Schlagworten finden sich die ausführlichen Literatur- und Quellenverweise in alphabethischer Reihenfolge im Literaturverzeichnis. Anmerkungen ohne Seitenzahlen beziehen sich auf online-Artikel.