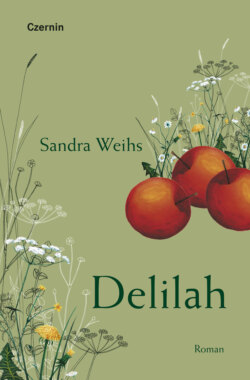Читать книгу Delilah - Sandra Weihs - Страница 8
… sei sie gegen eine glatte, kalte Oberfläche gestoßen …
ОглавлениеDer Tag, an dem Delilah mir die Geschichte ihres Namens schilderte, war einer der ersten, die ich mit ihr durch die Gegend stromerte. Es muss ein Tag gewesen sein, kurz nachdem sie an unsere Schule gewechselt war, dem Stiftsgymnasium in einem Vorort einer kleinen Stadt im Süden des Landes. Der lange Herbst zog sich warm bis in den November, das Laub raschelte trocken unter unseren Füßen, als trotze es dem Verrotten.
Damals. Als die Tage lang waren und wir sie noch auszunutzen vermochten durch unsere Jugend und die Gier nach Neuem, Schönem, Unbekanntem. Alles war damals lang, die Tage, an denen wir den Fluss entlang streiften, die Nächte, in denen wir die Stadt entdeckten, die Schulwochen, in denen wir auf die Matura vorbereitet wurden. Die Stromleitungen, denen wir über die Felder folgten, die Gräser, die wir mit den Handflächen streiften, die violetten Kondensstreifen der verzögert nachhallenden Flieger über der untergehenden Sonne. Unser Atem! – Alles war lang.
Der Tag, an dem Delilah mir die Geschichte ihres Namens erzählte, begann mit einer Wanderung durch die Nachbarschaft, vorbei an Einfamilienhäusern mit kleinen und großen, gepflegten und verwahrlosten Gärten. Im Kern des Vorortes ein Supermarkt, die Post, die Bank und ein Café, in dem sich die Arbeitslosen schon vormittags auf ein Bier trafen und nachmittags die Schüler gemeinsam lernten oder einfach den Tag totschlugen. Delilah zeigte sich unbeeindruckt, hatte sie doch schon in vielen Ecken der Welt gewohnt und überall sähe es gleich aus, meinte sie, nur die Felder, Wälder und Auen gefielen ihr und wir wanderten lange ohne Ziel in der Natur. Zur Rast saßen wir auf dem Findling neben dem Fluss, an dem die Kelten vor Jahrhunderten über Recht verhandelt hatten und dem Delilah magische Kräfte zuschrieb. Delilah saß oben, neben der natürlichen Schale, in der sich das Regenwasser am Fels sammelte, und ich am schmalen Vorsprung darunter. Während ich, die Ellbogen auf die Knie gestützt, die trockenen propellerförmigen Samen des Ahorn vom vergangenen Herbst wirbelnd zu Boden fliegen ließ, reckte sie ihr vorspringendes Schlüsselbein und Kinn in die frische Sonne. Ihre Schultern erstreckten sich in einer Kühnheit und Kampfeslust, als hätte sie schon mehrere Kriege gewonnen und könne es mit jedem neuen Gegner aufnehmen, während sie sich am Fels anlehnte, um ihrem unvermeidlichen Sieg mit Gelassenheit zu begegnen. Dabei war sie so dünn und zart wie Seidenpapier. Die schmale Hand mit ihren zarten Fingern bewegte sie in einer anmutigen, ausholenden Langsamkeit, um sich das kupferne Haar aus der Stirn zu streichen. Ich musste Delilah anschauen, immerzu, Delilah war der schönste Mensch, den ich kannte.
Sie war vorausgegangen zum Findling, unserer Naturfestung, dem Ort, an dem sie ihre wahrsten Geschichten erzählte. Immer ging sie, egal wohin, voraus. Delilah machte den Weg frei für mich, sie war die Kräftigere, die Sichere, die, an die ich mich halten konnte, ohne fürchten zu müssen, verloren zu gehen. Ich folgte ihr in die Natur, in Kneipen, in Menschenmengen. Hauptsache, sie war in Reichweite, Hauptsache, ich konnte den Raum fühlen, den sie um uns erschuf, der Bedrängung und Bedrohung wie eine unsichtbare Glocke fernhielt, egal von wo sie kommen mochte, von einem Wind, von einem Insekt, von einem Jungen.
Unsere Mütter waren verschieden wie Stand- und Zugvogel, wie Nest und Bleibe, wie Käfig und Schlüssel. Während meine Mutter meinen Käfig säuberte und pflegte und ausbaute, wedelte ihre Mutter mit einem Schlüssel vor Delilahs Nase und trällerte das Lied der Freiheit. Während ich meine gesamte Kindheit in meinem Heimatnest verbracht hatte, war Delilah nur Monate, vielleicht Jahre an einem Ort geblieben, war vom Osten in den Westen in den Norden gezogen, bis sie zu uns herüber flatterte, vielleicht nur, weil das der Süden war und sie ihn noch nicht kannte. Sie folgte aber keiner inneren Uhr, keinem inneren Kompass, wie die Natur es von den Vögeln verlangte. Zu allem, was sie tat, entschied sie sich bewusst. Wenn ich ein Vogel war, dann war ich einer, der nicht fliegen konnte. Ich fühlte mich wohl in meinem Nest und hatte kein Bedürfnis es zu verlassen, hatte meine Mutter es mir doch wohlig eingerichtet.
Mein Name ist Penelope, kleines Entlein nannte Delilah mich manchmal und ich schimpfte sie dafür. Sie stupste mich an, wollte mich immer wieder aus dem Nest werfen, mich anfeuern, damit ich fliegen lernte, doch ich hatte Angst, ich hätte keine Kraft in den Flügeln oder die Luft sei zu dünn und könnte mich nicht tragen. Ich krallte mich fest im Nest und Delilah lachte ihr Was-soll-schon-passieren-Lachen, jeder Ton fern der Angst.
Delilah lachte in dreierlei Art und Weise. Die erste Variante war das Was-soll-schon-passieren-Lachen, es war das Lachen, das jeden mit ihrer Unbekümmertheit ansteckte und Sorgen und Ängste vergessen ließ und wenn ich mich recht entsinne, verflog mit ihrem Lachen auch meine Sorge, keine Kraft in den Flügeln zu haben, wenn auch nur kurz.
Wir saßen am Findling neben dem Fluss. Delilah zeichnete Wellen in das Regenwasser der Felsschale und beobachtete ihr Spiegelbild, während sie mir die Geschichte ihres Namens schilderte, entrückt und klar, wie nur Delilah sich auszudrücken vermochte. Delilah schickte voraus, die Geschichte wäre eine ihrer ersten Erinnerungen, sie musste vier oder fünf Jahre alt gewesen sein. (Und ich schicke voraus, dass diese Geschichte ein Märchen gewesen sein muss.) Das Mädchen, das Delilah heißen würde, habe auf ihrem Bett gesessen, mit den Zehenspitzen habe sie den grauen Teppich gestreift, dabei sei ein Geräusch entstanden, das flauschig in den Ohren gekitzelt habe. Sie habe die Mutter beobachtet, wie sie ein helles, silbern schimmerndes Bild in ihr Zimmer gehievt und es danach vorsichtig an die Wand gelehnt habe. Die Mutter habe sich gebückt, um Hammer und Nagel aus der Werkzeugkiste zu nehmen. Dabei habe ihre Mutter sich lächelnd nach ihr umgeschaut und gefragt, ob ihr der Spiegel gefalle, aber sie habe es noch nicht gewusst. Still habe sie weiterhin auf ihren Händen gesessen und fasziniert das Schimmern in allen Farben beobachtet, während die Mutter das Bild an der Wand befestigt und vorausgesagt habe, dass sie den Spiegel lieben würde. Delilah erzählte die Geschichte so, als sei ihr bis zu diesem Erlebnis kein Spiegel auf der Welt untergekommen, als habe sie nichts von diesem Wunderding gewusst.
Das Bild habe alle Farben der Umgebung aufgesaugt, um sie mit dem Silber zu vermischen und in neuem Glanz wiederzugeben, brillanter und strahlender, als alles was sie bisher gesehen habe. Im Spiegel in ihrem Zimmer habe sie einen Raum erkannt, der wie ein Zuhause ausgesehen habe und einen Teddy, der ihrem Balu wie aus dem Gesicht geschnitten gewesen war. Sonnenflecken auf dem Teppichboden, einen Puppenwagen in getupftem Rosa wie der ihre und ein Kind mit kupfernem, welligem Haar und gelbem Kleid auf dem Bett, das sie staunend angesehen habe.
»Wie verwirrt ich war, als ich das Abbild meiner Kinderzimmerwelt im Spiegel gesehen habe!«, und sie lachte über sich selbst, über ihr Unwissen, als sie vier Jahre alt gewesen war und ich stimmte in ihr Lachen ein. Es war ihre zweite Art zu lachen, selbstironisch, entschuldigend, aber liebevoll und mitfühlend ihrem eigenen Selbst gegenüber, ihrem Unwissen, ihrer Unreife, ihrer Unzufriedenheit, allen Unzulänglichkeiten, die sie an sich selbst bemerkte, und sie lachte trotzdem glockenhell und ohne jeden ängstlichen Ton darin und ich musste mitlachen, unweigerlich, ich konnte nicht daran vorbei und musste sie mit ihr auslachen und im Lachen lag bereits die Entschuldigung dafür.
Delilah erzählte mit zierlichen Gesten deutend weiter, sie habe Mut gefasst. Sie sei vom Bett gehüpft und das Mädchen im Spiegel habe es ihr gleich getan. Sie seien aufeinander zu gekommen, sie hätten sich in die Augen gesehen und die Hände ausgestreckt. Aber als sie die Hand des Mädchens habe ergreifen wollen, sei sie gegen eine glatte, kalte Oberfläche gestoßen. Sie habe das Mädchen so sehr berühren wollen, habe immer wieder an anderer Stelle auf das Bild getippt und das Mädchen habe es ihr gleichgetan. Delilah erzählte und ich glaubte ihr jedes Wort dieser erfundenen Begebenheit, so gerne hätte sie den Raum betreten, mit dem Mädchen spielen wollen, das ihr so gefallen habe, doch nirgends sei ein Eingang, nirgends ein Durchschlupf gewesen, der Raum habe hinter einer unsichtbaren Scheibe gelegen, die nicht zu durchdringen gewesen sei. Sie habe die Stirn an die glatte, kalte Stirn des Mädchens gelegt und ihr in die Augen gesehen. Und sie habe zum ersten Mal in ihrem noch kurzen Leben gedacht: Das bin ich.
Delilah beobachtete sich im Regenwasser der Steinschale. Noch immer lag etwas in ihrem Blick.
Sie habe sich selbst erkannt in ihren eigenen Augen, sagte sie, durch Mutters Geschenk des Spiegels. »Ich drängte meinen Körper an die Oberfläche der Scheibe, deren Kühle sich in der stickigen, feuchten Sommerhitze angenehm anfühlte, ich fuhr lange über die Oberfläche und meine Hand im Spiegel tat es mir nach. Ich drückte Bauch an kalten Bauch und entfernte meinen Kopf, um Überblick zu haben, stand da mit vorgewölbter Rundung, sah auf den Bauch im Spiegel und griff nach meinem körpereigenen. Ich kitzelte den Nabel und drückte ihn sodann wieder an die Scheibe, streckte mich, legte meine Handflächen auf die Augen und spreizte die Finger, lugte verzwickt dahinter hervor und sah mich verstecken. Es sah lustig aus, sodass ich das Lächeln sehen konnte, das ich fühlte. Und plötzlich wusste ich, das, was ich sah, das war nicht das, was meine Mutter in mir sah. Was ich sah, trug nicht den Namen, den Mutter mir gegeben hatte. Ich sah Delilah.«
Sie wiederholte Delilah, und noch einmal flüsterte sie Delilah und sah in das Wasser, fuhr mit den Fingerkuppen über die Oberfläche, sah das Zittern ihres Abbilds, sah mich an und lachte ihre dritte Art des Lachens, ein zartes Lachen, ein sehnsüchtiges, ein Lachen, in dem ein Wunsch lag und Trauer, weil er nicht erfüllt werden konnte.