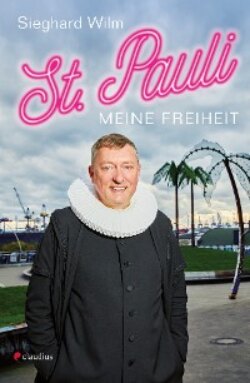Читать книгу St. Pauli, meine Freiheit - Sieghard Wilm - Страница 8
Jenseits von Friedhof und Fluss
ОглавлениеVon dem Bauerndorf an der Bundesstraße nach Hamburg trennten uns der Friedhof und der Fluss. Östlich der Brücke über den Fluss lagen die Siedlungen. Hier wohnten die Flüchtlinge und ihre Kinder. Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten, die seit 1945 in Schleswig-Holstein hängen geblieben waren – so wie die Familien meiner Eltern. 1969 bauten sie ein Haus auf einem sandigen Hügel, billiges Kirchenland oberhalb einer nassen Wiese. Irgendwie hatten sie die 5000 Mark Mindestkapital zusammengekratzt, um sich an diesem sozialen Siedlungsbauprojekt zu beteiligen. Was an Geld fehlte, wurde mit Eigenleistung wettgemacht. Die Nachbarn waren ja ebenfalls Flüchtlinge und alle hielten zusammen. Mein Vater war nach Feierabend im Sommer immer auf dem Bau, sonnengebräunt im Unterhemd, mal bei den Nachbarhäusern, mal auf unserer Baustelle. Ein Haus nach dem anderen wurde so in Gemeinschaftsarbeit hochgezogen. Bescheidene Häuser, aber für eine ganze Generation von sogenannten „Siedlern“, wie man im Dorf sagte, waren sie das Symbol für ein besseres Leben.
Wir Kinder mussten die Erwachsenen auf der Straße als erstes grüßen, wenn wir uns nicht den Schimpf von Mutter anhören wollten, dass ihr zu Ohren gekommen war: „Ihre Kinder grüßen ja gar nicht!“ Wer in der Siedlung lebte, musste sich besonders gut benehmen, weil zu beweisen war, dass diejenigen, die sich nicht zu den Alteingesessenen zählen dürfen, etwas taugen.
Damals war ich vier Jahre alt und mächtig stolz auf unser Haus. Um den Westwind auf dem Sandhügel zu bremsen, pflanzte mein Vater ein Fichtenwäldchen aus Setzlingen, die groß waren wie seine Hand. Ich durfte die Jahre meiner Kindheit zusehen, wie die Bäume wuchsen, bis man den Friedhof auf der anderen Seite des Flusses nicht mehr sah. Dort lagen meine Großeltern und meine Urgroßmutter in einer Erde, die sie nicht ihre Heimat nannten. Ich habe schwache Erinnerungen an meine väterlichen Großeltern, die sich 1970 in derselben Woche von der Erde verabschiedeten. Opa roch nach Jägermeister und Juno-Zigaretten und stand mit seiner schwarzen Arbeitermütze stolz an der Bundesstraße, die er mitgebaut hatte. Oma trank mit rasselnder Lunge ihren Hustensaft aus der Flasche und hatte noch den Geruch von Brathering mit Zwiebeln in der Strickjacke.
Großgeworden bin ich unter Menschen, die den Krieg und die Flucht als Erwachsene oder als Kinder erlebt hatten. „Ihr wisst ja gar nicht, wie gut es ihr habt“ – wie oft habe ich das gehört, so auch aus dem Mund meines Vaters. Als mein Bruder, meine Schwester und ich nur das weiße Fleisch des Hühnchens essen wollten, nicht aber den Knorpel und die fette Haut, übernahm er unsere Reste und brach auch noch die Knochen des Vogels auseinander, um das Mark auszusaugen. Das Kinn meines Vaters glänzte vor Fett. In diesen Momenten war mein Vater wieder der neunjährige Junge Kurt, 1936 in einer Danziger Arbeiterfamilie geboren, der Kartoffeln und Eier beim Bauern klaute, um zu überleben. Der im Sommer barfuß die vier Kilometer zur Schule lief und sich im frostigen Winter an eine Kuh anschmiegte, um sich aufzuwärmen. Die Familie meines Vaters lebte nach der Flucht zunächst in einem Kuhstall. Dafür mussten der Neunjährige und seine Brüder auf den Bauernhöfen arbeiten: Die Wiese mit der Sense mähen, mit Pferdegespann den steinigen Acker pflügen. Sieben Jahre hat mein Vater diese harte Arbeit nach dem Unterricht in der Volksschule gemacht. Dafür zahlte der Bauer den Anzug zur Konfirmation. Mit den Flüchtlingen gingen die Bauern mal besser, mal schlechter um. Billige Arbeitskräfte waren die jungen Männer, die sich nach der Feldarbeit abends auf die Bratkartoffeln stürzten. Aber der feine Schinken blieb für den Bauern und seine Familie, erzählte mein Vater. Eigentlich wollte Kurt weiter zur Schule gehen und studieren. Doch dafür fehlte das Geld.
In den 1950er-Jahren gab es zu wenig Ausbildungsplätze. Da mein Vater mit Pferden gut konnte und sie zu beruhigen wusste, wenn der Schmied die glühenden Eisen auf die Hufe schlug, überlegte er, Schmied zu werden. Aber die Pferde wurden durch Maschinen ersetzt und weil es nichts anderes gab, wurde mein Vater Lehrling bei einem Tankwart. In den 50ern war das ein Ausbildungsberuf, die Bezahlung war mies.
Während Kurts ältere Brüder sich einen Ruf im Dorf erarbeiteten – Wer kann am meisten Eier essen oder eine Flasche Oldesloer Doppelkorn am schnellsten trinken – entschied sich mein Vater für einen anderen Weg. Als junger Mann fand er eine Art Ersatzfamilie im Nachbardorf, deren Bedeutung ich erst viel später verstanden habe. Sein bester Freund war der Sohn des Hauses – fromme Ostpreußen, die den jungen Mann Ende der 50er wie einen Sohn aufnahmen. Bei ihnen hatte mein Vater gelernt, was Familie bedeutet. Da gab es gutes Essen auf dem Tisch. Aber genauso wichtig war das Gebet. Eine Nähe und Warmherzigkeit und ein Glaube, der das Leben „umbetet“, so wie ein Gemüseacker umgegraben wird, mit Geduld und Hoffnung. Diese Ostpreußen wollten Seelen retten. Und mein Vater wollte sein haltloses Leben retten lassen. Dass er dabei meine Mutter kennenlernte, ist die Gründungslegende unserer Familie. Es geschah durch einen schrecklichen Unfall. Mein Vater hatte mir als Kind die Narbe in der Rinde eines Baumstamms an der Landstraße gezeigt, wo es passiert ist. Damals, Anfang der 60er, fuhr er gerne Motorrad und genoss die Geschwindigkeit in der baumgesäumten Allee. Mit einem der Bäume hatte er einen Frontalzusammenstoß. Das kostete ihn seine vier Schneidezähne und mehrere Knochenbrüche. Im Krankenhaus hatte Kurt Besuch von seinem besten Freund. Dessen Schwester war dort Krankenschwester, und deren Mitschwester und Freundin wiederum war Gismara. Was für ein ungewöhnlicher Name! Ich frage mich, was meine Mutter an diesem Mann fand, dem die vier Schneidezähne fehlten. Vielleicht hatte Gismara erkannt, dass es Kurt genauso ging wie ihr. Beide hatten in ihren kaputten Familien nichts zu lachen.
Meine Mutter hatte ihren Vater niemals kennengelernt. Nach ihrer Geburt 1942 erreichte meine Oma Martha die Nachricht, dass der deutsche Besatzungssoldat, den sie im polnischen Lodz kennengelernt hatte, gefallen war. Nun stand sie alleine mit zwei Kindern, Gisela und Gismara. Gisela wurde ihr von den Nazis weggenommen und zur Adoption freigegeben. Gismara wurde bei Verwandten in Berlin untergebracht. Oma wurde 1915 noch im russischen Zarenreich in Bialystok geboren. Zeitlebens sprach sie ein merkwürdiges Deutsch mit ihrer eigenen osteuropäischen Grammatik. Wir Enkelkinder fanden das komisch und machten uns darüber lustig. Polnisch sprach Oma mit den alten Tanten bei unseren Familientreffen, wenn wir Jungen es nicht verstehen sollten. Die heranwachsende Generation wollte man nicht mit den finsteren Geschichten belasten. Ich war der einzige Enkel, der mehr wissen wollte über diese Zeit, aber Oma wollte meine Fragen nicht beantworten. Dass sie mit dem Berliner Opa nie verheiratet war und dass sie für die Deutschen Handgranaten zusammenbauen musste, war lange ihr großes Geheimnis. So sehe ich sie vor mir, Kartoffeln schälend. Eine gebrochene kranke Frau, kaum 1,50 groß mit einem verkürzten Bein als Folge von Kinderlähmung, das niemals heilen wollte. Oma war immer wieder wochenlang nicht erreichbar, in sich versunken und gefangen in ihrer Gedankenwelt irgendwo zwischen Bialystok, Warschau und Lodz unterwegs in den 1930er- und 40er-Jahren.
Meine Mutter erzählte mir, als ich erwachsen genug war, dass ihre Mutter nicht gut für sie sorgen konnte. Die kleine Gismara musste sich selbst durchs Leben kämpfen. Sie erzählte, wie sie nur ein Kleid hatte und die Schule schwänzen musste, wenn dieses Kleid gewaschen wurde. Solche Erfahrungen aus den Tagen des Mangels hatte sie mit meinem Vater gemeinsam. Ich habe Eltern, die selbst keine Geborgenheit in Familien erlebt haben, wie es Kindern zu wünschen wäre. Kurt und Gismara wollten eine Familie gründen und das miteinander verwirklichen, was sie selbst nicht kannten.
Beide wurden von Kurts ostpreußischer Ersatzfamilie aufgenommen, die eine stabile Frömmigkeit hatten und ihre Mission als Seelenretter ernst nahmen. Meine Eltern übergaben „dem Herrn Jesus ihr Leben“, wie es im frommen Sprachgebrauch heißt. Statt mit der Dorfjugend zu saufen und sich zu prügeln, lernte mein Vater Gitarre spielen und fromme Lieder singen. Meine Eltern gingen gemeinsam zur Stunde. Das war ein Gottesdienst in einer Hauskirche der sogenannten Altpfingstler, einer Glaubensgemeinschaft, die dem Wirken des Heiligen Geistes viel zutraut.
Oma Martha verweigerte vor Gismaras Volljährigkeit mit 21 die Zustimmung zur Heirat ihrer Tochter mit dem Tankwart. Er war ihr wohl nicht gut genug als Schwiegersohn. Aber das half nichts. 1963 heirateten meine Eltern mit bescheidenen Mitteln. 1964 wurde mein Bruder Burkhard geboren, 1965 kam ich zur Welt und 1968 meine Schwester Susanne. Meine Mutter war kaum 26 Jahre alt und hatte drei Kindern das Leben geschenkt. Als sich meine Eltern kennenlernten, so erzählten sie später, hatten sie zwölf Kinder haben wollen. Nachdem das erste Kind geboren wurde, reduzierten sie auf sechs. Und nach dem Dritten sagten sie: Es reicht.
Als Fünfjähriger wurde ich dann in die Hausstunden mitgenommen, bei denen ein Prediger vor kaum zwanzig meist älteren Damen stand. Es roch nach Mottenkugeln und nach Kölnisch Wasser. Wir mussten stillsitzen, der strenge Blick meiner Mutter ließ uns erstarren. Die sogenannte „Stunde“ dauerte viel länger als eine Stunde. Während sich die Predigt in die Länge zog, beeindruckte mich das Doppelkinn und die Nickelbrille des Predigers oder mein Blick betrachtete das Bild vom guten Hirten an der Wand. In seinem langen weißen Gewand unterließ der Heiland nichts, um ein verirrtes Schaf aus dem Dornengestrüpp zu retten. Die Gebete der alten Frauen beeindruckten mich tief. Jesus war der wichtigste Mann in ihrem Leben. Sorgen machte mir nur, wenn die in Ehren ergrauten Kriegerwitwen von der Heimat sprachen. Entweder war damit Ostpreußen gemeint – oder die himmlische Heimat, in die sie Jesus Christus abholen würde. Auf keinen Fall aber das irdische Leben in der Gegenwart, denn hier waren wir ja nur unstete Pilger. Als kleiner Junge machte mich das immer etwas traurig, die Alten so reden zu hören, war ich doch gerade erst auf dieser Erde angekommen und fand es hier manchmal ganz schön. Nach der „Stunde“ gab es Schokolade als Belohnung. Und für die Damen gab es Kaffee und Kuchen und manchmal einen Eierlikör oder einen Kirsch. Dann war das Leben doch für einen Moment irgendwie gut auf dieser Erde.
Meine Eltern müssen wohl gemerkt haben, dass die Stunden nicht gerade kindgerecht waren. Die Landeskirche war meinen Eltern zunächst nicht fromm genug. Aber 1970 kam ein junger Pastor ins Dorf, dessen baptistische Frau den Kindergottesdienst hielt. Das Ergebnis war, dass wir sonntags jetzt vormittags Kindergottesdienst und nachmittags „Stunde“ hatten. Unvergesslich sind mir die Fleißkärtchen des Kindergottesdienstes, wie große Briefmarken, mit gezähnten Rändern. Biblische Szenen waren altmodisch dargestellt. Den guten Hirten kannte ich ja schon. Nun wuchs mit jedem Besuch des Kindergottesdienstes meine fromme Bilderwelt: Arche Noah, Opferung Isaaks, Davids Sieg über Goliath, Daniel im Feuerofen, Jesus wandelt über das Wasser. Das waren meine Helden, während andere Jungs Comicfiguren wie Lucky Luke – der damals noch rauchen durfte – oder Superman verehrten. Nach ein paar Jahren Kindergottesdienst hatte ich alle Fleißkärtchen doppelt.
Schon früh war ich ein guter Sammler. Was mich viel mehr als Fleißkärtchen interessierte, waren Steine, besonders Fossilien. Ich hatte als Kind meinen Blick immer zu Boden gerichtet. Ich suchte, aber ich fand auch immer irgendetwas, dass zumindest ich interessant fand. Meine Mutter zischte nur: „Was wühlst du im Dreck. Schmeiß das weg!“ Aber ich versteckte meine Schätze und baute mir ein Museum daraus, dessen Direktor und einziger Besucher ich war.
Es war die Zeit der großbemusterten Tapeten und der Prilblumen, als ich 1971 eingeschult werden sollte. Um meine Schulreife zu beweisen, sollte ich ein Bild malen, während sich eine Lehrerin mit meiner Mutter unterhielt. Ich konnte immer schon gut malen und überreichte stolz mein Blatt. Es zeigte ein Haus mit freundlichen Gesichtern, die aus den Fenstern schauten, der Schornstein rauchte.
Das einzige, was die Lehrerin zu mir sagte, war: „Das war leider das falsche Händchen.“ Ich hatte das Bild mit links gemalt. Linkshänder konnte man nicht dulden. Ich wurde nicht eingeschult. Meiner Mutter wurde der Auftrag gegeben, mich umzuerziehen. Als ich der Lehrerin zum Abschied das richtige Händchen entgegenstreckte, war aus mir ein trotziger Junge geworden. Ein Jahr später kam ich dann in die Schule. 1972 wehte auch in der holsteinischen Dorfschule ein anderer Wind. Junge Lehrer kamen mit weiten Schlaghosen und Lehrerinnen mit kurzen Röcken. Und ich durfte mit links schreiben und malen. Ich habe aber diese Demütigung der Einschulung nie vergessen. Für mich war seit dieser Zeit klar, dass ich denen, die viel zu sagen haben, nicht immer vertrauen werde. Meine linke Hand hat mich ungewollt zum „linken Systemkritiker“ werden lassen.
Anfang der 1970er-Jahre begann meine Mutter zu arbeiten. Neben unserer Haustür wurde ein weißes Emailleschild mit einem rotem Kreuz angebracht. Hier war jetzt eine Sozialstation. Meine Mutter, examinierte Krankenschwester, hatte extra den Führerschein machen müssen, um mit einem weißen VW Käfer über Land zu fahren und in den zwölf Dörfern, die ihr zugeteilt worden waren, Alte und Kranke zu besuchen, Beine zu wickeln, Blutdruck zu messen, Blutegel anzulegen oder Menschen zu waschen, die dies lange schon nicht mehr selbst getan hatten. Mutter konnte immer Geschichten erzählen, wenn sie von ihren Touren nach Hause kam! Niemand hat die Schattenseiten des Landlebens so hautnah erlebt wie sie. Als Kinder waren wir es gewohnt, wenn sie von durchgelegenen wunden Rücken erzählte, eingekoteten Greisen oder künstlichen Darmausgängen. Wir aßen zu Mittag, hörten unserer Mutter zu und lernten fürs Leben: Auf den Bauernhöfen entledigte man sich der unliebsamen, bettlägerigen Eltern manchmal dadurch, dass in einer kalten Winternacht die Fenster weit aufgerissen wurden. Am kommenden Morgen war der Körper kalt. Mir lief ein Schauer über den Rücken, wenn Mutter sowas erzählte. Aber ich bewunderte sie auch dafür, dass sie es aushielt mit dem körperlichen Gestank und dem Dreck, die sie ertrug, weil sie das Menschliche liebte. Ich war stolz auf meine Mutter, weil sie alltäglich getan hat, was sie glaubte. Nicht viel reden, sondern tun – das war meine Mutter.
Bald waren wir Kinder in der Sozialstation häusliche Sekretäre. Unsere Haustür war nicht mal abgeschlossen und es passierte, dass eine muffig riechende Alte in Kittelschürze plötzlich im Hausflur stand und meine Mutter sprechen wollte, die gerade auf den Dörfern unterwegs war. Dann habe ich einen Sessel angeboten, Getränke gereicht und ein höfliches Gespräch gesucht – und gehofft, dass meine Mutter bald wiederkommt.
Meine Eltern haben sich geliebt. Meine Mutter hat sonntags meinem Vater immer die Kleidung bereitgelegt. Er wäre gar nicht in der Lage gewesen, sich eine passende Krawatte zum Anzug auszusuchen. Aber ich habe meinen Vater niemals im Haushalt helfen sehen. Einige Male hat er Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Eiern gemacht. Sonst kam er abends müde und nach Benzin riechend von der Arbeit nach Hause und erwartete, bedient zu werden. Meine Mutter hat die Hausarbeit und das Kochen niemals gerne gemacht. Dabei war sie oft übellaunig. Sie fand ihre Erfüllung in ihrem Beruf als Krankenschwester.
Meine Eltern wollten eine Familie schaffen, die sie sich selbst als Kinder gewünscht hätten. Der eigene Erwartungsdruck muss für meine Mutter ganz besonders hoch gewesen sein. Ich erlebte sie als Kind meistens als eine starke, selbstbeherrschte Frau, die stolz war, alles im Griff zu haben und zwar immer zack zack. Dann aber konnte es passieren, dass sie ausbrach wie ein Vulkan. Sie konnte sich in einem Moment komplett vergessen und von einem Anfall von Jähzorn gepackt werden. Als Kind erlebte ich, dass diese Wutanfälle nicht meinen älteren Bruder, nicht meine jüngere Schwester trafen – sie trafen mich. Ich habe später viel darüber nachgedacht, warum ich es war. Was an mir falsch war. Ich konnte meinen Fehler nicht finden und das machte mich ohnmächtig. Aus nichtigem Anlass – ein nicht aufgegessenes Leberwurstbrot, in dem mich die Fettstücke ekelten – rastete meine Mutter aus. Sie schlug mich mit dem Teppichklopfer, mit dem Gürtel, mit den bloßen Fäusten auf Arsch und Rücken. Sie auf mir, ich unter ihrer Körpermasse. Ich weiß noch genau, dass in diesem Moment etwas an Vertrauen kaputtging, was niemals wieder gut wurde. Mein Gesicht soll ihr am ähnlichsten sein. Wir sind uns nahe und doch fremd.
Vater hat uns nie geschlagen. Heute denke ich: Vielleicht war das auch bequem für ihn, unserer Mutter das Erziehungsgeschäft weitgehend zu überlassen. Ich erinnere ihn als müden Mann, nach Benzin und Schweiß stinkend, noch in der roten Arbeitskleidung, eingeschlafen auf dem Sofa.
Neben den kirchlichen Aktivitäten war mein Vater nach Feierabend ein leidenschaftlicher Gärtner. Mutter herrschte im Haus, Vater hatte sein Gartenreich. Neben Salat, Gurken und Kürbissen gelangen ihm die Tomaten am besten. Er liebte es, uns Kindern eine frische Tomate vom Busch zu pflücken und uns zuzusehen, wie wir die Frucht genossen. Dann lachten seine Augen. Wir Kinder bekamen jeweils wenige Quadratmeter Gartenland zugewiesen, um uns dort mit Gemüseanbau auszuprobieren. Aber nach ein paar Wochen hatten mein Bruder und meine Schwester ihre Parzellen bereits an mich verkauft. Kräuter habe ich gezogen. Salbei, Thymian, Rosmarin. Sie sind immer noch meine Lieblinge im kleinen Pastorengarten auf St. Pauli. Bei der Gartenarbeit denke ich oft an meinem Vater, besonders, wenn ich eine frische Tomate ernte und genieße.
Die Liebe zu den Pflanzen, die Begeisterung an ihrem Wachstum und die Geduld dazu habe ich von meinem Vater. Auch Bäume habe ich als Kind geliebt und hatte meine Lieblinge, knorrige Knickeichen zwischen den Feldern, die ich gerne besuchte. Ihre raue Borke zu spüren, ihr Laub im Wind zu hören gab mir eine tiefe Kraft, ein Gefühl von Verstandenwerden und Einssein. Auch bestimmte Plätze waren mir heilig. Dort war ich gerne alleine und fühlte mich zugehörig. Als ich zwölf war, bin ich eines Abends mit dem Fahrrad wenige Kilometer den sandigen Feldweg in einen kleinen Wald gefahren. Dort stieg ich die grobe Leiter hoch zu einem Jagdstand. Fern des Dorfes genoss ich die Stille und lauschte dem Knarren der Äste, den Vogelstimmen und dem Rascheln und Grunzen der Wildschweine. Das war meine ganz eigene Religion, die keine Heiligen Schriften kannte. Das wichtigste, was ich damals von den Bäumen gelernt habe, war ein Gebet, das nicht Reden war, sondern Schweigen und Hören.
Mein Vater konnte auch streng sein. Einmal hatten mein Bruder und ich von irgendwoher ein Kartenspiel. Wir waren damals 14 oder 15 Jahre alt. Heimlich spielten wir Mau Mau. Als das mein Vater sah, hielt er uns eine Moralpredigt: Die Karten seien vom Teufel. Haus und Hof hätten Männer schon verspielt beim Kartenspiel, das nur einen Gewinner kennen würde – Satan höchstpersönlich. Damals hatten wir einen Holzofen, den mein Vater nun mit dem Kartenspiel befeuerte, während mein Bruder und ich kleine Münder und große Augen machten.
Mein Vater war sonst ein herzenswarmer Mann, offen und aufmerksam gegenüber jedem. So kannten ihn seine Kunden an der Tankstelle in der Kreisstadt. Diese Tankstelle hatte er aufgebaut, sie war sein Stolz. Mit einer Zapfsäule fing es an, die zuerst nur den Betriebsfahrzeugen eines Möbelgeschäfts zugedacht war. Dann wollten Kunden billig tanken und das Unternehmen wuchs über 20 Jahre. Mein Vater wurde Chef von 30 Mitarbeitern. Sein Stolz war es, die günstigste freie Tankstelle Norddeutschlands zu betreiben. Sollte ihm zu Ohren gekommen sein, dass der Liter Super, Diesel oder Benzin irgendwo einen Zehntel Pfennig günstiger war als auf seiner Tanke, dann unterbrach er sogar den Sonntagsfrieden, fuhr zum Betrieb und steckte die Preistafeln um. Die Konkurrenz wurde immer unterboten.
Mein Vater machte sich einen Spaß daraus, sich einen Tankwart und einen Dankwart zu nennen. Sonntags schrubbte er seine breiten Hände, die sonst immer nach Benzin rochen und kratzte den Dreck der Woche unter seinen Fingernägeln hervor. Er ging nicht nur regelmäßig in den Gottesdienst und sang im Kirchenchor mit, sondern er war auch ehrenamtlicher Prediger bei der altpfingstlerischen Stundengemeinde, eine kleine Freikirche, in der sich vor allem ostpreußische Erweckungsfrömmigkeit bewahrte. Ich war immer stolz, ihn dort vorne so schick angezogen stehen zu sehen. Mutter hatte ihm eine schöne Krawatte ausgesucht und gebunden.
Aber auch in der Landeskirche durfte der Tankwart zum Dankwart werden und als Lektor den Gottesdienst halten, wenn der Pastor mal Vertretung brauchte. Das gab im Dorf natürlich etwas Gerede: „Ist das nicht der Kurt Wilm, der Tankwart? Wusste gar nicht, dass der auch Pastor ist. Darf der das überhaupt?“
Schlichte Sätze waren das, die mein Vater fand. Ruhig und sanft waren seine Worte. Interessant wurde es, wenn er Erfahrungen von der Tankstelle anbrachte, dann hörten die Leute richtig zu. Auf keinen Fall war er ein Schwätzer. Er erzählte frei von seinem Glauben, das überzeugte die Leute.
Auch auf der Tankstelle bot er neben Scheibenwischen und Luftdruckmessen dazu noch Lebenshilfe an. Er konnte den Kunden gut zuhören und entdeckte missionarische Chancen zwischen Zapfsäule und Ölwechsel. Als Tankwart war er immer ein Dankwart. Und als Prediger versteckte er nicht den Tankwart. Das machte ihn glaubwürdig für mich.
In der Grundschule war ich mit vielen Kindern in der Klasse noch befreundet. Das sollte sich dann mit dem Wechsel aufs Gymnasium in der Kreisstadt ändern. Ich hatte als Grundschüler sogar eine eigene Freundin. Unser Abenteuerort war ein kleines Wäldchen. Unbesorgte Stunden verbrachten wir dort und im Sommer schwammen wir über den See, der modrig roch, wenn er in voller Algenblüte stand.
Spielten wir anfangs noch mit den anderen Kindern in der Siedlung, so änderte sich das bald. Zunehmend trafen wir uns nur noch mit den „Gläubigen“ im Dorf. Kinderfasching durften wir nicht mitmachen, das war Heidenkram. Die Gemeindeveranstaltungen banden alle Freizeitaktivitäten. Sonntags traf sich die Dorfjugend zum Fußballspiel, während wir in der Kirche saßen. Bald hatten wir den Ruf, die Frommen zu sein. Die Fremdheit zum übrigen Dorf wuchs.
Mit dem Pastor und seiner Frau wuchsen wir wie mit zweiten Eltern auf. Das kinderlose Paar hatte zwei Dutzend Jugendliche um sich versammelt. Bald wurde neben unserem Gemeindehaus ein Volleyballplatz angelegt. Nachdem wir uns dort ausgetobt hatten, hieß es wieder Singen, Beten, Bibel lesen. Meine Eltern fanden uns in dieser Gemeinschaft gut aufgehoben. Die Gemeinde würde uns wenigstens vor den Dorfdiskos mit ihren Besäufnissen und Schlägereien schützen, dachten sie. Aber es war eine enge Frömmigkeit, in der wir erzogen wurden.
Die Welt wurde aufgeteilt in Wiedergeborene, Nennchristen – ein böserer Ausdruck war „Karteileichen“ – und den anderen, die es noch so auf der Welt gab: Katholiken, Atheisten, Muslime und alle anderen Angehörigen von Religionen, die alle leider in die Hölle kommen würden. Ja, die Hölle war merkwürdig geräumig in den Lehren, die ich als Heranwachsender zu hören bekam. Und der Himmel war ein sehr kleiner Ort. Dafür mit goldenen Straßen und Toren von Perlen, wie es die Offenbarung des Johannes beschreibt. Und alle werden Gott ein ewiges Lob singen. Mir kam das als Pubertierendem ziemlich dumm vor, zumal ich gerade im Stimmbruch war. Ich wollte nicht immer singen müssen. Das wäre doch die Hölle.
Um in den Himmel zu kommen, musste man sich bekehren – so haben wir das damals gelernt. Oder anders ausgedrückt: Sein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Ich hatte es schon erlebt, wie Menschen sich schluchzend unter Tränen bekehrten, bereit zur Buße und öffentlichem Bekenntnis vor der Gemeinde. Aber was hatte ich als Heranwachsender schon zu bieten? Für so viele Sünden war doch noch keine Zeit.
Mit Unbekehrten sollte man besser keine Gemeinschaft haben – so wurde es uns geraten. Ich fand das immer etwas hart. War ich mal bei Schulfreunden zu Besuch und vergaß mich einen Moment im kindlichen Spiel, dann tauchte diese Warnung in mir auf: Das sind unbekehrte Weltkinder. Und ich wurde für einen Moment traurig durch ein Wissen, das ich nicht mit den anderen teilen konnte: Diese Kinder, die mich so fröhlich anlachen, gehen ewiglich verloren!
„Was habt ihr gemein mit der Welt?“ Das war so ein hartes Bibelwort, von denen es viele gab. Mit Weltkindern war kein Umgang angeraten. Es sei denn, um sie zur Bekehrung zu führen. Die „Ungläubigen“ mussten so werden wie wir. Wer andere zur Bekehrung brachte, der hatte bei Gott etwas gut. Aber je älter ich wurde, umso peinlicher fand ich es, die anderen bekehren zu müssen.
Mein ein Jahr älterer Bruder war mir immer in allem ein Stück voraus. Mathematik war seine Stärke, ich habe dieses Fach immer gehasst. Er kam aufs Gymnasium, für mich hatte man die Realschule vorgesehen. Unsere Eltern hatten beide nur den Hauptschulabschluss gemacht, auf der weiterführenden Schule konnten sie uns nicht mehr bei den Hausaufgaben helfen. Was mein Bruder bekam, wollte ich auch bekommen. Die brüderliche Konkurrenz brachte mich dazu, alle meine Kräfte zu sammeln und meine schulischen Leistungen so zu verbessern, dass es für das Gymnasium in der Kreisstadt reichte. Man wollte es mit mir zumindest versuchen.
Im Religionsunterricht sollten wir einmal malen, wie wir uns Gott vorstellen würden. Die ganze Stunde saß ich vor dem weißen Blatt Papier und starrte es an. Bei den anderen Schülern sah ich schon bärtige Greise auf Wolken sitzen, als der Lehrer mich fragte, warum ich denn mit meiner Aufgabe nicht anfangen würde. Da nahm ich all meinen Bekennermut zusammen und sagte: „Du sollst dir kein Bildnis machen!“ Der Lehrer war unzufrieden mit mir, die Mitschüler grinsten ihr Dorfdeppengrinsen.
Schnell wurde ich zu einem Außenseiter. Ich habe es gehasst, von den grinsenden Rudeln der Jungen in meiner Klasse gedemütigt zu werden. Nicht dazu zu gehören, das war die Hölle. Ich hielt durch, aber in der siebten Klasse konnte ich nicht mehr.
Es war Sommer, wir Jungs fuhren die zwölf Kilometer Schulweg in die Kreisstadt mit dem Fahrrad. Unterwegs traf ich auf drei Mitschüler, die mir grinsend und feixend den Weg versperrten, mich anfuhren und schubsten. Ich weiß nur noch, dass ich nach vorne über den Lenker gestürzt bin. Als ich aufwachte, tasteten meine Hände instinktiv mein Gesicht ab und spürten das klebrige Blut. Ich muss auf eine Betonkante geflogen sein, auf der linken Wange war eine vier Zentimeter lange Schnittwunde, die genäht werden musste. Zwei Vorderzähne saßen locker. Ich sah als 13-Jähriger in den Spiegel, sah mein geschwollenes Gesicht und mir kamen die Tränen. „Niemals wieder werde ich heil und schön aussehen“ – das war mein erster Gedanke. Hass stieg in mir auf. Jesus hatte gesagt, dass wir nicht hassen sollen. „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“, so hatte ich es auswendig gelernt. Aber jetzt spürte ich vielleicht das erste Mal den Hass – eine starke Kraft, die mir bis dahin unbekannt war. Ich musste, während mir die Tränen runterliefen, an die dummen grinsenden Jungengesichter denken, die den Unfall provoziert hatten. Und ich tat etwas sehr Böses: Ich nutzte meine guten Kontakte zu Gott und stieß einen Fluch aus. Jahre später, als ich schon vor dem Abitur stand, erfuhr ich, dass einer von den Dreien gestorben war, kaum volljährig geworden. Ich erschrak und bereute meinen Fluch. Als ein weiterer nach einer Dorfdisco schwer zusammengeschlagen worden war, betete ich nun darum, dass er es überleben möge. Er überlebte. Der Dritte hatte, wie ich Jahre später erfuhr, einen Laden aufgemacht und ging schließlich hochverschuldet damit pleite. Nie wieder würde ich jemanden verfluchen. Die Narbe in meinem Gesicht erinnert mich bei jedem Blick in den Spiegel daran.
Nachdem ich in der siebten Klasse sitzengeblieben war, hieß mich meine neue Schulklasse herzlich willkommen. Ich fühlte mich wohl und wurde nach einem Jahr sogar zum Klassensprecher gewählt. Der Direktor der Schule gehörte zu meinen Vorbildern. Er unterrichtete Religion in meiner Klasse. Ich spürte bei ihm immer einen Respekt vor dem Glauben, auch vor meinem Glauben. Deshalb vertraute ich ihm und hatte den Mut, ihm gedanklich zu folgen. Seine Spezialität war der interreligiöse Vergleich: Das Lamm bei der Pessach-Feier der Juden, das Osterlamm der Christen, das Lamm, das die Muslime zum Opferfest schlachten. Mir gefiel diese Verwegenheit, über den Horizont der eigenen Religion hinauszuschauen.
Biologie war eigentlich eines meiner starken Fächer. Aber mir grauste davor, als der Lehrplan die Evolutionslehre vorsah. „An sechs Tagen erschuf Gott, der HERR, die Erde. Am siebenten Tag ruhte er.“ Damit war ich in meiner Gemeinde erzogen worden. Und jetzt sollte ich an den Urknall glauben, an den Zufall, an den Affen als unseren Verwandten? Im Unterricht war ich dauerempört und unfähig, irgendetwas von dieser Irrlehre aufzunehmen. Ich brauchte meine ganze Energie, mich einem Märtyrer gleich, dem System zu verweigern. „Stellt euch nicht dieser Welt gleich“ – das hatten wir gelernt. Und in der Gemeinde hatten sie uns oft erzählt, dass es uns nicht wundern soll, wenn die Welt uns hassen wird. Als der Biologietest geschrieben wurde, erklärte ich dem Lehrer, warum die Evolutionstheorie eine Irrlehre war und was die Bibel lehrt. Ich bekam eine schlechte Note, aber Biologie blieb mein Lieblingsfach.
Mein Lateinlehrer war für mich der größte Gegner am Gymnasium. Wenn er von Cäsar im Gallischen Krieg sprach, dann wechselte er öfter zu General Rommel in Nordafrika. Mit dem hatte mein Lateinlehrer seine besten Jugendjahre verbracht und erzählte von dieser Zeit wie von einem Pfadfinderausflug. Vielleicht lag mir Latein einfach nicht, aber die entscheidende Blockade setzte dadurch ein, dass ich einmal dran kam und keine Übersetzung liefern konnte. Mein Lehrer wusste zu kommentieren: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ Ich frage noch einmal nach, wie er es meinte, weil ich das so unfassbar verächtlich fand. Ja, ich hatte richtig gehört. Er meinte es so. Mein Vater bediente ihn an der billigsten Tanke Norddeutschlands, was hatte sein Sohn dann im Lateinunterricht zu verlieren?
Ich war tatsächlich das einzige Kind eines Arbeiters in meiner Klasse. Als mir das bewusst wurde, wollte ich mich erst recht nicht beugen. Vermutlich habe ich an diesem Lehrer den Großteil meiner pubertierenden Opposition abreagiert. Meine Eltern haben mich dann eher als still und verträumt erlebt. Als einen, der froh ist, in Ruhe gelassen zu werden.
Latein konnte man als Fach nicht abwählen. Ich hatte null Punkte und war dazu übergegangen, den Unterricht abzusitzen und dabei Karikaturen von meinem verhassten Lateinlehrer anzufertigen. In der Oberstufe musste bei jeder Zeugniskonferenz extra beschlossen werden, dass ich versetzt werde. Ich hatte anscheinend genug Lehrer auf meiner Seite. Meinem Lateinlehrer wollte ich es aber richtig zeigen. Er sollte nicht denken dürfen, ich sei dumm oder faul. Also fing ich an, Griechisch zu lernen. Unser Pastor und seine Frau hatten mit einigen Familien und einem Dutzend Jugendlicher Ende der 70er eine Griechenlandreise organisiert. In den 1980er-Jahren sollten weitere Gemeindereisen folgen. Das war Motivation genug. Neugriechisch wurde in der Volkshochschule unterrichtet. Und ich war mit vollem Eifer dabei, gemeinsam mit dem Pastor und seiner Frau. Meine Griechischlehrerin war eine imposante Erscheinung und rauchte während des Unterrichts eine Zigarette nach der anderen. Ich konnte meinen Blick nicht von ihren rotlackierten Fingernägeln und ihrem rotgeschminkten Mund lassen. Zu meinem Erstaunen reagierte das Pastorenpaar, die immer mehr zu meinen zweiten Eltern wurden, ganz gelassen auf diese „sündige Erscheinung“. Schminke war in unserer Gemeinde verpönt, in der Mädchen allenfalls einen Hosenrock tragen durften, aber keine Hose. Es wurde sogar diskutiert, ob Frauen beim Gebet ein züchtiges Kopftuch tragen sollten. Und Rauchen? Unvorstellbar. Jetzt schienen andere Maßstäbe zu gelten. So eng unsere fromme Gemeinde auch war, mit den insgesamt drei Griechenlandreisen öffnete sich für mich eine neue Welt und mein Griechisch wurde mit jeder Reise besser. Griechenland war immer noch wild, als ich es kennenlernte. Wir holperten über steinige Pisten, auf denen uns Maulesel und Schafherden begegneten und standen plötzlich vor einem zweitausend Jahre alten Tempel. Wir übernachteten in Zelten und billigen Hotels. Wir besuchten Museen mit griechischen Gottheiten, Klöster und Kirchen, die mit Ikonen geschmückt waren. Weihrauch und Gesänge, die meine Seele tief berührten und eine Lebensfreude, die mich ansteckte. Ich hatte Griechenland mit der Seele gefunden.
Später sprach ich mit meinem Bruder darüber, welchen Sinn es denn eigentlich machen würde, das Abitur zu bestehen. In der Gemeinde hatten wir ja gelernt, die Zeichen der Zeit zu deuten. Und eins war klar: Es gab Krieg und Kriegsgeschrei, und das Ende der Herrschaft dieser Welt war nahe. Der Kalte Krieg, der uns zunehmend bewusst wurde, und die atomare Aufrüstung passten einfach gut mit der Apokalypse des Johannes zusammen, in der davon die Rede war, dass das siebente Siegel gebrochen und die Schalen des Zorns ausgeschüttet würden. Wozu dann noch Abitur? Ich rechnete damals nicht damit, älter als dreißig zu werden. Zu finster war es, was sich in der Welt zusammenbraute.
Bibelfest waren wir ja. Mit uns konnten es nur wenige Pastoren aufnehmen. Wir strahlten eine gewisse Überheblichkeit aus, die wir für Frömmigkeit hielten. Bibelverse lernten wir auswendig und auch ganze Psalmen. Ein frommer Sport bestand darin, Bibelverse möglichst schnell aufzuschlagen. Wer den Vers gefunden hatte, durfte ihn stolz aufsagen. Als ich in der Oberstufe war, beteiligte ich mich an einer Pausenandacht in unserer Schule, die man uns Frommen zugestanden hatte. Mache Schüler hatten einfach keine Lust, nach draußen zu gehen. Der Schulhof war ein Territorium anstrengender sozialer Kontakte, die Pausenandacht war ein bequemer Zufluchtsort. Die verlorenen Seelen stellten uns Frommen manchmal Fragen, die mich aus der Fassung brachten. Was ich denn dazu sagen würde, wenn zwei Männer sich lieben? Ich druckste herum, bis mir einige Bibelverse einfielen. Ich murmelte irgendetwas von „… ist dem HERRN ein Gräuel …“ – war aber wie angefasst. „Wenn zwei Männer beieinander liegen wie bei einem Weibe.“ Das hatte ich irgendwo in der Heiligen Schrift gelesen, aber überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so etwas wirklich gibt. Weit entfernt davon, meine eigene Homosexualität zu erkennen, erinnere ich aber bis heute, wie mich das damals getroffen hatte. Es war nicht so, dass Homosexualität ein spezielles Tabu in unserer Gemeinde war. Sexualität war generell ein Tabu.
Eigentlich hätte es auffallen können, dass ich von Mädchen umgeben war, während die anderen Jungs mit Händen in den Hosentaschen von einem Bein auf das andere traten und zu uns herüber schauten. Ich war unbefangen. Ich war naiv, ich war fromm. Ich war blind.
Ich erinnere mich daran, wie ein Mädchen vor mir stand und plötzlich anfing zu weinen. Sie hatte sich offensichtlich in mich verliebt – und ich war kalt zu ihr, weil mein Empfang auf eine andere Frequenz eingestellt war. Ich schaute den Jungs hinterher.
Als ich 16 Jahre alt war, hatte sich mein bester Schulfreund in ein Mädchen verliebt. Die beiden gehörten zu den ersten Paaren und waren sichtlich stolz aufeinander. Als ich sie sah, wie sie in einer Ecke des Pausenhofes innig ineinander verschlungen knutschten, bis die Klingel zum Unterricht schellte und sie nicht zu Ende kommen konnten – da spürte ich einen Stich im Herzen. Heute ist mir klar, dass ich damals in meinen Schulfreund verliebt war. Ich habe es ihm niemals sagen können.
In der Gemeinde hatte das sexuelle Erwachen der Jugendlichen keinen Raum. Sexualität hatte seinen Platz ausschließlich in der Ehe. Dort diente sie der Zeugung von Kindern. Traute sich mal jemand eine Frage zu stellen, dann hieß es oft, dafür seien wir noch zu jung. Als sich der beste Freund meines Bruders, der genauso Gemeindegänger war wie wir, in ein Mädchen aus dem Jugendkreis verliebte, wurden beide beim Händchen halten von unserem Pastor erwischt. Der Gottesmann und seine Frau – ihr Wort war für uns Gesetz – untersagten jeglichen weiteren Kontakt zwischen den Liebenden. Während die Dorfjugend kein wichtigeres Thema kannte als die Frage, wer mit wem was laufen hatte oder wer mit wem warum Schluss gemacht hatte, lasen wir weiter unsere Bibel.
Wenn am Samstag die Dorfdisko lief, zu der die Jugend auf ihren frisierten Mopeds knatterte, dann saßen wir im Gebetskreis mit 20 oder 30 jungen und älteren Menschen zusammen und beteten laut in der Runde. Jeder war der Reihe nach dran. Da wurde um die Bekehrung der Schwester oder der Eltern gebetet, aber auch für die Missionare in Afrika. Und immer wieder war der Gebetsruf zu hören: „Maranatha, komm, Herr Jesus, komm bald!“ Hatte jemand zu Ende gebetet und schloss mit Amen, bekräftigten alle im Chor mit Amen. So ging der Gebetskreis oft zwei Stunden lang.
Als ich endlich mein Abiturzeugnis in Händen hielt und der anschließende Sektempfang im Pausenhof alle auflockern sollte, verabschiedeten sich meine Eltern schnell. Statt auf der Abifete zu tanzen, saß ich abends in einem klassischen Konzert. Auf dem offiziellen Abiturfoto wird man mich vergeblich suchen. Es war eine kleine Welt mit einem engen Horizont, in der ich als 20-Jähriger lebte. Wenn jemand mich damals fragte, hatte ich altklug auf alles eine Antwort. Heute erkenne ich, dass diese fromme Arroganz nichts anderes war als eine Frucht meiner Angst und Isolation.
Die Hamburger Stadtgrenze war von unserem Dorf kaum 40 Kilometer entfernt. Aber die Großstadt war eine Welt, die mich als Dorfkind überforderte. Hatten wir doch gelernt, dass die Kinder die Erwachsenen auf der Straße zuerst grüßen müssen, so ist es höflich. Dabei den Kopf nicken. Ich sehe mich jetzt noch in der Mönckebergstraße vor den großen Kaufhäusern stehen und jeden Passanten grüßen. Aber ich kam einfach nicht mit. Mein Kopf tat schon vom vielen Nicken weh. Die Vorbeieilenden hatten kaum geantwortet. Einige starrten mich fragend an. Ich grüßte weiter. Weil sich das so gehörte.
Zurück aus Hamburg fiel ich sofort ins Bett vor Erschöpfung und wurde von unruhigen Träumen geplagt.
Ein anderes Hamburg-Erlebnis war der Fischmarkt, den ich als Zwölfjähriger besuchte. Draußen war es noch dunkel, als meine Eltern uns Kinder weckten, um nach Hamburg zu fahren. Was für ein Abenteuer! Damals landeten die Kutter noch direkt am Fischmarkt an und verkauften ihre fangfrische Ware. Mein Vater lud den ganzen Kofferraum voll mit Schollen; Flundern nannte der Danziger Junge die platten Fische, die uns unglücklich anschauten und nach Luft schnappten. Zuhause wurden die schleimigen Körper mit einem harten Schlag erledigt und ausgenommen. Dann hatten wir für ein halbes Jahr genug Fisch in der Tiefkühltruhe.
Bei einem unserer Besuche auf dem Fischmarkt nahmen wir uns Zeit, durch einige Straßen St. Paulis zu bummeln. An Harrys Hamburger Hafenbasar konnte ich nicht vorbeigehen und schaffte es irgendwie, meine Eltern von einem Besuch in diesem Kuriositätenkabinett zu überzeugen. Harry Rosenberg saß mit langem Bart geheimnisvoll inmitten geschnitzter Masken aus Java und Nagelfetischen aus Westafrika, getrockneten Kugelfischen und barbusigen Galionsfiguren. Seeleute aus der ganzen Welt waren die Zulieferer von Harry. Es roch süßwürzig nach tropischem Holz und scharf nach Rattenpisse und modrig nach den schimmeligen Kellern. Besonders spannend fand ich aber die beiden Schrumpfköpfe, die Harry auf langes Bitten hin zeigte. Er hielt die Köpfe an ihren langen Haarschöpfen, ihre Münder waren zugenäht. Mich gruselte und gleichzeitig bekam ich Lust auf das Fremde.
St. Pauli sah ich Jahre später, als ich meinen Zivildienst leistete. Aus der Lüneburger Heide kommend hatte mein Zug bei Heimfahrten Zwischenstopp in Hamburg. Ich fuhr ein paar Züge später und machte meine Entdeckungstouren. Auf St. Pauli sah ich die besetzten Häuser der Hafenstraße. Barrikaden waren errichtet. Verwegene Typen schauten mich schmalen Dorfjungen an. Ich war viel zu schüchtern, um in dieser anderen Welt irgendwelche Kontakte zu knüpfen. Es roch verbrannt und gefährlich. Dieses St. Pauli hat mich abgestoßen und zugleich angezogen.