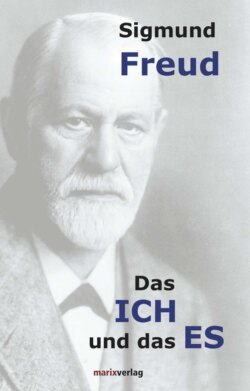Читать книгу Das ICH und das ES - Sigmund Freud - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zur Einleitung der Behandlung
ОглавлениеErschien zuerst in der »Internat. Zeitschrift für ärztl. Psychoanalyse«, Bd. I (1913), dann in der Vierten Folge der »Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre«, gemeinsam mit den beiden folgenden Arbeiten unter dem Obertitel »Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse«.
Wer das edle Schachspiel aus Büchern erlernen will, der wird bald erfahren, dass nur die Eröffnungen und Endspiele eine erschöpfende systematische Darstellung gestatten, während die unübersehbare Mannigfaltigkeit der nach der Eröffnung beginnenden Spiele sich einer solchen versagt. Eifriges Studium von Partien, in denen Meister miteinander gekämpft haben, kann allein die Lücke in der Unterweisung ausfüllen. Ähnlichen Einschränkungen unterliegen wohl die Regeln, die man für die Ausübung der psychoanalytischen Behandlung geben kann.
Ich werde im Folgenden versuchen, einige dieser Regeln für die Einleitung der Kur zum Gebrauche des praktischen Analytikers zusammenzustellen. Es sind Bestimmungen darunter, die kleinlich erscheinen mögen und es wohl auch sind. Zu ihrer Entschuldigung diene, dass es eben Spielregeln sind, die ihre Bedeutung aus dem Zusammenhange des Spielplanes schöpfen müssen. Ich tue aber gut daran, diese Regeln als »Ratschläge« auszugeben und keine unbedingte Verbindlichkeit für sie zu beanspruchen. Die außerordentliche Verschiedenheit der in Betracht kommenden psychischen Konstellationen, die Plastizität aller seelischen Vorgänge und der Reichtum an determinierenden Faktoren widersetzen sich auch einer Mechanisierung der Technik und gestatten es, dass ein sonst berechtigtes Vorgehen gelegentlich wirkungslos bleibt und ein für gewöhnlich fehlerhaftes einmal zum Ziele führt. Diese Verhältnisse hindern indes nicht, ein durchschnittlich zweckmäßiges Verhalten des Arztes festzustellen.
Die wichtigsten Indikationen für die Auswahl der Kranken habe ich bereits vor Jahren an anderer Stelle angegeben.1 Ich wiederhole sie darum hier nicht; sie haben unterdes die Zustimmung anderer Psychoanalytiker gefunden. Ich füge aber hinzu, dass ich mich seither gewöhnt habe, Kranke, von denen ich wenig weiß, vorerst nur provisorisch, für die Dauer von einer bis zwei Wochen, anzunehmen. Bricht man innerhalb dieser Zeit ab, so erspart man dem Kranken den peinlichen Eindruck eines verunglückten Heilungsversuches. Man hat eben nur eine Sondierung vorgenommen, um den Fall kennenzulernen und um zu entscheiden, ob er für die Psychoanalyse geeignet ist. Eine andere Art der Erprobung als einen solchen Versuch hat man nicht zur Verfügung; noch so lange fortgesetzte Unterhaltungen und Ausfragungen in der Sprechstunde würden keinen Ersatz bieten. Dieser Vorversuch aber ist bereits der Beginn der Psychoanalyse und soll den Regeln derselben folgen. Man kann ihn etwa dadurch gesondert halten, dass man hauptsächlich den Patienten reden lässt und ihm von Aufklärungen nicht mehr mitteilt, als zur Fortführung seiner Erzählung durchaus unerlässlich ist.
Die Einleitung der Behandlung mit einer solchen für einige Wochen angesetzten Probezeit hat übrigens auch eine diagnostische Motivierung. Oft genug, wenn man eine Neurose mit hysterischen oder Zwangssymptomen vor sich hat, von nicht exzessiver Ausprägung und von kürzerem Bestande, also gerade solche Formen, die man als günstig für die Behandlung ansehen wollte, muss man dem Zweifel Raum geben, ob der Fall nicht einem Vorstadium, einer sogenannten Dementia praecox (Schizophrenie nach Bleuler, Paraphrenie nach meinem Vorschlag) entspricht und nach kürzerer oder längerer Zeit ein ausgesprochenes Bild dieser Affektion zeigen wird. Ich bestreite es, dass es immer so leicht möglich ist, die Unterscheidung zu treffen. Ich weiß, dass es Psychiater gibt, die in der Differentialdiagnose seltener schwanken, aber ich habe mich überzeugt, dass sie ebenso häufig irren. Der Irrtum ist nur für den Psychoanalytiker verhängnisvoller als für den sogenannten klinischen Psychiater. Denn der Letztere unternimmt in dem einen Falle so wenig wie in dem anderen etwas Ersprießliches; er läuft nur die Gefahr eines theoretischen Irrtums, und seine Diagnose hat nur akademisches Interesse. Der Psychoanalytiker hat aber im ungünstigen Falle einen praktischen Missgriff begangen, er hat einen vergeblichen Aufwand verschuldet und sein Heilverfahren diskreditiert. Er kann sein Heilungsversprechen nicht halten, wenn der Kranke nicht an Hysterie oder Zwangsneurose, sondern an Paraphrenie leidet, und hat darum besonders starke Motive, den diagnostischen Irrtum zu vermeiden. In einer Probebehandlung von einigen Wochen wird er oft verdächtige Wahrnehmungen machen, die ihn bestimmen können, den Versuch nicht weiter fortzusetzen. Ich kann leider nicht behaupten, dass ein solcher Versuch regelmäßig eine sichere Entscheidung ermöglicht; es ist nur eine gute Vorsicht mehr.2
Lange Vorbesprechungen vor Beginn der analytischen Behandlung, eine andersartige Therapie vorher, sowie frühere Bekanntschaft zwischen dem Arzte und dem zu Analysierenden haben bestimmte ungünstige Folgen, auf die man vorbereitet sein muss. Sie machen nämlich, dass der Patient dem Arzt in einer fertigen Übertragungseinstellung gegenübertritt, die der Arzt erst langsam aufdecken muss, anstatt dass er die Gelegenheit hat, das Wachsen und Werden der Übertragung von Anfang an zu beobachten. Der Patient hat so eine Zeitlang einen Vorsprung, den man ihm in der Kur nur ungern gönnt.
Gegen alle die, welche die Kur mit einem Aufschub beginnen wollen, sei man misstrauisch. Die Erfahrung zeigt, dass sie nach Ablauf der vereinbarten Frist nicht eintreffen, auch wenn die Motivierung dieses Aufschubes, also die Rationalisierung des Vorsatzes, dem Uneingeweihten tadellos erscheint.
Besondere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn zwischen dem Arzt und dem in die Analyse eintretenden Patienten oder deren Familien freundschaftliche oder gesellschaftliche Beziehungen bestanden haben. Der Psychoanalytiker, von dem verlangt wird, dass er die Ehefrau oder das Kind eines Freundes in Behandlung nehme, darf sich darauf vorbereiten, dass ihn das Unternehmen, wie immer es ausgehe, die Freundschaft kosten wird. Er muss doch das Opfer bringen, wenn er nicht einen vertrauenswürdigen Vertreter stellen kann.
Laien wie Ärzte, welche die Psychoanalyse immer noch gern mit einer Suggestivbehandlung verwechseln, pflegen hohen Wert auf die Erwartung zu legen, welche der Patient der neuen Behandlung entgegenbringt. Sie meinen oft, mit dem einen Kranken werde man nicht viel Mühe haben, denn er habe ein großes Zutrauen zur Psychoanalyse und sei von ihrer Wahrheit und ihrer Leistungsfähigkeit voll überzeugt. Bei einem anderen werde es wohl schwerer gehen, denn er verhalte sich skeptisch und wolle nichts glauben, ehe er nicht den Erfolg an seiner eigenen Person gesehen habe. In Wirklichkeit hat aber diese Einstellung der Kranken eine recht geringe Bedeutung; sein vorläufiges Zutrauen oder Misstrauen kommt gegen die inneren Widerstände, welche die Neurose verankern, kaum in Betracht. Die Vertrauensseligkeit des Patienten macht ja den ersten Verkehr mit ihm recht angenehm; man dankt ihm für sie, bereitet ihn aber darauf vor, dass seine günstige Voreingenommenheit an der ersten in der Behandlung auftauchenden Schwierigkeit zerschellen wird. Dem Skeptiker sagt man, dass die Analyse kein Vertrauen braucht, dass er so kritisch und misstrauisch sein dürfe, als ihm beliebt, dass man seine Einstellung gar nicht auf die Rechnung seines Urteiles setzen wolle, denn er sei ja nicht in der Lage, sich ein verlässliches Urteil über diese Punkte zu bilden; sein Misstrauen sei eben ein Symptom wie seine anderen Symptome, und es werde sich nicht als störend erweisen, wenn er nur gewissenhaft befolgen wolle, was die Regel der Behandlung von ihm fordere.
Wer mit dem Wesen der Neurose vertraut ist, wird nicht erstaunt sein zu hören, dass auch derjenige, der sehr wohl befähigt ist, die Psychoanalyse an anderen auszuüben, sich benehmen kann wie ein anderer Sterblicher und die intensivsten Widerstände zu produzieren imstande ist, sobald er selbst zum Objekte der Psychoanalyse gemacht wird. Man bekommt dann wieder einmal den Eindruck der psychischen Tiefendimension und findet nichts Überraschendes daran, dass die Neurose in psychischen Schichten wurzelt, bis zu denen die analytische Bildung nicht hinabgedrungen ist.
Wichtige Punkte zu Beginn der analytischen Kur sind die Bestimmungen über Zeit und Geld.
In Betreff der Zeit befolge ich ausschließlich das Prinzip des Vermietens einer bestimmten Stunde. Jeder Patient erhält eine gewisse Stunde meines verfügbaren Arbeitstages zugewiesen; sie ist die seine und er bleibt für sie haftbar, auch wenn er sie nicht benützt. Diese Bestimmung, die für den Musik- oder Sprachlehrer in unserer guten Gesellschaft als selbstverständlich gilt, erscheint beim Arzt vielleicht hart oder selbst standesunwürdig. Man wird geneigt sein, auf die vielen Zufälligkeiten hinzuweisen, die den Patienten hindern mögen, jedes Mal zu derselben Stunde beim Arzt zu erscheinen, und wird verlangen, dass den zahlreichen interkurrenten Erkrankungen Rechnung getragen werde, die im Verlauf einer längeren analytischen Behandlung vorfallen können. Allein meine Antwort ist: Es geht nicht anders. Bei milderer Praxis häufen sich die »gelegentlichen« Absagen so sehr, dass der Arzt seine materielle Existenz gefährdet findet. Bei strenger Einhaltung dieser Bestimmung stellt sich dagegen heraus, dass hinderliche Zufälligkeiten überhaupt nicht vorkommen und interkurrente Erkrankungen nur sehr selten. Man kommt kaum je in die Lage, eine Muße zu genießen, deren man sich als Erwerbender zu schämen hätte; man kann die Arbeit ungestört fortsetzen und entgeht der peinlichen, verwirrenden Erfahrung, dass gerade dann immer eine unverschuldete Pause in der Arbeit eintreten muss, wenn sie besonders wichtig und inhaltsreich zu werden versprach. Von der Bedeutung der Psychogenie im täglichen Leben der Menschen, von der Häufigkeit der »Schulkrankheiten« und der Nichtigkeit des Zufalls gewinnt man erst eine ordentliche Überzeugung, wenn man einige Jahre hindurch Psychoanalyse betrieben hat unter strenger Befolgung des Prinzips der Stundenmiete. Bei unzweifelhaften organischen Affektionen, die durch das psychische Interesse doch nicht ausgeschlossen werden können, unterbreche ich die Behandlung, halte mich für berechtigt, die frei gewordene Stunde anders zu vergeben, und nehme den Patienten wieder auf, sobald er hergestellt ist und ich eine andere Stunde frei bekommen habe.
Ich arbeite mit meinen Patienten täglich mit Ausnahme der Sonntage und der großen Festtage, also für gewöhnlich sechsmal in der Woche. Für leichte Fälle oder Fortsetzungen von weit gediehenen Behandlungen reichen auch drei Stunden wöchentlich aus. Sonst bringen Einschränkungen an Zeit weder dem Arzt noch dem Patienten Vorteil; für den Anfang sind sie ganz zu verwerfen. Schon durch kurze Unterbrechungen wird die Arbeit immer ein wenig verschüttet; wir pflegten scherzhaft von einer »Montagskruste« zu sprechen, wenn wir nach der Sonntagsruhe von Neuem begannen; bei seltener Arbeit besteht die Gefahr, dass man mit dem realen Erleben des Patienten nicht Schritt halten kann, dass die Kur den Kontakt mit der Gegenwart verliert und auf Seitenwege gedrängt wird. Gelegentlich trifft man auch auf Kranke, denen man mehr Zeit als das mittlere Maß von einer Stunde widmen muss, weil sie den größeren Teil einer Stunde verbrauchen, um aufzutauen, überhaupt mitteilsam zu werden.
Eine dem Arzt unliebsame Frage, die der Kranke zu allem Anfang an ihn richtet, lautet: Wie lange Zeit wird die Behandlung dauern? Welche Zeit brauchen Sie, um mich von meinem Leiden zu befreien? Wenn man eine Probebehandlung von einigen Wochen vorgeschlagen hat, entzieht man sich der direkten Beantwortung dieser Frage, indem man verspricht, nach Ablauf der Probezeit eine zuverlässigere Aussage abgeben zu können. Man antwortet gleichsam wie der Äsop der Fabel dem Wanderer, der nach der Länge des Weges fragt, mit der Aufforderung: Geh, und erläutert den Bescheid durch die Begründung, man müsse zuerst den Schritt des Wanderers kennenlernen, ehe man die Dauer seiner Wanderung berechnen könne. Mit dieser Auskunft hilft man sich über die ersten Schwierigkeiten hinweg, aber der Vergleich ist nicht gut, denn der Neurotiker kann leicht sein Tempo verändern und zu Zeiten nur sehr langsame Fortschritte machen. Die Frage nach der voraussichtlichen Dauer der Behandlung ist in Wahrheit kaum zu beantworten.
Die Einsichtslosigkeit der Kranken und die Unaufrichtigkeit der Ärzte vereinigen sich zu dem Effekt, an die Analyse die maßlosesten Ansprüche zu stellen und ihr dabei die knappste Zeit einzuräumen. Ich teile zum Beispiel aus dem Brief einer Dame in Russland, der vor wenigen Tagen an mich gekommen ist, folgende Daten mit. Sie ist 53 Jahre alt, seit 23 Jahren leidend, seit zehn Jahren keiner anhaltenden Arbeit mehr fähig.
»Behandlung in mehreren Nervenheilanstalten« hat es nicht vermocht, ihr ein »aktives Leben« zu ermöglichen. Sie hofft durch die Psychoanalyse, über die sie gelesen hat, ganz geheilt zu werden. Aber ihre Behandlung hat ihrer Familie schon so viel gekostet, dass sie keinen längeren Aufenthalt in Wien nehmen kann als sechs Wochen oder zwei Monate. Dazu kommt die Erschwerung, dass sie sich von Anfang an nur schriftlich »deutlich machen« will, denn Antasten ihrer Komplexe würde bei ihr eine Explosion hervorrufen oder sie »zeitlich verstummen lassen«. — Niemand würde sonst erwarten, dass man einen schweren Tisch mit zwei Fingern heben werde wie einen leichten Schemel, oder dass man ein großes Haus in derselben Zeit bauen könne wie ein Holzhüttchen, doch sowie es sich um die Neurosen handelt, die in den Zusammenhang des menschlichen Denkens derzeit noch nicht eingereiht scheinen, vergessen selbst intelligente Personen die notwendige Proportionalität zwischen Zeit, Arbeit und Erfolg. Übrigens eine begreifliche Folge der tiefen Unwissenheit über die Ätiologie der Neurosen. Dank dieser Ignoranz ist ihnen die Neurose eine Art »Mädchen aus der Fremde«. Man wusste nicht, woher sie kam, und darum erwartet man, dass sie eines Tages entschwunden sein wird.
Die Ärzte unterstützen diese Vertrauensseligkeit; auch wissende unter ihnen schätzen häufig die Schwere der neurotischen Erkrankungen nicht ordentlich ein. Ein befreundeter Kollege, dem ich es hoch anrechne, dass er sich nach mehreren Dezennien wissenschaftlicher Arbeit auf anderen Voraussetzungen zur Würdigung der Psychoanalyse bekehrt hat, schrieb mir einmal: Was uns nottut, ist eine kurze, bequeme, ambulatorische Behandlung der Zwangsneurosen. Ich konnte damit nicht dienen, schämte mich und suchte mich mit der Bemerkung zu entschuldigen, dass wahrscheinlich auch die Internisten mit einer Therapie der Tuberkulose oder des Karzinoms, welche diese Vorzüge vereinte, sehr zufrieden sein würden. Um es direkter zu sagen, es handelt sich bei der Psychoanalyse immer um lange Zeiträume, halbe oder ganze Jahre, um längere, als der Erwartung des Kranken entspricht. Man hat daher die Verpflichtung, dem Kranken diesen Sachverhalt zu eröffnen, ehe er sich endgültig für die Behandlung entschließt. Ich halte es überhaupt für würdiger, aber auch für zweckmäßiger, wenn man ihn, ohne gerade auf seine Abschreckung hinzuarbeiten, doch von vornherein auf die Schwierigkeiten und Opfer der analytischen Therapie aufmerksam macht und ihm so jede Berechtigung nimmt, später einmal zu behaupten, man habe ihn in die Behandlung, deren Umfang und Bedeutung er nicht gekannt habe, gelockt. Wer sich durch solche Mitteilungen abhalten lässt, der hätte sich später doch als unbrauchbar erwiesen. Es ist gut, eine derartige Auslese vor dem Beginn der Behandlung vorzunehmen. Mit dem Fortschritt der Aufklärung unter den Kranken wächst doch die Zahl derjenigen, welche diese erste Probe bestehen.
Ich lehne es ab, die Patienten auf eine gewisse Dauer des Ausharrens in der Behandlung zu verpflichten, gestatte jedem, die Kur abzubrechen, wann es ihm beliebt, verhehle ihm aber nicht, dass ein Abbruch nach kurzer Arbeit keinen Erfolg zurücklassen wird, und ihn leicht wie eine unvollendete Operation in einen unbefriedigenden Zustand versetzen kann. In den ersten Jahren meiner psychoanalytischen Tätigkeit fand ich die größte Schwierigkeit, die Kranken zum Verbleiben zu bewegen; diese Schwierigkeit hat sich längst verschoben, ich muss jetzt ängstlich bemüht sein, sie auch zum Aufhören zu nötigen.
Die Abkürzung der analytischen Kur bleibt ein berechtigter Wunsch, dessen Erfüllung, wie wir hören werden, auf verschiedenen Wegen angestrebt wird. Es steht ihr leider ein sehr bedeutsames Moment entgegen: die Langsamkeit, mit der sich tiefgreifende seelische Veränderungen vollziehen, in letzter Linie wohl die »Zeitlosigkeit« unserer unbewussten Vorgänge. Wenn die Kranken vor die Schwierigkeit des großen Zeitaufwandes für die Analyse gestellt werden, so wissen sie nicht selten ein gewisses Auskunftsmittel vorzuschlagen. Sie teilen ihre Beschwerden in solche ein, die sie als unerträglich, und andere, die sie als nebensächlich beschreiben, und sagen: Wenn Sie mich nur von dem einen (zum Beispiel dem Kopfschmerz, der bestimmten Angst) befreien, mit dem anderen will ich schon selbst im Leben fertig werden. Sie überschätzen dabei aber die elektive Macht der Analyse. Gewiss vermag der analytische Arzt viel, aber er kann nicht genau bestimmen, was er zustande bringen wird. Er leitet einen Prozess ein, den der Auflösung der bestehenden Verdrängungen, er kann ihn überwachen, fördern, Hindernisse aus dem Wege räumen, gewiss auch viel an ihm verderben. Im Ganzen aber geht der einmal eingeleitete Prozess seinen eigenen Weg und lässt sich weder seine Richtung noch die Reihenfolge der Punkte, die er angreift, vorschreiben. Mit der Macht des Analytikers über die Krankheitserscheinungen steht es also ungefähr so wie mit der männlichen Potenz. Der kräftigste Mann kann zwar ein ganzes Kind zeugen, aber nicht im weiblichen Organismus einen Kopf allein, einen Arm oder ein Bein entstehen lassen; er kann nicht einmal über das Geschlecht des Kindes bestimmen. Er leitet eben auch nur einen höchst verwickelten und durch alte Geschehnisse determinierten Prozess ein, der mit der Lösung des Kindes von der Mutter endet. Auch die Neurose eines Menschen besitzt die Charaktere eines Organismus, ihre Teilerscheinungen sind nicht unabhängig voneinander, sie bedingen einander, pflegen sich gegenseitig zu stützen; man leidet immer nur an einer Neurose, nicht an mehreren, die zufällig in einem Individuum zusammengetroffen sind. Der Kranke, den man nach seinem Wunsch von dem einen unerträglichen Symptom befreit hat, könnte leicht die Erfahrung machen, dass nun ein bisher mildes Symptom sich zur Unerträglichkeit steigert. Wer überhaupt den Erfolg von seinen suggestiven (das heißt Übertragungs-) Bedingungen möglichst ablösen will, der tut gut daran, auch auf die Spuren elektiver Beeinflussung des Heilerfolges, die dem Arzte etwa zustehen, zu verzichten. Dem Psychoanalytiker müssen diejenigen Patienten am liebsten sein, welche die volle Gesundheit, soweit sie zu haben ist, von ihm fordern, und ihm so viel Zeit zur Verfügung stellen, als der Prozess der Herstellung verbraucht. Natürlich sind so günstige Bedingungen nur in wenig Fällen zu erwarten.
Der nächste Punkt, über den zu Beginn einer Kur entschieden werden soll, ist das Geld, das Honorar des Arztes. Der Analytiker stellt nicht in Abrede, dass Geld in erster Linie als Mittel zur Selbsterhaltung und Machtgewinnung zu betrachten ist, aber er behauptet, dass mächtige sexuelle Faktoren an der Schätzung des Geldes mitbeteiligt sind. Er kann sich dann darauf berufen, dass Geldangelegenheiten von den Kulturmenschen in ganz ähnlicher Weise behandelt werden wie sexuelle Dinge, mit derselben Zwiespältigkeit, Prüderie und Heuchelei. Er ist also von vornherein entschlossen, dabei nicht mitzutun, sondern Geldbeziehungen mit der nämlichen selbstverständlichen Aufrichtigkeit vor dem Patienten zu behandeln, zu der er ihn in Sachen des Sexuallebens erziehen will. Er beweist ihm, dass er selbst eine falsche Scham abgelegt hat, indem er unaufgefordert mitteilt, wie er seine Zeit einschätzt. Menschliche Klugheit gebietet dann, nicht große Summen zusammenkommen zu lassen, sondern nach kürzeren regelmäßigen Zeiträumen (etwa monatlich) Zahlung zu nehmen. (Man erhöht, wie bekannt, die Schätzung der Behandlung beim Patienten nicht, wenn man sie sehr wohlfeil gibt.) Das ist, wie man weiß, nicht die gewöhnliche Praxis des Nervenarztes oder des Internisten in unserer europäischen Gesellschaft. Aber der Psychoanalytiker darf sich in die Lage des Chirurgen versetzen, der aufrichtig und kostspielig ist, weil er über Behandlungen verfügt, welche helfen können. Ich meine, es ist doch würdiger und ethisch unbedenklicher, sich zu seinen wirklichen Ansprüchen und Bedürfnissen zu bekennen, als, wie es jetzt noch unter Ärzten gebräuchlich ist, den uneigennützigen Menschenfreund zu agieren, dessen Situation einem doch versagt ist, und sich dafür im Stillen über die Rücksichtslosigkeit und die Ausbeutungssucht der Patienten zu grämen oder laut darüber zu schimpfen. Der Analytiker wird für seinen Anspruch auf Bezahlung noch geltend machen, dass er bei schwerer Arbeit nie so viel erwerben kann wie andere medizinische Spezialisten.
Aus denselben Gründen wird er es auch ablehnen dürfen, ohne Honorar zu behandeln, und auch zugunsten der Kollegen oder ihrer Angehörigen keine Ausnahme machen. Die letzte Forderung scheint gegen die ärztliche Kollegialität zu verstoßen; man halte sich aber vor, dass eine Gratisbehandlung für den Psychoanalytiker weit mehr bedeutet als für jeden anderen, nämlich die Entziehung eines ansehnlichen Bruchteiles seiner für den Erwerb verfügbaren Arbeitszeit (eines Achtels, Siebentels u. dgl.) auf die Dauer von vielen Monaten. Eine gleichzeitige zweite Gratisbehandlung raubt ihm bereits ein Viertel oder Drittel seiner Erwerbsfähigkeit, was der Wirkung eines schweren traumatischen Unfalles gleichzusetzen wäre.
Es fragt sich dann, ob der Vorteil für den Kranken das Opfer des Arztes einigermaßen aufwiegt. Ich darf mir wohl ein Urteil darüber zutrauen, denn ich habe durch etwa zehn Jahre täglich eine Stunde, zeitweise auch zwei, Gratisbehandlungen gewidmet, weil ich zum Zwecke der Orientierung in der Neurose möglichst widerstandsfrei arbeiten wollte. Ich fand dabei die Vorteile nicht, die ich suchte. Manche der Widerstände des Neurotikers werden durch die Gratisbehandlung enorm gesteigert, so beim jungen Weib die Versuchung, die in der Übertragungsbeziehung enthalten ist, beim jungen Mann das aus dem Vaterkomplex stammende Sträuben gegen die Verpflichtung der Dankbarkeit, das zu den widrigsten Erschwerungen der ärztlichen Hilfeleistung gehört. Der Wegfall der Regulierung, die doch durch die Bezahlung an den Arzt gegeben ist, macht sich sehr peinlich fühlbar; das ganze Verhältnis rückt aus der realen Welt heraus; ein gutes Motiv, die Beendigung der Kur anzustreben, wird dem Patienten entzogen.
Man kann der asketischen Verdammung des Geldes ganz fern stehen und darf es doch bedauern, dass die analytische Therapie aus äußeren wie aus inneren Gründen den Armen fast unzugänglich ist. Es ist wenig dagegen zu tun. Vielleicht hat die viel verbreitete Behauptung recht, dass der weniger leicht der Neurose verfällt, wer durch die Not des Lebens zu harter Arbeit gezwungen ist. Aber ganz unbestreitbar steht die andere Erfahrung da, dass der Arme, der einmal eine Neurose zustande gebracht hat, sich dieselbe nur sehr schwer entreißen lässt. Sie leistet ihm zu gute Dienste im Kampf um die Selbstbehauptung; der sekundäre Krankheitsgewinn, den sie ihm bringt, ist allzu bedeutend. Das Erbarmen, das die Menschen seiner materiellen Not versagt haben, beansprucht er jetzt unter dem Titel seiner Neurose und kann sich von der Forderung, seine Armut durch Arbeit zu bekämpfen, selbst freisprechen. Wer die Neurose eines Armen mit den Mitteln der Psychotherapie angreift, macht also in der Regel die Erfahrung, dass in diesem Fall eigentlich eine Aktualtherapie ganz anderer Art von ihm gefordert wird, eine Therapie, wie sie nach der bei uns heimischen Sage Kaiser Josef II. zu üben pflegte. Natürlich findet man doch gelegentlich wertvolle und ohne ihre Schuld hilflose Menschen, bei denen die unentgeltliche Behandlung nicht auf die angeführten Hindernisse stößt und schöne Erfolge erzielt.
Für den Mittelstand ist der für die Psychoanalyse benötigte Geldaufwand nur scheinbar ein übermäßiger. Ganz abgesehen davon, dass Gesundheit und Leistungsfähigkeit einerseits, ein mäßiger Geldaufwand anderseits überhaupt inkommensurabel sind: Wenn man die nie aufhörenden Ausgaben für Sanatorien und ärztliche Behandlung zusammenrechnet und ihnen die Steigerung der Leistungs- und Erwerbsfähigkeit nach glücklich beendeter analytischer Kur gegenüberstellt, darf man sagen, dass die Kranken einen guten Handel gemacht haben. Es ist nichts Kostspieligeres im Leben als die Krankheit und – die Dummheit.
Ehe ich diese Bemerkungen zur Einleitung der analytischen Behandlung beschließe, noch ein Wort über ein gewisses Zeremoniell der Situation, in welcher die Kur ausgeführt wird. Ich halte an dem Rat fest, den Kranken auf einem Ruhebett lagern zu lassen, während man hinter ihm, von ihm ungesehen, Platz nimmt. Diese Veranstaltung hat einen historischen Sinn, sie ist der Rest der hypnotischen Behandlung, aus welcher sich die Psychoanalyse entwickelt hat. Sie verdient aber aus mehrfachen Gründen festgehalten zu werden. Zunächst wegen eines persönlichen Motivs, das aber andere mit mir teilen mögen. Ich vertrage es nicht, acht Stunden täglich (oder länger) von anderen angestarrt zu werden. Da ich mich während des Zuhörens selbst dem Ablauf meiner unbewussten Gedanken überlasse, will ich nicht, dass meine Mienen dem Patienten Stoff zu Deutungen geben oder ihn in seinen Mitteilungen beeinflussen. Der Patient fasst die ihm aufgezwungene Situation gewöhnlich als Entbehrung auf und sträubt sich gegen sie, besonders wenn der Schautrieb (das Voyeurtum) in seiner Neurose eine bedeutende Rolle spielt. Ich beharre aber auf dieser Maßregel, welche die Absicht und den Erfolg hat, die unmerkliche Vermengung der Übertragung mit den Einfällen des Patienten zu verhüten, die Übertragung zu isolieren und sie zur Zeit als Widerstand scharf umschrieben hervortreten zu lassen. Ich weiß, dass viele Analytiker es anders machen, aber ich weiß nicht, ob die Sucht, es anders zu machen, oder ob ein Vorteil, den sie dabei gefunden haben, mehr Anteil an ihrer Abweichung hat.
Wenn nun die Bedingungen der Kur in solcher Weise geregelt sind, erhebt sich die Frage: An welchem Punkt und mit welchem Material soll man die Behandlung beginnen?
Es ist im Ganzen gleichgültig, mit welchem Stoff man die Behandlung beginnt, ob mit der Lebensgeschichte, der Krankengeschichte oder den Kindheitserinnerungen des Patienten. Jedenfalls aber so, dass man den Patienten erzählen lässt und ihm die Wahl des Anfangspunktes freistellt. Man sagt ihm also: Ehe ich Ihnen etwas sagen kann, muss ich viel über Sie erfahren haben; bitte teilen Sie mir mit, was Sie von sich wissen.
Nur für die Grundregel der psychoanalytischen Technik, die der Patient zu beobachten hat, macht man eine Ausnahme. Mit dieser macht man ihn von allem Anfang an bekannt: Noch eines, ehe Sie beginnen. Ihre Erzählung soll sich doch in einem Punkt von einer gewöhnlichen Konversation unterscheiden. Während Sie sonst mit Recht versuchen, in Ihrer Darstellung den Faden des Zusammenhanges festzuhalten und alle störenden Einfälle und Nebengedanken abweisen, um nicht, wie man sagt, aus dem Hundertsten ins Tausendste zu kommen, sollen Sie hier anders vorgehen. Sie werden beobachten, dass Ihnen während Ihrer Erzählung verschiedene Gedanken kommen, welche Sie mit gewissen kritischen Einwendungen zurückweisen möchten. Sie werden versucht sein, sich zu sagen: Dies oder jenes gehört nicht hierher, oder es ist ganz unwichtig, oder es ist unsinnig, man braucht es darum nicht zu sagen. Geben Sie dieser Kritik niemals nach und sagen Sie es trotzdem, ja gerade darum, weil Sie eine Abneigung dagegen verspüren. Den Grund für diese Vorschrift — eigentlich die einzige, die Sie befolgen sollen — werden Sie später erfahren und einsehen lernen. Sagen Sie also alles, was Ihnen durch den Sinn geht. Benehmen Sie sich so, wie zum Beispiel ein Reisender, der am Fensterplatz des Eisenbahnwagens sitzt und dem im Inneren Untergebrachten beschreibt, wie sich vor seinen Blicken die Aussicht verändert. Endlich vergessen Sie nie, dass Sie volle Aufrichtigkeit versprochen haben, und gehen Sie nie über etwas hinweg, weil Ihnen dessen Mitteilung aus irgendeinem Grunde unangenehm ist.3 Patienten, die ihr Kranksein von einem bestimmten Moment an rechnen, stellen sich gewöhnlich auf die Krankheitsveranlassung ein; andere, die den Zusammenhang ihrer Neurose mit ihrer Kindheit selbst nicht verkennen, beginnen oft mit der Darstellung ihrer ganzen Lebensgeschichte. Eine systematische Erzählung erwarte man auf keinen Fall und tue nichts dazu, sie zu fördern. Jedes Stückchen der Geschichte wird später von Neuem erzählt werden müssen, und erst bei diesen Wiederholungen werden die Zusätze erscheinen, welche die wichtigen, dem Kranken unbekannten Zusammenhänge vermitteln.
Es gibt Patienten, die sich von den ersten Stunden an sorgfältig auf ihre Erzählung vorbereiten, angeblich um so die bessere Ausnützung der Behandlungszeit zu sichern. Was sich so als Eifer drapiert, ist Widerstand. Man widerrate solche Vorbereitung, die nur zum Schutz gegen das Auftauchen unerwünschter Einfälle geübt wird.4 Mag der Kranke noch so aufrichtig an seine löbliche Absicht glauben, der Widerstand wird seinen Anteil an der absichtlichen Vorbereitungsart fordern und es durchsetzen, dass das wertvollste Material der Mitteilung entschlüpft. Man wird bald merken, dass der Patient noch andere Methoden erfindet, um der Behandlung das Verlangte zu entziehen. Er wird sich etwa täglich mit einem intimen Freund über die Kur besprechen und in dieser Unterhaltung alle die Gedanken unterbringen, die sich ihm im Beisein des Arztes aufdrängen sollten. Die Kur hat dann ein Leck, durch das gerade das Beste verrinnt. Es wird dann bald an der Zeit sein, dem Patienten anzuraten, dass er seine analytische Kur als eine Angelegenheit zwischen seinem Arzt und ihm selbst behandle und alle anderen Personen, mögen sie noch so nahestehend oder noch so neugierig sein, von der Mitwisserschaft ausschließe. In späteren Stadien der Behandlung ist der Patient in der Regel solchen Versuchungen nicht unterworfen.
Kranken, die ihre Behandlung geheim halten wollen, oft darum, weil sie auch ihre Neurose geheim gehalten haben, lege ich keine Schwierigkeiten in den Weg. Es kommt natürlich nicht in Betracht, wenn infolge dieser Reservation einige der schönsten Heilerfolge ihre Wirkung auf die Mitwelt verfehlen. Die Entscheidung der Patienten für das Geheimnis bringt selbstverständlich bereits einen Zug ihrer Geheimgeschichte ans Licht.
Wenn man den Kranken einschärft, zu Beginn ihrer Behandlung möglichst wenig Personen zu Mitwissern zu machen, so schützt man sie dadurch auch einigermaßen vor den vielen feindseligen Einflüssen, die es versuchen werden, sie der Analyse abspenstig zu machen. Solche Beeinflussungen können zu Anfang der Kur verderblich werden. Späterhin sind sie meist gleichgültig oder selbst nützlich, um Widerstände, die sich verbergen wollen, zum Vorscheine zu bringen.
Bedarf der Patient während der analytischen Behandlung vorübergehend einer anderen, internen oder spezialistischen Therapie, so ist es weit zweckmäßiger, einen nicht analytischen Kollegen in Anspruch zu nehmen, als diese andere Hilfeleistung selbst zu besorgen. Kombinierte Behandlungen wegen neurotischer Leiden mit starker organischer Anlehnung sind meist undurchführbar. Die Patienten lenken ihr Interesse von der Analyse ab, sowie man ihnen mehr als einen Weg zeigt, der zur Heilung führen soll. Am besten schiebt man die organische Behandlung bis nach Abschluss der psychischen auf; würde man die erstere voranschicken, so bliebe sie in den meisten Fällen erfolglos.
Kehren wir zur Einleitung der Behandlung zurück. Man wird gelegentlich Patienten begegnen, die ihre Kur mit der ablehnenden Versicherung beginnen, dass ihnen nichts einfalle, was sie erzählen könnten, obwohl das ganze Gebiet der Lebens- und Krankheitsgeschichte unberührt vor ihnen liegt. Auf die Bitte, ihnen doch anzugeben, wovon sie sprechen sollen, gehe man nicht ein, dieses erste Mal so wenig wie spätere Male. Man halte sich vor, womit man es in solchen Fällen zu tun hat. Ein starker Widerstand ist da in die Front gerückt, um die Neurose zu verteidigen; man nehme die Herausforderung sofort an und rücke ihm an den Leib. Die energisch wiederholte Versicherung, dass es solches Ausbleiben aller Einfälle zu Anfang nicht gibt, und dass es sich um einen Widerstand gegen die Analyse handle, nötigt den Patienten bald zu den vermuteten Geständnissen oder deckt ein erstes Stück seiner Komplexe auf. Es ist böse, wenn er gestehen muss, dass er sich während des Anhörens der Grundregel die Reservation geschaffen hat, dies oder jenes werde er doch für sich behalten. Minder arg, wenn er nur mitzuteilen braucht, welches Misstrauen er der Analyse entgegenbringt, oder was für abschreckende Dinge er über sie gehört habe. Stellt er diese und ähnliche Möglichkeiten, die man ihm vorhält, in Abrede, so kann man ihn durch Drängen zum Eingeständnis nötigen, dass er doch gewisse Gedanken, die ihn beschäftigen, vernachlässigt hat. Er hat an die Kur selbst gedacht, aber an nichts Bestimmtes, oder das Bild des Zimmers, in dem er sich befindet, hat ihn beschäftigt, oder er muss an die Gegenstände im Behandlungsraum denken, und dass er hier auf einem Diwan liegt, was er alles durch die Auskunft »Nichts« ersetzt hat. Diese Andeutungen sind wohl verständlich; alles, was an die gegenwärtige Situation anknüpft, entspricht einer Übertragung auf den Arzt, die sich zu einem Widerstand geeignet erweist. Man ist so genötigt, mit der Aufdeckung dieser Übertragung zu beginnen; von ihr aus findet sich rasch der Weg zum Eingang in das pathogene Material des Kranken. Frauen, die nach dem Inhalt ihrer Lebensgeschichte auf eine sexuelle Aggression vorbereitet sind, Männer mit überstarker verdrängter Homosexualität werden am ehesten der Analyse eine solche Verweigerung der Einfalle vorausschicken.
Wie der erste Widerstand, so können auch die ersten Symptome oder Zufallshandlungen der Patienten ein besonderes Interesse beanspruchen und einen ihre Neurose beherrschenden Komplex verraten. Ein geistreicher junger Philosoph, mit exquisiten ästhetischen Einstellungen, beeilt sich, den Hosenstreif zurechtzuzupfen, ehe er sich zur ersten Behandlung niederlegt; er erweist sich als dereinstiger Koprophile von höchstem Raffinement, wie es für den späteren Ästheten zu erwarten stand. Ein junges Mädchen zieht in der gleichen Situation hastig den Saum ihres Rockes über den vorschauenden Knöchel; sie hat damit das Beste verraten, was die spätere Analyse aufdecken wird, ihren narzisstischen Stolz auf ihre Körperschönheit und ihre Exhibitionsneigungen.
Besonders viele Patienten sträuben sich gegen die ihnen vorgeschlagene Lagerung, während der Arzt ungesehen hinter ihnen sitzt, und bitten um die Erlaubnis, die Behandlung in anderer Position durchzumachen, zumeist, weil sie den Anblick des Arztes nicht entbehren wollen. Es wird ihnen regelmäßig verweigert; man kann sie aber nicht daran hindern, dass sie sich’s einrichten, einige Sätze vor Beginn der »Sitzung« zu sprechen oder nach der angekündigten Beendigung derselben, wenn sie sich vom Lager erhoben haben. Sie teilen sich so die Behandlung in einen offiziellen Abschnitt, während dessen sie sich meist sehr gehemmt benehmen, und in einen »gemütlichen«, in dem sie wirklich frei sprechen und allerlei mitteilen, was sie selbst nicht zur Behandlung rechnen. Der Arzt lässt sich diese Scheidung nicht lange gefallen, er merkt auf das vor oder nach der Sitzung Gesprochene, und indem er es bei nächster Gelegenheit verwertet, reißt er die Scheidewand nieder, die der Patient aufrichten wollte. Dieselbe wird wiederum aus dem Material eines Übertragungswiderstandes gezimmert sein.
Solange nun die Mitteilungen und Einfälle des Patienten ohne Stockung erfolgen, lasse man das Thema der Übertragung unberührt. Man warte mit dieser heikelsten aller Prozeduren, bis die Übertragung zum Widerstand geworden ist.
Die nächste Frage, vor die wir uns gestellt finden, ist eine prinzipielle. Sie lautet: Wann sollen wir mit den Mitteilungen an den Analysierten beginnen? Wann ist es Zeit, ihm die geheime Bedeutung seiner Einfälle zu enthüllen, ihn in die Voraussetzungen und technischen Prozeduren der Analyse einzuweihen?
Die Antwort hierauf kann nur lauten: Nicht eher, als bis sich eine leistungsfähige Übertragung, ein ordentlicher Rapport, bei dem Patienten hergestellt hat. Das erste Ziel der Behandlung bleibt, ihn an die Kur und an die Person des Arztes zu attachieren. Man braucht nichts anderes dazu zu tun, als ihm Zeit zu lassen. Wenn man ihm ernstes Interesse bezeugt, die anfangs auftauchenden Widerstände sorgfältig beseitigt und gewisse Missgriffe vermeidet, stellt der Patient ein solches Attachement von selbst her und reiht den Arzt an eine der Imagines jener Personen an, von denen er Liebes zu empfangen gewohnt war. Man kann sich diesen ersten Erfolg allerdings verscherzen, wenn man von Anfang an einen anderen Standpunkt einnimmt als den der Einfühlung, etwa einen moralisierenden, oder wenn man sich als Vertreter oder Mandatar einer Partei gebärdet, des anderen Eheteiles etwa usw.
Diese Antwort schließt natürlich die Verurteilung eines Verfahrens ein, welches dem Patienten die Übersetzungen seiner Symptome mitteilen wollte, sobald man sie selbst erraten hat, oder gar einen besonderen Triumph darin erblicken würde, ihm diese »Lösungen« in der ersten Zusammenkunft ins Gesicht zu schleudern. Es wird einem geübteren Analytiker nicht schwer, die verhaltenen Wünsche eines Kranken schon aus seinen Klagen und seinem Krankenbericht deutlich vernehmbar herauszuhören; aber welches Maß von Selbstgefälligkeit und von Unbesonnenheit gehört dazu, um einem Fremden, mit allen analytischen Voraussetzungen Unvertrauten, nach der kürzesten Bekanntschaft zu eröffnen, er hänge inzestuös an seiner Mutter, er hege Todeswünsche gegen seine angeblich geliebte Frau, er trage sich mit der Absicht, seinen Chef zu betrügen u. dgl.! Ich habe gehört, dass es Analytiker gibt, die sich mit solchen Augenblicksdiagnosen und Schnellbehandlungen brüsten, aber ich warne jedermann davor, solchen Beispielen zu folgen. Man wird dadurch sich und seine Sache um jeden Kredit bringen und die heftigsten Widersprüche hervorrufen, ob man nun richtig geraten hat oder nicht, ja eigentlich umso heftigeren Widerstand, je eher man richtig geraten hat. Der therapeutische Effekt wird in der Regel zunächst gleich Null sein, die Abschreckung von der Analyse aber eine endgültige. Noch in späteren Stadien der Behandlung wird man Vorsicht üben müssen, um eine Symptomlösung und Wunsch-Übersetzung nicht eher mitzuteilen, als bis der Patient knapp davor steht, so dass er nur noch einen kurzen Schritt zu machen hat, um sich dieser Lösung selbst zu bemächtigen. In früheren Jahren hatte ich häufig Gelegenheit zu erfahren, dass die vorzeitige Mitteilung einer Lösung der Kur ein vorzeitiges Ende bereitete, sowohl infolge der Widerstände, die so plötzlich geweckt wurden, als auch aufgrund der Erleichterung, die mit der Lösung gegeben war.
Man wird hier die Einwendung machen: Ist es denn unsere Aufgabe, die Behandlung zu verlängern, und nicht vielmehr, sie so rasch wie möglich zu Ende zu führen? Leidet der Kranke nicht infolge seines Nichtwissens und Nichtverstehens und ist es nicht Pflicht, ihn so bald als möglich wissend zu machen, also sobald der Arzt selbst wissend geworden ist?
Die Beantwortung dieser Frage fordert zu einem kleinen Exkurs auf, über die Bedeutung des Wissens und über den Mechanismus der Heilung in der Psychoanalyse.
In den frühesten Zeiten der analytischen Technik haben wir allerdings in intellektualistischer Denkeinstellung das Wissen des Kranken um das von ihm Vergessene hoch eingeschätzt und dabei kaum zwischen unserem Wissen und dem seinigen unterschieden. Wir hielten es für einen besonderen Glücksfall, wenn es gelang, Kunde von dem vergessenen Kindheitstrauma von anderer Seite her zu bekommen, zum Beispiel von Eltern, Pflegepersonen oder dem Verführer selbst, wie es in einzelnen Fällen möglich wurde, und beeilten uns, dem Kranken die Nachricht und die Beweise für ihre Richtigkeit zur Kenntnis zu bringen in der sicheren Erwartung, so Neurose und Behandlung zu einem schnellen Ende zu führen. Es war eine schwere Enttäuschung, als der erwartete Erfolg ausblieb. Wie konnte es nur zugehen, dass der Kranke, der jetzt von seinem traumatischen Erlebnis wusste, sich doch benahm, als wisse er nicht mehr davon als früher? Nicht einmal die Erinnerung an das verdrängte Trauma wollte infolge der Mitteilung und Beschreibung desselben auftauchen.
In einem bestimmten Fall hatte mir die Mutter eines hysterischen Mädchens das homosexuelle Erlebnis verraten, dem auf die Fixierung der Anfälle des Mädchens ein großer Einfluss zukam. Die Mutter hatte die Szene selbst überrascht, die Kranke aber dieselbe völlig vergessen, obwohl sie bereits den Jahren der Vorpubertät angehörte. Ich konnte nun eine lehrreiche Erfahrung machen. Jedes Mal, wenn ich die Erzählung der Mutter vor dem Mädchen wiederholte, reagierte dieses mit einem hysterischen Anfall, und nach diesem war die Mitteilung wieder vergessen. Es war kein Zweifel, dass die Kranke den heftigsten Widerstand gegen ein ihr aufgedrängtes Wissen äußerte; sie simulierte endlich Schwachsinn und vollen Gedächtnisverlust, um sich gegen meine Mitteilungen zu schützen. So musste man sich denn entschließen, dem Wissen an sich die ihm vorgeschriebene Bedeutung zu entziehen und den Akzent auf die Widerstände zu legen, welche das Nichtwissen seinerzeit verursacht hatten und jetzt noch bereit waren, es zu verteidigen. Das bewusste Wissen aber war gegen diese Widerstände, auch wenn es nicht wieder ausgestoßen wurde, ohnmächtig.
Das befremdende Verhalten der Kranken, die ein bewusstes Wissen mit dem Nichtwissen zu vereinigen verstehen, bleibt für die sogenannte Normalpsychologie unerklärlich. Der Psychoanalyse bereitet es aufgrund ihrer Anerkennung des Unbewussten keine Schwierigkeit; das beschriebene Phänomen gehört aber zu den besten Stützen einer Auffassung, welche sich die seelischen Vorgänge topisch differenziert näher bringt. Die Kranken wissen nun von dem verdrängten Erlebnis in ihrem Denken, aber diesem fehlt die Verbindung mit jener Stelle, an welcher die verdrängte Erinnerung in irgendeiner Art enthalten ist. Eine Veränderung kann erst eintreten, wenn der bewusste Denkprozess bis zu dieser Stelle vorgedrungen ist und dort die Verdrängungswiderstände überwunden hat. Es ist gerade so, als ob im Justizministerium ein Erlass verlautbart worden wäre, dass man jugendliche Vergehen in einer gewissen milden Weise richten solle. Solange dieser Erlass nicht zur Kenntnis der einzelnen Bezirksgerichte gelangt ist, oder für den Fall, dass die Bezirksrichter nicht die Absicht haben, diesen Erlass zu befolgen, vielmehr auf eigene Hand judizieren, kann an der Behandlung der einzelnen jugendlichen Delinquenten nichts geändert sein. Fügen wir noch zur Korrektur hinzu, dass die bewusste Mitteilung des Verdrängten an den Kranken doch nicht wirkungslos bleibt. Sie wird nicht die gewünschte Wirkung äußern, den Symptomen ein Ende zu machen, sondern andere Folgen haben. Sie wird zunächst Widerstände, dann aber, wenn deren Überwindung erfolgt ist, einen Denkprozess anregen, in dessen Ablauf sich endlich die erwartete Beeinflussung der unbewussten Erinnerung herstellt.
Es ist jetzt an der Zeit, eine Übersicht des Kräftespieles zu gewinnen, welches wir durch die Behandlung in Gang bringen. Der nächste Motor der Therapie ist das Leiden des Patienten und sein daraus entspringender Heilungswunsch. Von der Größe dieser Triebkraft zieht sich mancherlei ab, was erst im Laufe der Analyse aufgedeckt wird, vor allem der sekundäre Krankheitsgewinn, aber die Triebkraft selbst muss bis zum Ende der Behandlung erhalten bleiben; jede Besserung ruft eine Verringerung derselben hervor. Für sich allein ist sie aber unfähig, die Krankheit zu beseitigen; es fehlt ihr zweierlei dazu: Sie kennt die Wege nicht, die zu diesem Ende einzuschlagen sind, und sie bringt die notwendigen Energiebeträge gegen die Widerstände nicht auf. Beiden Mängeln hilft die analytische Behandlung ab. Die zur Überwindung der Widerstände erforderten Affektgrößen stellt sie durch die Mobilmachung der Energien bei, welche für die Übertragung bereit liegen; durch die rechtzeitigen Mitteilungen zeigt sie dem Kranken die Wege, auf welche er diese Energien leiten soll. Die Übertragung kann häufig genug die Leidens-Symptome allein beseitigen, aber dann nur vorübergehend, solange sie eben selbst Bestand hat. Das ist dann eine Suggestivbehandlung, keine Psychoanalyse. Den letzteren Namen verdient die Behandlung nur dann, wenn die Übertragung ihre Intensität zur Überwindung der Widerstände verwendet hat. Dann allein ist das Kranksein unmöglich geworden, auch wenn die Übertragung wieder aufgelöst worden ist, wie ihre Bestimmung es verlangt.
Im Laufe der Behandlung wird noch ein anderes förderndes Moment wachgerufen, das intellektuelle Interesse und Verständnis des Kranken. Allein dies kommt gegen die anderen miteinander ringenden Kräfte kaum in Betracht; es droht ihm beständig die Entwertung infolge der Urteilstrübung, welche von den Widerständen ausgeht. Somit erübrigen Übertragung und Unterweisung (durch Mitteilung) als die neuen Kraftquellen, welche der Kranke dem Analytiker verdankt. Der Unterweisung bedient er sich aber nur, insofern er durch die Übertragung dazu bewogen wird, und darum soll die erste Mitteilung abwarten, bis sich eine starke Übertragung hergestellt hat, und fügen wir hinzu, jede spätere, bis die Störung der Übertragung durch die der Reihe nach auftauchenden Übertragungswiderstände beseitigt ist.