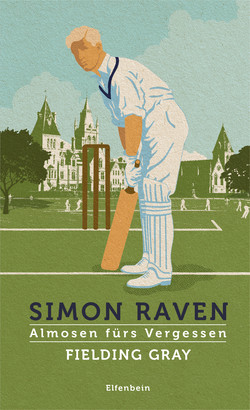Читать книгу Fielding Gray - Simon Raven - Страница 7
ОглавлениеEins nach dem Anderen. Wie hat das alles angefangen? Ich habe Christopher schon beschrieben. Man stelle sich ihn nun an einem Winternachmittag vor, wie er von den Fives-Spielfeldern heimrennt: erhitzte Wangen, die Strümpfe bis zu den Knöcheln runtergerutscht, dreckstarrende Sportschuhe, in einer (wegen der Kleiderrationierung) deutlich zu klein gewordenen Hose. Es ist fast Zeit fürs Abendbrot, und es wird gerade dunkel. Ich komme aus der anderen Richtung schwerfällig in Gummistiefeln dahergestapft, nachdem ich den Nachmittag mit öder Gartenarbeit verbracht habe (um meinen Teil zu den Kriegsbemühungen beizutragen). Unsere Wege treffen sich da, wo wir beide zu unserem Haus abbiegen müssen. Christopher winkt, lächelt, rennt schon mal voran, und ich stehe einfach bloß da und spüre Gott weiß welche Sehnsüchte in mir aufwallen. Es war aber keine Wollust – das schwöre ich. Ich hatte eine Vision gehabt: Nach drei Stunden zermürbend eintönigen Tuns in der Gesellschaft von lauter tumben und streitsüchtigen Jungs hatte ich jemand Anmutigen, Freundlichen und Heiteren gesehen, jemanden, der mir zudem sogar ein wenig von seiner Anmut herübergewinkt, einen Teil seiner Heiterkeit zu mir herübergelächelt hatte, als er mir im Abendlicht begeg-nete.
Und so hat es alles begonnen, im Dezember 1944, ungefähr fünf Monate vor dem Tag, an dem der Gedenkgottesdienst stattfand. Und in der Zwischenzeit? Nach außen hin waren wir bloß gute Freunde, habe ich damals notiert, die auf dem Sportplatz herumrannten und miteinander schwatzten, eigentlich wie eh und je, seit wir uns ein paar Jahre zuvor als neue Schüler an der Schule erstmals begegnet waren. Doch innerlich war da jetzt, zumindest was mich betraf, das starke Bedürfnis, ihn zu beschützen und zu umhegen, ihn zu streicheln (aber nur als Tröster) und (brüderlich) in den Arm zu nehmen. Dieses Lächeln hatte meine Seele berührt. Aber wie sollte ich Christopher das sagen? Und was würde er antworten?
Das Ganze wurde noch dadurch erschwert, dass Christopher nicht gerade viel Grips hatte. Damit will ich nicht sagen, dass er dumm war; die alltäglichen Dinge waren kein Problem für ihn, doch war er ein Junge von durch und durch konventioneller Denkart und nicht empfänglich für neue Gedankenwelten oder Bücher. Ihn in eine Exegese platonischer Liebe (denn das war es ganz sicherlich), ihre Geschichte und ihre Implikationen zu verwickeln war daher ausgeschlossen. Er hätte mich für geistesgestört gehalten. Auf der anderen Seite barg die Tatsache, dass er so konventionell war, eine leise Hoffnung; denn die Konventionen an unserer Schule schlossen – als beständiges, wenn auch kaum als begrüßenswert anzusehendes Phänomen des schulischen Lebens – den Gedanken mit ein, dass ein Junge in einen anderen, normalerweise einen jüngeren, »verschossen« sein konnte. Mit irgendeiner Vorstellung dieser Art war Christopher zweifellos vertraut. Zugleich war die Idee, »verschossen« zu sein, aber auf eine Weise mit kleinlichem Schuldempfinden und allerlei albernen Blödeleien verbunden, dass ich dies keinesfalls zum Ausgangspunkt meines weiteren Vorgehens machen wollte. »Christopher, ich bin in dich verschossen.« Nein, auf keinen Fall, nein. Was auch immer ich für Christopher empfand, platonische Liebe oder romantische Liebe, Agape, Eros oder Caritas, es war viel zu ernst, um von Redensarten, wie sie Dreizehnjährige benutzten, entehrt zu werden.
Aber am Ende war alles viel leichter, als ich es für möglich gehalten hätte. Denn in Wahrheit war es so, dass Christopher auf eine Weise sensibel (wenn nicht sogar intelligent) war, die ich unterschätzt hatte; und am Abend nach dem Gedenkgottesdienst, nach fünf Monaten bloßen Herumüberlegens meinerseits, ergriff er einfach selbst die Initiative.
Entgegen der Strenge seiner Moralpredigt hatte unser Schulrektor ein mildes Zugeständnis anlässlich des zu feiernden Sieges verkündet. Nach dem Adsum um sieben Uhr würde die sonntägliche Studierzeit entfallen und jedes Haus durfte stattdessen eine eigene Feier durchführen, in der Form, die der jeweilige Hausvorstand für angemessen hielt. In unserem Haus, das der Rektor selbst leitete, wurde ein schicklicher Gesangsabend anberaumt. Ich werde nie wissen, wie genau es dazu kam, aber ab einem bestimmten Punkt entwickelte diese unschuldige Veranstaltung eine groteske, eine luperkalische Freizügigkeit. Hatten wir eben noch alle »The Lincolnshire Poacher« gesungen, spielte das Grammofon des Präfekten im nächsten Augenblick – in meiner Erinnerung gibt es kein Dazwischen – schon »Jealousy«, und die älteren Schüler des Hauses schlurften mit den jüngeren paarweise vereint in einem schwitzigen Tango umher. Selbst Peter Morrison vollführte, den ihm als Diener zugeordneten Jungen umklammernd, elefantöse Schritte über den Boden des Speisesaals. Ich selbst tanzte mit einem kecken und hübschen kleinen neuen Schüler, der seine Hüften schwang, als würde sein Leben davon abhängen – als sich eine Hand auf dessen Schulter legte, ein schroffes »Entschuldige mal« ertönte und Christopher seinen Platz eingenommen hatte.
»Was ist bloß mit allen hier los?«, sagte ich.
»Ich weiß nicht, aber es ist schon in Ordnung. Das ist, weil der Krieg zu Ende ist. Dieses eine Mal ist das schon in Ordnung.«
Auch wenn er mir nicht allzu nahe kam, umfasste er doch meine Hand und meine Schulter sehr fest.
»Ist es in Ordnung für dich, das Mädchen zu sein?«, sagte ich dämlich.
Er ignorierte das.
»Dir fallen ja die Haare in die Augen«, sagte er.
Er ließ meine Hand los und bewegte seine zu meiner Stirn hin.
»Kupferbraun«, sagte er auf sonderbare Weise. »So nennt man das, oder? Kupferbraun.«
Die Musik stoppte, und rasch zog er seine Hand zurück. Jemand legte »The Girl in the Alice Blue Gown« auf, wozu wir nun sittsam Walzer zu tanzen begannen. Christopher war ein guter Tänzer, er tanzte mit Leichtigkeit und Hingabe und folgte so mühelos, wie er wohl auch geführt hätte. Doch die Plattenauswahl war schlecht und zerstreute den satyrischen Geist, der kurz auf uns niedergekommen war. Peter Morrison entließ seinen jugendlichen Helfer, hielt die Musik an und klopfte an die Holzvertäfelung, um für Ruhe zu sorgen.
»Aufräumen und fertig machen fürs Gebet!«, rief er und setzte dem Vorkommnis so für immer ein Ende. »Und zwar zack-zack. Der Rektor wird in zehn Minuten durchgehen.« Das war es dann also, dachte ich. »Dieses eine Mal ist das schon in Ordnung … Dir fallen ja die Haare … Kupferbraun.« Und vorbei war die Musik.
Aber spät an diesem Abend, als Christopher und ich zum Schlafen nach oben gingen, fühlte ich, wie sein Handrücken an meinem entlangstreifte und seine Finger sich dann um meine wanden. Gemeinsam liefen wir die lange Reihe der durch Holzwände abgeteilten Schlafplätze entlang, bis wir an seinem ankamen. Es war ziemlich dunkel. Alle anderen schliefen, oder sollten schlafen, denn dies war der Schlafsaal der Unterstufenschüler, für den wir beide zuständig waren, und die hier Schlafenden waren bereits vor zwei Stunden ins Bett geschickt worden. Jedenfalls würde, wenn wir leise wären, niemand mitbekommen, dass wir beide in Christophers Schlafkammer gegangen wären; niemand würde uns stören. Die Dunkelheit gehörte uns allein, und wir wussten das, und in diesem Wissen hielten wir uns umso fester an der Hand – und sagten Gute Nacht.
Für Christopher kann ich nicht sprechen. In meinem Fall war es Furcht, die mich damals dazu brachte, ihn zu verlassen. Ich wollte nur bei ihm sein und ihn halten; doch konnte dies vielleicht zu weiteren Sehnsüchten führen, möglicherweise auch bei ihm, und von diesen, so dachte ich, könnte er vielleicht am Ende abgestoßen sein und zurückscheuen. An diesem Abend, vor seiner Schlafkammer, liebte ich ihn so sehr, dass mir bei dem Gedanken, Ärger oder Missfallen bei ihm zu erregen, ganz schlecht wurde vor Entsetzen. Was wollte er? Es ließ sich ihm nicht anmerken, ich konnte es nicht sagen, ich durfte es nicht darauf ankommen lassen; also ließ ich seine Hand los und schlich davon, mein furchtsames Herz verfluchend, in mein einsames Schulbett.
Anfang Juni knackte ich bei einem Heimspiel die Hundert gegen Eton, ein Triumph, der umso süßer war, als Christopher mir als Schlagmann die meiste Zeit gegenübergestanden und selbst sehr ansehnliche 47 erzielt hatte. Das Ereignis wurde jedoch dadurch getrübt, dass meine Eltern anwesend waren. Als ich aus dem Spiel raus war, zog ich mir meinen blauen Blazer der ersten Cricket-Elf über und ging zu ihnen. Und kaum hatte ich mich hingesetzt, legte mein Vater schon los. Keine Glückwünsche zu meinem Century, nur ätzende und verdrießliche Übellaunigkeit von dem Augenblick an, als er mich sah. Da ich sonst meine Zeit mit Christopher hätte verbringen können, war das sehr schwer zu ertragen.
»So viel Blau«, sagte mein Vater, als er meinen Blazer in Augenschein nahm und die Kosten wohl bis auf den letzten Penny abschätzte, »man könnte denken, du spielst im Varsity-Endspiel im Lord’s.«
»Und das könnte direkt so kommen«, sagte meine Mutter, »wenn er so weitermacht.« Sie hielt inne und zuckte kurz. »Du hast nie ein Century geholt«, sagte sie. »Du hast noch nicht mal für die Schul-Elf gespielt.«
»Das war zu meinen Zeiten auch noch sehr viel schwerer«, sagte mein Vater in einer Mischung aus Quengelei und Niedertracht. »Damals hat man in der Elf gespielt wie die Erwachsenen. Das hier ist ja nur Kinderkram.«
»Der alte Frank«, erwiderte ich, auf den pensionierten Profispieler bezugnehmend, der sich noch immer jedes Spiel ansah, »sagt, dass unsere eine der stärksten Elfen ist, an die er sich erinnern kann. Frank war doch damals schon hier, als du hier Schüler warst, oder?«
»Frank wird langsam zu senil, um noch ein verlässliches Urteil fällen zu können. Ich sage euch, zu meinen Zeiten hatten wir Teams, die bestanden aus Männern. Männer, die im Krieg ihrem Land gedient hätten, statt in der Schule Cricket zu spielen.«
»Der Krieg ist vorbei«, sagte Mama.
»Nicht drüben im Osten.«
»Ich werde meinen Dienst leisten«, sagte ich, »wenn sie mich einberufen, wann und wo auch immer.«
»Wenn die Kämpfe alle vorüber sind.«
Mein Vater hatte im eben beendeten Krieg zunächst beim Königlichen Feldzeugkorps gedient und war dann früh freigestellt worden, weil sein Firmengeschäft kriegswichtig war.
»Wie sieht der Rektor das?«, sagte Mama nervös. »Wirst du vor oder nach deiner Zeit im Lancaster zur Armee müssen?«
»Bis jetzt weiß es keiner.«
»Und warum ist das denn so sicher«, sagte Vater, »dass er nach Lancaster geht?«
»Aber Jack, er hat ein Stipendium … Und wenn er im nächsten Frühjahr vielleicht noch ein besseres Stipendium erwerben kann …«
»Mit einem Stipendium ist nicht für alles gesorgt. Wer kommt für den Rest auf?«
»Wenn du dich so aufführen willst, warum hast du dann beschlossen, dass Fielding noch ein weiteres Jahr auf der Schule bleiben darf?«
»Weil mir dieser Schulrektor von ihm ein paar ausgegeben und mich dann eingewickelt hat. Hat ein paar schmeichelhafte Sachen gesagt, das muss ich schon sagen … Also hab ich ihm versichert, dass mein Sohn seinen Platz hier noch ein weiteres Jahr benötigen wird, und ich werde jetzt keinen Rückzieher machen.«
»Warum also nicht das Beste daraus machen?«, sagte Mutter.
»Das werde ich ja tun, noch ein Jahr lang. Wenn sie ihn nicht vorher zum Militärdienst ziehen«, fügte Vater hämisch hinzu.
»Das werden sie nicht machen«, sagte ich. »Das zumindest ist sicher. Als Anwärter auf ein weiteres Universitätsstipendium bin ich auf Ersuchen meines Rektors zurückgestellt bis August 1946.«
»Auch sehr schön«, meinte mein Vater, »Rumträumen von Latein und Griechisch, während andere das Kämpfen für einen übernehmen. Aber hör mir gut zu: Wenn du diese Schule verlassen hast, zahle ich nicht weiter für Latein und Griechisch. Falls, falls ich dich nach Cambridge schicke, muss etwas Nützliches dabei herauskommen.«
Und so weiter. Die üblichen Attacken meines Vaters, das übliche lächerliche oder zum falschen Zeitpunkt angebrachte Dagegenhalten meiner Mutter, das übliche Schmollen, Eingeschnapptsein und kurzweilige Aufblitzen offener Revolte bei mir. Nach einer Weile kam Peter Morrison vorbei, den meine Mutter sehr verehrte, um meine Eltern zu begrüßen.
»Und du spielst wohl nicht?«, sagte mein Vater brutal.
Peter, ein recht guter Spieler, der nur knapp an einem Platz im Team vorbeigeschrammt war, war an meinen Vater schon gewöhnt und nahm es ganz gelassen.
»Die sind einfach zu gut für mich«, sagte er.
»Aber ich habe gerade schon zu ihm gesagt« – mein Vater stach mit einem seiner Finger mit den abgenagten Nägeln nach mir –, »das hier ist Kinderkram. Wenn einer von denen was taugen würde, wären sie schon längst ab und im Krieg. Wie ich.«
Der Punkt war erreicht, an dem ich es nicht mehr ertragen konnte. Ich erfand eine Lüge, dass ich wegen ausgefallenen Personals bei den Vorbereitungen fürs Abendbrot helfen musste, und eilte davon, Peters vorwurfsvollen Blick ignorierend.
Christopher saß hinter dem kleinen Verschlag, an dem der Spielstand angezeigt wurde, und als ich mich neben ihm niederließ, drückte er sein Knie fest gegen meins. Die weißen Flanellhosen, die er trug, waren weich und warm und ganz leicht feucht vom Schweiß. Die Berührung, so jungenhaft und unschuldig, war von einer schmerzlichen Intensität, die weit über einfaches sinnliches Verlangen hinausging. Schenkel an Schenkel, dazwischen nur der leicht feuchte Hosenstoff, keusch und doch entrückt, verharrten wir – zehn Minuten voll unbedeutender Spielgeräusche und eine Ewigkeit voll Liebe.
»Mich und deine Mutter da einfach so sitzen zu lassen«, sagte mein Vater, bevor sie am nächsten Tag abreisten, »du hast so verflucht wenig Manieren wie Mumm!«
Doch hätte es mehr gebraucht als den Besuch meiner Eltern, um diese Zeit des Glücks zu verderben. Die unverklärte Erinnerung weiß, dass der Juni 1945 ein feuchtkalter, wolkenverhangener Monat war, aber eine andere Art von Gedächtnis kann sich nur an strahlend blaue Morgenhimmel und goldene Nachmittage erinnern.
Ein solcher Morgen. Eine der ersten Stunden: Catull.
»Vivamus, mea Lesbia, atque amemus«, tönte der Schulvorsteher, »Rumoresque senum severiorum / Omnes unius æstimemus assis … Also, zu den Übersetzungen dieser Verse, die ihr anfertigen solltet … Gray.«
»Komm, Lesbia, lass uns lieben und leben
Und nicht einen einzigen Penny nur geben
auf Predigten mürrischer Greise zuhauf.
Sonnen gehen unter und wieder auf:
Doch wir, deren Lichter bald untergehen,
können vom Schlaf ew’ger Nacht nicht erstehen.
Gib tausend Küsse mir, gib alle sie her,
Und dann einhundert, und dann tausend mehr …«
»Danke, das soll erst mal reichen. Ich denke mal, dass Sie diese Einstellung teilen?«
»Ja, Sir.«
»Das tue ich, mit einigen Einschränkungen, auch. Das Gedicht führt uns knapp und kompromisslos die Grundgedanken des heidnischen Weltbildes vor Augen. Eine würdevolle und zugleich auch melancholisch vorgebrachte Akzeptanz der Auslöschung, die unser Tod mit sich bringen wird, verbunden mit der uneingeschränkten Begrüßung derjenigen Genüsse, mit denen man sich trösten kann.«
»Und die Einschränkungen, die Sie machen würden, Sir? Braucht es denn welche?«
»Ja. Catull war etwa fünfzig Jahre vor Christi Geburt schon tot und begraben. Das Christentum trägt uns eine andere Ethik an.«
Ah.
»Man muss … nicht zwingend … die christliche Ethik akzeptieren, Sir. Viele berühmte Persönlichkeiten haben sie in den letzten zweitausend Jahren abgelehnt.«
»Diese Schule jedoch, Gray« – trocken und nicht unfreundlich – »akzeptiert sie ausdrücklich. Das Christentum hat hier die Billigung von höchster Stelle. Einzelne Individuen mögen sich ihre eigenen Gedanken machen, aber sie müssen dennoch mit den offiziellen Ideen konform gehen. Es ist eine Frage des Zugehörigkeitsgefühls.«
»Und wenn diese Zugehörigkeit auf etwas fußt, das zweifelhaft oder unwahr ist, Sir?«
»Es wird nur Konformität von Ihnen erwartet. Kein Glaube.«
Unruhe machte sich unter den anderen Primanern breit, da sie Häresie in den höchsten Kreisen witterten.
»Aber warum sich anpassen, wenn man an etwas gar nicht glaubt?«, beharrte ich.
»Es ist, wenn man diese Einrichtung hier leitet, oder jegliche Einrichtung überhaupt, der Sache zuträglich, dies ausgehend von bestimmten Grundvoraussetzungen zu tun. Eine Grundvoraussetzung hier ist, wie unser Gründer betont hat, dass Christus der Sohn Gottes war und dass folglich die Moralvorstellungen, die er gepredigt hat, bindend sind. Das ist das Grundverständnis, nach dem die Schule geführt wird. Wir können Sie nicht zwingen, daran zu glauben, und in der Tat würden viele von uns das lieber sein lassen, aber wir können und müssen Sie zwingen, danach zu handeln. Andernfalls würde unser ganzes empfindliches Gefüge sich auflösen. Um in unserem Sinne zu handeln, Gray, sollten Sie sich also benehmen – nicht, als würde Ihnen einmal die ewig währende Nacht bevorstehen, sondern als hätten Sie eine unsterbliche Seele, die Sie nicht aufs Spiel setzen wollen, indem Sie Lesbia mit Küssen überhäufen. Es sei denn, natürlich, Sie wären so gut und würden sie vorher heiraten.«
Und was, wenn ich mit meinen Küssen Christopher überhäufen wollte? Eins war, nach allem, was ich gelesen hatte, sicher: Catull (»etwa fünfzig Jahre vor Christi Geburt schon tot und begraben«) hätte keine Einwände gehabt.
Und ein solcher Nachmittag. Mit Christopher beim Squash. Squash wurde im Sommer wenig gespielt, daher waren wir für uns. Nach dem Spiel eine kalte Dusche. Christopher, der unter seiner Dusche (die Tropfen schimmernd in den weichen hellen Haaren an seinen Beinen) seinen Körper von oben bis unten zur Schau stellt. Der junge Bacchus … nein, der junge Apollo. Herrgott, wie schön.
Christopher, der die Dusche dann aber auch verlässt, sobald sie ihre Schuldigkeit getan hat. Christopher, der sich abtrocknet, ohne unnötige Eile, das schon, aber auch ohne es in die Länge zu ziehen. Christopher, wieder angezogen. Die Sonne sengt durch das Oberlicht auf uns herunter.
»Hier drin ist es wie in einem Ofen. Gehen wir.«
»Christopher …«
»Wir kommen zu spät zum Abendessen. Gehen wir.«
Aber als wir den Hügel hochliefen, hakte er sich bei mir ein, ließ seine Hand an meinem Arm hinabgleiten, um für ein paar Schritte meine Hand zu halten, und legte sie dann wieder zurück in meine Armbeuge.
»Christopher … Als du noch Latein gelernt hast, seid ihr da bis zu Catull gekommen?«
»Nein, Fielding.«
»Weißt du, über was er geschrieben hat?«
»Nein.«
»Leidenschaft.«
Christopher blickte erstaunt drein.
»Ein versauter Haufen, diese Römer«, sagte er schließlich.
Nein, es war keine gute Idee, das, was ich ihm mitteilen wollte, in Worte zu fassen. Dieses schöne, unwissende Kind würde sie niemals verstehen, es sei denn, man würde in den schlichten, kruden Worten sprechen, die ihm bekannt waren, Worte, die zu benutzen ich weder den Wunsch noch den Mut hatte. Also drückte ich seine Hand in meiner Ellenbeuge, und er erwiderte den Druck. Hand an Arm auf dem Heimweg von den Squashplätzen – die karge, verdruckste Sprache unserer Liebe.
»Liebe?«, sagte Somerset Lloyd-James, als wir ein paar Tage später den Fluss entlangliefen. »Das hätte ich mir denken können, dass wir nicht durch den Sommer kommen, ohne dass dieser Unsinn plötzlich auftaucht.«
»Ich habe nicht gesagt, dass ich in irgendwen verliebt wäre«, sagte ich. »Ich hab euch bloß gefragt, wie ihr theoretisch dazu steht.«
»Du musst zunächst mal unterscheiden zwischen mehreren Befindlichkeiten, die alle leichtfertig so genannt werden. Worüber willst du was wissen: Verlangen, Zuneigung, Nächstenliebe, Leidenschaft oder das Vernarrtsein in jemanden?«
»Somerset übt sich im Expertentum«, sagte Peter Morrison.
»Gut«, beharrte ich, »glaubst du zuerst einmal an den Zustand, der als ›Verliebtsein‹ bekannt ist?«
»Das«, sagte Somerset umgehend, »läuft unter Vernarrtsein.«
»Und das heißt?«
»Eine oberflächliche körperliche Anziehung, die bewusst ihre Trivialität mittels romantischer Verbrämung vielfach verhüllt.«
»Und wie«, fragte Peter, »entsteht diese … vielfache romantische Verbrämung?«
»Die Verliebtheit ergreift von allem Besitz, das sich in Reichweite befindet und sich für poetische Konnotationen eignet. Sagen wir mal von einem Sonnenuntergang oder einer Flasche Wein. Von Ersterem will sie sich die Pracht aneignen, von Letzterer die legendäre Tradition, die diese mit sich bringt. Ein Kuss bei Sonnenuntergang erhält den Segen des scheidenden Apollo; ein Gekichere bei billigem Sherry wird mit der Wildheit und Schönheit des jungen Bacchus in eins gesetzt.
»Somerset scheint sich gut damit auszukennen«, sagte Peter. »Ich frage mich, ob er wohl selbst schon mal verliebt war.«
»Natürlich nicht«, sagte Somerset ungerührt. »Dafür bin ich ein viel zu nüchterner Geist.«
Wir kamen am alten Frank vorbei, dem früheren Cricket-Profi, der mit einem seiner Kumpel dasaß und angelte. Auf unseren Gruß hin wies er auf den Schwimmer und zuckte mit den Achseln.
»Frank sagt, dass er durchschnittlich zwei Fische im Jahr fängt«, sagte Peter, der sich einmal nach der Ergiebigkeit des Flusses erkundigt hatte.
»Eine friedliche Beschäftigung«, fügte ich an.
»Sinnlos und zermürbend«, sagte Somerset streng. »Was mich darauf bringt: Was werdet ihr beide in den Ferien machen? Es ist nur noch ein bisschen mehr als ein Monat – man kann nicht früh genug anfangen zu planen.«
»Ich werde auf unserer Farm in der Nähe von Whereham sein«, sagte Peter, »bis mein Einberufungsbescheid kommt. Was wahrscheinlich Anfang September sein wird.«
»Und ich bin zu Hause in Broughton Staithe«, sagte ich trübsinnig, »wie immer.«
»Ein angenehmer Ort zum Arbeiten?«
»Nicht, wenn meine Eltern da sind. Obwohl sie einen Teil der Zeit wegfahren.«
»Ohne dich?«
»Wenn es nach mir geht.«
»Und natürlich«, sagte Somerset, »hast du Peter ganz in der Nähe, wenn er in Whereham ist. Ich denke, ja, ich denke, ich werde eine Fahrt entlang der Ostküste machen und einmal schauen, was ihr so treibt. Wann sind deine Eltern weg?«
»Ende August bis Anfang September.«
»Bestens. Ich komme zu Besuch. Und bringe natürlich meine eigene Lebensmittelkarte mit. Wir können Peter an seinen letzten Tagen in Freiheit ein bisschen beistehen.«
»Ich hab doch keine Angst vor der Armee«, sagte Peter. »Und deine Eltern erlauben dir das? Einfach so?«
»Sie vertrauen mir, und sie stellen mir eine adäquate Summe zur Verfügung. Solange ich in Sachen Geld und Vertrauen den gesetzten Rahmen nicht übertrete, kann ich machen, was ich will.«
Auf der Hügelkuppe auf dem Weg vom Dorf herauf zur Schule kam nun der Founder’s Court in den Blick: auf drei Seiten der geschmacklos klobige, aber unheimlich zweckmäßige Gebäudekomplex, den man in den 1860er-Jahren erbaut hatte, als die Schule aus der Londoner City hierhergezogen war, die vierte Seite war zum Tal hin offen, und in der Mitte, auf dem Rasen, stand eine Statue des elisabethanischen Schlitzohrs und Gründers der Einrichtung.
»Sir Richard«, sagte ich und zeigte auf die Statue, »sieht meinem Vater ganz ähnlich. Und sie haben auch sonst einiges gemeinsam. Habgier und Sturheit, zum Beispiel.«
»Du mit deinen Obsessionen! Erst die Liebe, jetzt deine Eltern. Dann erklär mir doch mal«, fuhr Somerset fort, »wie es kommen konnte, wenn dein Vater ach so wenig verständig ist, dass er so einen hübschen Namen für dich ausgesucht hat. Er klingt nicht nach einem ›Tom-Jones‹-Leser.«
»Den Namen hat meine Mutter ausgesucht. Nach einem alten Freund von ihr, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist … Ein begeisterter Cricketspieler, den sie Fielding nannten, weil er mit Nachnamen Legg hieß. Sie freut sich immer, wenn ich beim Cricket gut spiele – genauso wie es meinen Vater ärgert, der auf den Mann eifersüchtig ist.«
»Eifersüchtig auf einen Mann, der seit dreißig Jahren tot ist?«, brummte Peter.
»Ich hab’s euch doch gesagt. Er ist gleichzeitig habgierig und störrisch. Er staut gern was auf.«
»Ein dickes Kapitel Familiengeschichte«, bemerkte Somerset. »Es ist ganz klar, dass dir das Obsessive im Blut liegt. Ich glaube, ich komme sogar ein bisschen früher nach Broughton Staithe und schaue mir den Mann mal an.«
»Komm, wann immer du willst. Mein Vater hat gerne Freunde von mir als Gäste im Haus. Ihre Schwächen kann er hinterher, wenn sie wieder weg sind, als Munition gegen mich einsetzen.«
»Womit vermutlich geklärt wäre, warum ich bisher noch nie eingeladen wurde. Bist du sicher, dass du es jetzt riskieren kannst?«
»Ja«, sagte ich. »Ich lerne so langsam, wie ich ihn nehmen muss.«
»Wie denn?«, sagte Peter.
»Immer wenn er unangenehm wird, einfach aufstehen und gehen. Das ist der einzige Weg, wie man mit jemandem umgehen kann, der Freude daran hat, andere zu schikanieren … bis man groß genug ist, um zurückzuschlagen.«
»Solange du ihn derweil dann nicht mich schikanieren lässt«, sagte Somerset.
»Dich kann man nicht schikanieren … Du hast den bösen Blick.«
Und so wurde ausgemacht, dass Somerset um den 20. August herum nach Broughton zu mir nach Hause zu Besuch kommen sollte und dass wir dann gemeinsam weiter nach Whereham fahren würden, um einige Tage mit Peter zu verbringen, bevor er zum Dienst für den König einberufen wurde.
Anfang Juli wurde ich zum Schulrektor bestellt, der zudem, wie ich erwähnt habe, meinem Haus als Leiter vorstand. Er wünschte, wie er mir gleich sagte, in beiden Funktionen mit mir zu sprechen. Er wies mir einen Lehnstuhl zu und verfrachtete seine eigene behäbige Gestalt in einen anderen, der mir gegenüber mit der Rückenlehne zum abendlichen Licht vor dem Fenster stand.
»Es ist an der Zeit«, sagte der Rektor, »dass einige Dinge klargestellt werden.«
»Sir?«
»Im nächsten Schulquartal werden Sie unser Hauskapitän sein. Sie haben gute Aussichten, noch vor dem Sommerquartal im kommenden Jahr dann auch Kapitän der ganzen Schule zu werden. Und niemand könnte behaupten, dass es Ihnen an der nötigen Eignung dafür fehlt.«
Vor dem Fenster wurde es langsam dunkel. Einige Tage lang war es extrem heiß gewesen, und nun hörte man bedrohlichen Donner. Ein dunkler Wolkenwirbel schraubte sich aus dem Tal empor. In dem Grübchen am Kinn des Rektors hatte sich Schweiß gesammelt.
»Nein«, sagte der Rektor, »Ihr schlimmster Feind könnte nicht behaupten, dass Sie einer solchen Verantwortung nicht gewachsen wären. Aber … Aber …«
»Aber was, Sir?«
»Ich wünschte, ich wüsste etwas genauer, wo Sie stehen. Nach außen hin erfüllen Sie alles, was wir erwarten: Ihre schulischen Arbeiten, Ihre sportlichen Leistungen, das Verhalten, das Sie an den Tag legen. Aber was, was ist Ihre … Ihre Losung, Fielding? Worauf bauen Sie im Leben?
»Es ist noch etwas zu früh, um das wissen zu können.«
»Nun«, sagte der Rektor, »es gibt eine ganz bestimmte Sache, bei der wir beide es schon jetzt ganz genau wissen müssen. Wie ist Ihre … Einstellung … was Christopher Roland angeht?«
Also darum ging es. Jetzt keine Blöße zeigen.
»Wie immer. Ich kenne ihn jetzt seit fast vier Jahren, und ich mag ihn sehr gern.«
»Ja. Aber da ist etwas bei Ihnen beiden … wenn Sie zusammen sind … bei dem mir nicht ganz wohl ist.«
»Dafür gibt es aber keinen Grund, Sir.«
»Kann ich das als Zusicherung werten? Kann ich wirklich sicher sein, dass Sie sich für das Amt meines obersten Präfekten eignen?«
Draußen gewann die schwarze Wolke rasch an Umfang, wie ein riesiger Flaschengeist, den man aus der Wunderlampe heraufbeschworen hat. Der Rektor beugte sich in seinem Lehnstuhl nach vorne und erschauerte kurz wie ein großer, angsterfüllter Hund.
»Sie sind nicht konfirmiert«, sagte er. »Wo stehen Sie – diese Frage muss ich stellen – im Hinblick auf das Christentum?«
»Das ist keine einfache Frage, Sir … Ich tue mich schwer damit, seine Verbote nachvollziehen zu können, seine Fixierung auf das, was sündig oder falsch ist. Die Griechen haben ihr Augenmerk auf das gelegt, was angenehm und anständig und damit richtig ist.«
»Christus hatte, als Jude, etwas genauere Moralvorstellungen. Und als Sohn Gottes hatte Er die Autorität, neue Wahrheiten zu verkünden und alte Irrtümer auf den Prüfstand zu stellen.«
»Hatte er das?«, sagte ich.
Ein langes Schweigen entstand zwischen uns.
»Die Griechen standen für Vernunft und Anstand«, sagte ich. »Reicht das nicht aus?«
»Vernunft und Anstand«, murmelte der Rektor, »aber ohne die Beglaubigung durch eine religiöse Offenbarung …? Nein, Fielding. Das reicht nicht. Ich muss wissen, was zu ignorieren oder zu tolerieren ist, und es muss eine Bestrafung geben, wenn es Vergebung geben soll. Machen Sie sich diesen Unterschied bitte bewusst.«
»Das ist ein fundamentaler Unterschied, Sir.«
»Wollen wir hoffen, dass wir nicht zu weit auseinanderliegen werden … Kommen Sie«, fuhr er abrupt fort, »und besuchen uns in Wiltshire? Irgendwann im September? Wir beide, Sie und ich, werden in diesem Schulquartal zu viel zu tun haben, um noch mal ausführlich miteinander zu reden. Aber es gibt zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, noch einiges zu sagen. Ganz zu schweigen von den praktischen Fragen, die für den Herbst zu regeln sind.«
»Ich komme sehr gerne, Sir. Wann immer es Ihnen nach dem 7. September passt.«
Ich erzählte ihm von Somerset und Peter.
»Schön, schön«, sagte der Rektor und schälte sich aus dem Stuhl, um mich zu verabschieden. »Und vergessen Sie derweil bitte nicht: Ich sage nicht, dass Ihre Position unredlich ist. Sondern lediglich, dass sie mir zu wenig Kontur hat, um mich damit zufriedengeben zu können. Gute Nacht, Fielding.«
Durchs Fenster war ein Blitz zu sehen.
»Ah!«, sagte der Rektor. »So ein ordentliches Unwetter, darüber freue ich mich immer.«
Wir wandten uns beide dem Fenster zu. Ein zweiter Blitz stieß dreizackig ins Tal hinab.
»Und beinahe hätte ich es vergessen«, sagte der Rektor, »wo eben ja alles ganz allgemein gesprochen war … Sorgen Sie bitte dafür, dass ich Sie nicht so häufig … oder zumindest weniger auffällig … zusammen mit Christopher Roland sehe.«
»Er hat gesagt, dass man uns nicht so oft zusammen sehen sollte.«
Draußen vor dem Fenster meines kleinen Studierzimmers Donner. Regen schießt aus dem Dunkel gegen das Glas. Christopher sitzt in dem Lehnstuhl links von der Tür, ich selbst am Schreibtisch, aufrecht, als würde ich ein Bewerbungsgespräch anlässlich eines Stellenangebots mit ihm führen.
»Warum denn nicht?«
»Hat er nicht wirklich gesagt. Es war ihm unangenehm, er sagte …«
»Unangenehm? Warum, Fielding?«
»Ich weiß nicht. – Natürlich weiß ich es. Weißt du, Christopher, ich … Ich bin …«
»Ja, Fielding?«
Nur ein kleines Wort, und dennoch hatte ich nicht den Mut, es zu sagen.
»Ich … Wir beide … Wir fallen hier auf. Wir müssen uns diskret verhalten, das ist alles.«
»Aber ich bin gern mit dir zusammen.«
»Geht mir ja auch so. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn wir unseren Frieden haben wollen, müssen wir vorsichtig sein. Gute Nacht, Christopher.«
Das Gewitter klärte die Luft nicht. Noch tagelang herrschte eine feuchtschwere Hitze, während sich rundherum am Horizont die Wolken bedrohlich am Himmel herumdrückten, als warteten sie auf den richtigen Moment, um loszubrechen und ihr vernichtendes Werk anzurichten. An einem der Nachmittage stiegen Peter Morrison und ich, in Begleitung von Christopher und einem anderen Jungen namens Ivan Blessington, auf unsere Räder und fuhren zum Schwimmen an den Obelisk Pond, einen See mit sandigem Grund mitten im nahegelegenen Wald, der von einem Seitenarm der Themse mit klarem und frischem Wasser versorgt wurde und seinen Namen einem grotesken Monument verdankte, das ein Onkel von Königin Viktoria seiner morganatischen Ehefrau errichtet hatte.
Wir waren dort nicht allein. Eine Gruppe Soldaten lümmelte an dem Sandstrand herum, ihre Feldblusen um sich verstreut, die kragenlosen Hemden weit offen. Sie rauchten Zigaretten und starrten zu den Mädchen einer auch in der Gegend gelegenen Privatschule hin, die hundert Meter weiter dekorativ bei einigen Badehütten ins Wasser stiegen. Als wir ankamen, musterten uns die Soldaten kurz, als befürchteten sie Konkurrenz, belächelten uns aber nur und wandten sich wieder den Badenden zu. Eine Aufsichtslehrerin rief nervös nach zwei oder drei Mädchen, die zügig von den Hütten wegschwammen, als würden sie von den Blicken der Soldaten angezogen. Die Mädchen kehrten um; die Soldaten zuckten mit den Schultern und fluchten. Wir vier gingen hinter die Bäume, um uns umzuziehen.
Als wir zurückkamen, waren die Soldaten dabei, sich wieder anzuziehen und sich auf den Befehl eines rattengesichtigen Obergefreiten hin ganz gemächlich in Reih und Glied aufzustellen. Gelangweilt, schwitzend, mit schweren Augenlidern und außer Reichweite vom eben noch vielversprechenden Anblick des jungen weiblichen Fleisches, trösteten sie sich damit, mir und Christopher ironisch zuzupfeifen, als wir als Erste aus unserer Gruppe an ihnen vorbeikamen. Der rattengesichtige Obergefreite, der einen schwierigen Nachmittag vor sich liegen sah und sich nicht zu gut war, sich bei seinen Soldaten anzubiedern, trug auch ein paar Pfiffe mit bei und schaute dann nervös auf seine Uhr.
»Augen geradeaus! Sagt den hübschen Damen auf Wiedersehen!«
Verdrießlich lächelnd machten sich die Männer für weitere Befehle bereit.
Ich ging zügig weiter. Christopher trat, etwas bange, aber entschlossen, auf den Obergefreiten zu.
»Ihren Namen und Ihre Erkennungsnummer, bitte!«, sagte Christopher.
»Und wer denkst du, dass du bist?«, knurrte der Obergefreite.
»Ein Mitglied der Gesellschaft, das sich über Ihr Verhalten beschweren wird.«
»So, man wird sich also über mein Verhaltön beschwerön, nicht wahr? – Stink ab, Kackarsch! Los, Junge, bevor ich …«
»Würden Sie mir bitte Ihren Namen und Ihre Erkennungsnummer geben?«
Der Obergefreite brachte sich in Positur, um den Trupp auf seinen bevorstehenden Triumph einzustimmen.
»Nein, Graf Koks, ich werde Ihnen nicht meinen Namön und meine Erkennungsnummah gebön, wiewohl Sie an meinem Verhaltön auch Anstoß nehmen mögen – ha ha, und jetzt hau ab und spiel mir dir selbst – wenn du was zum Spielen hast.«
Peter, ein Muskelpaket mit massivem Brustkasten, und Ivan, dem schwarze Locken vom Nacken bis zum Nabel wallten, waren nun auch angekommen und standen hinter Christopher.
»Das wird Ihnen nichts helfen«, sagte Peter kühl. »Ich kenne Ihre Einheit. Der befehlshabende Offizier Ihrer Kompanie kommt immer zu unseren Cricketspielen. Es wird für ihn nicht schwer sein herauszufinden, welche seiner Männer heute Nachmittag hier im Wald trainiert haben. Und wer für sie verantwortlich war.«
»Ach komm, Kumpel«, jaulte der Obergefreite eilfertig auf. »Es war doch bloß ein Scherz, weißt du, nur …« Aber Peter, Christopher und Ivan waren bereits weitergegangen, hinunter zum Wasser. Der Obergefreite blickte ihnen hinterher, zuckte, spuckte aus, wandte sich wieder seinen Männern zu und fing an, in einem schnellen, nervösen Singsang Kommandos zu geben, wobei er von Zeit zu Zeit grinsend und achselzuckend über seine Schulter zu uns herüberschaute.
»Wirst du ihn melden?«, fragte Christopher.
»Ja.«
»Ich weiß nicht. Vielleicht doch besser nicht.«
»Dann hättest du ihn ignorieren sollen. Was du bei solchen Leuten anfängst, musst du auch zu Ende führen. Sonst denken die, sie kommen damit durch.«
»Aber dann bekommt er Ärger.«
»Genau. Warum hast du denn sonst nach seiner Nummer gefragt?«
Wir gingen ins Wasser und schwammen, der schwarze Ivan vorneweg, zu den Mädchen drüben am Ufer hin. Die Badekappenköpfe drehten sich rasch in unsere Richtung, drehten sich wieder weg und dann wieder her, mit aufmerksamen, neugierigen Mienen. Ivan, der uns zwanzig Meter voraus war, pflügte mit der Hand über die Wasseroberfläche und bespritzte das Mädchen, das ihm am nächsten stand.
»Schön warm, oder?«, rief er.
Die nervöse Lehrkraft, die unsere Invasion misstrauisch beäugt hatte, lächelte erleichtert, als sie Ivans gefahrlose Privatschulaussprache hörte.
Dennoch: »Noch zwei letzte Minuten, Mädchen!«, kreischte sie.
Ich selbst tauchte ab und schwamm unter Wasser, bis mir fast die Ohren platzten. Jetzt also, durch die Oberfläche: Wo würde ich rauskommen? Falsch gedacht, ich war noch nicht nah genug dran. Etwas von mir entfernt standen einige Mädchen im Kreis um Ivan herum, der sich auf dem Rücken treiben ließ (die schwarzen Haare auf seinem Bauch und seiner Brust kräuselten sich glitzernd) und ihnen erklärte, wie man sich ewig so treiben lassen konnte, wenn man sich nur entspannte und richtig atmete, und wie man dabei seinen Proviant verzehren und auf Rettung warten, ja sogar schlafen könne. Peter umkreiste schwimmend ein hochgewachsenes, schlankes Mädchen mit großen Brüsten und redete mit gewichtiger Miene zu ihr hinauf, während sie einfach dastand und nickte. Christopher schien, wie ich, irgendwie am Rande des Geschehens gelandet zu sein. Verdrießlich schwamm er dreißig Meter in Rückenlage und machte dabei viel Getöse; launisch lenkte er einen Spritzer Wasser auf eines der jüngsten Mädchen, lachte rabaukenhaft, wurde aber rot vor Scham, als das Kind aufwinselte und sich mit zitternden Lippen wegduckte.
»Alle raus!«, brüllte die Lehrerin.
Die Mädchen traten den Rückzug an. Ivans Gruppe winkte und kicherte. Peters einzelne Maid schritt rückwärts aus dem Wasser, ohne ihren Blick von seinem runden, ernsthaften Gesicht zu lösen. Christopher und ich schwammen mit kräftigen und akkurat ausgeführten Zügen davon, wie um zu demonstrieren, dass wir uns nun dem wahren Zweck des Nachmittags zu widmen begonnen hatten.
Später, als wir alle auf dem Streifen Sand am Ufer lagen, sagte Peter: »Eine angenehme Abwechslung.«
Selbstbewusst, ungezwungen, ein männliches Wesen, bei dem alles läuft wie geschmiert, bestens für seine Rolle ausgestattet.
Ivan nickte und gab einen Grunzlaut von sich, reckte dann sein Gesicht zum Himmel und lachte.
»Die haben kein Wort von dem geglaubt, was ich ihnen erzählt habe«, sagte er, »aber angeschaut haben sie mich, als wäre ich Johannes der Täufer, der gekommen ist, um im Jordan zu predigen.«
»Einer ihrer Tricks«, sagte ich schnippisch. »Ihre biologische Aufgabe ist es, das Männchen erst anzulocken, und später lassen sie ihm dann kaum Luft zum Atmen, so dass sie sich mit ihm vermehren können, ohne Angst haben zu müssen, dass es aufbegehrt. So ein klein wenig zur Schau gestellte Anbetung ist ein wohlerprobtes Lockmittel.«
Peter und Ivan grinsten großherzig.
»Na, da hat wohl wer Somerset Lloyd-James gut zugehört?«
Christopher schaute zu mir herüber.
»Ich hab meine Uhr oben bei meinen Kleidern gelassen«, sagte er. »Diese Soldaten … Ich will mal schauen, ob sie noch da ist.«
»Ich komme mit«, sagte ich.
Peter und Ivan setzten bewusst neutrale Gesichter auf. Christopher und ich liefen langsam und stillschweigend zu den Bäumen hinüber. Selbst im Schatten war dieser Nachmittag sehr heiß … heiß, schwül, drückend. Als Christopher sich hinabbeugte, um nach seiner Uhr zu sehen, legte ich meine beiden Hände auf seinen bloßen Nacken und fing an, mit meinen Fingernägeln sanft über seine Haut zu fahren. Ein Schauer durchfuhr ihn, aber er setzte seine Suche fort.
»Hier ist sie. Alles gut.«
Er drehte sich zu mir, dann legte er seine Wange an meine.
»Los, komm, Fielding. Wir müssen zurück.«
»Lass uns hierbleiben, nur ganz kurz.«
»Nein.«
»Warum denn nicht?«
»Peter und Ivan … die werden das seltsam finden.«
Ich wandte meinen Kopf und küsste ihn auf die Wange. Er stand ganz still, vielleicht zehn Sekunden lang. Dann erschauerte er wieder – genau wie schon zuvor, als ich ihm übers Genick gestrichen hatte – und schlüpfte zur Seite.
»Zurück zu den anderen.«
Ich folgte ihm, aufs höchste erfreut über meinen Kuss, und verübelte ihm sein Ausweichen auch kaum. Das muss reichen, dachte ich zärtlich, denn so ist es ihm lieber. Sei nicht begehrlich. Dring nicht auf mehr.
Zurück zum See.
»Peter … Ivan …«
»Alles in Ordnung mit der Uhr?«
»Uhr?«, sagte Christopher. »Ach so … ja, danke.«
»Gut. Ich dachte gerade, du hättest ein bisschen aufgewühlt ausgesehen.«
»Natürlich bin ich nicht aufgewühlt.«
»Natürlich nicht«, sagte Peter gleichmütig, »wenn mit deiner Uhr alles in Ordnung ist.«
Eine Zweierreihe Schulmädchen trottete nun auf der anderen Seite des Sees nach Hause. Peter erhob sich auf einen Ellenbogen, um zu winken, und erntete einen Schwall von Gekicher, der über den See zu uns herüberwehte und sich wie Vogelgezwitscher in den Bäumen verfing.
In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen.
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus … Die Worte kreisten endlos in meinem Kopf.
Gib tausend Küsse mir, gib alle sie her,
Und dann einhundert, und dann tausend mehr …
Sei nicht begehrlich, sagte ich mir. Du hast einen Kuss gewährt bekommen, und wenn die Zeit reif ist, wirst du ihm einen weiteren geben dürfen. Das ist genug. Halt dich zurück und verdirb es nicht.
»Und folglich werden wir«, sagte der Schulvorsteher, »von den Sozialisten regiert werden. Wie das dem griesgrämigen Constable gefallen wird!«
Der Rest der Schule war zu einem Wandertag unterwegs, den ich und auch unser Schulvorsteher zu vermeiden gewusst hatten. Wir feierten unseren Urlaub mit etwas, das er einen »bescheidenen Mittagstisch« nannte, zu dem es den großen Luxus aus Kriegszeiten gab, eine Flasche algerischen Wein.
»Wie wird sich das auf uns hier auswirken, Sir?«
»Es hängt viel davon ab, ob sie in fünf Jahren wieder rankommen oder nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dickere Fische für sie als uns. Aber ungefähr 1950 wird wohl der Nachschub knapp werden. Und dann …«
»Aber die können doch sicher das staatliche Schulsystem verbessern, ohne unseres zu ruinieren. Warum lassen die uns nicht einfach in Ruhe?«
»Sozialisten«, sagte der Schulvorsteher, »können nie etwas in Ruhe lassen. Das ist ja das Problem. Sie fangen mit ein oder zwei Dingen an, die dringend reformiert werden müssen – und ich wünsche recht viel Glück dabei. Doch dann wird es für sie zur Gewohnheit. Sie können nicht aufhören. Und das ist es auch, was sie zur Strecke bringen wird. Wie Macaulay sagt, können wir uns eine Weile mit einem Wüstling arrangieren, oder sogar einem Tyrannen; aber von jemandem regiert zu werden, der immerzu herumwerkeln muss, das ist mehr, als die menschliche Natur aushalten kann.«
»Wie lang geben Sie ihnen also?«
Der Schulvorsteher nahm einen kräftigen Schluck vom Algerischen.
»Nicht viel länger, so hoffe ich, als vier Jahre. Bis dahin werden viele Leute aufgehört haben, dankbar für die gewährten Vergünstigungen zu sein, und von dem Predigertum genug haben. Insbesondere wenn ihnen nahegelegt werden wird, was ihre sozialistische Pflicht verlangt, dass sie nämlich ihren neuerworbenen Wohlstand mit ihren weniger glücklichen Brüdern in anderen Ländern teilen sollen.«
»Und das wird das Ende der Sozialisten sein?«
»Fürs Erste …« Der Schulvorsteher schaute mit einem Mal verdrießlich. »Dieser miese Wein«, sagte er, »gewinnt auch durch eine gewitterschwangere Atmosphäre nicht … Ja, fürs Erste das Ende der Sozialisten; und, wie ich hoffe, für unseren drögen Freund Constable. Doch gerade jetzt ist er auf dem aufsteigenden Ast, und ich muss Sie eindringlich warnen.«
»Warnen, Sir?«
»Ja. Auch wenn Sie kürzlich, im Mai, keinen allzu guten Eindruck bei ihm hinterlassen haben, haben Sie mit Ihren Ambitionen, Universitätsprofessor zu werden, sein Interesse geweckt. Er hat also an mich geschrieben und sich nach Ihnen erkundigt. Er mag mich hassen wie die Pest, aber auf mein Urteil legt er Wert. Auf seine Weise ist er ein sehr akkurater Mensch.«
»Was haben Sie ihm gesagt?«
»Dass es noch zu früh am Tage ist, aber dass ich finde, dass Sie vielversprechend erscheinen. Ich habe hinzugefügt, dass ich mich sehr wundern müsste, wenn Sie Ihr einfaches Stipendium bis Ende April nicht in eine der höchsten Auszeichnungen verwandelt haben.«
»Vielen Dank, Sir. Aber was hat das mit einer Warnung zu tun?«
»Ah. Wegen Ihres Benehmens, als er Sie getroffen hat. In Constables Kopf hat sich festgesetzt, dass Sie die Dinge nicht ernst genug nehmen. Er traut Ihren Motiven nicht. Er meint, Sie wollen Uniprofessor werden, weil das eine angenehme Art ist, sein Leben zu führen.«
»Da ist schon etwas dran«, sagte ich.
»Natürlich ist da was dran, und nur ein Tugendbold wie Constable hätte damit ein Problem. Nun ist es aber eben so, dass Sie ein Handicap haben – ein doppeltes Handicap. Als Ökonom ist Constable in jedem Fall geneigt, uns Altphilologen als Parasiten anzusehen. Und dann kommen Sie und bekennen sich auch noch fröhlich zu dieser Zuschreibung.«
»Aber ich bekenne mich doch gar nicht zu der Zuschreibung.«
»Sie bekennen – mir gegenüber –, dass Sie aufs Vergnügen aus sind?«
»Neben anderen Dingen.«
»Dann sind Sie nach Constables Maßstäben ein selbsterklärter Parasit.«
»Was wird denn von mir erwartet? Mich selbst zu verleugnen?«
»Sie müssen versuchen, die Tatsache, dass Sie das Leben genießen, zu verbergen. Um es Constable recht zu machen, müssen Sie Gelehrsamkeit zu einer Pflicht machen. Sie müssen ein Stipendium als eine hochstehende Berufung ansehen.«
»Aber Mr. Constable ist doch sicher nicht der typische Vertreter des Colleges insgesamt?«
»Nein. Aber er bekleidet dort ein wichtiges Amt. Jetzt, wo ich genauer darüber nachdenken konnte, ist mir klar, dass man in Lancaster eine sehr clevere Entscheidung mit seiner Ernennung getroffen hat. Mir ist klar geworden, dass die gesehen haben, woher der Wind weht, und Robert Constable als wertvolles Utensil zu ihrer Tarnung installiert haben.«
»Ein unstimmiges Bild.«
»Seien Sie nicht vorwitzig. Deren Plan ist es, Constable als Tutor im College eine unübersehbare Arbeitsroutine und offensichtliche Mühen durchlaufen zu lassen, ganz im Sinne der sozialistischen Behörden, während der Rest von ihnen in Ruhe gelassen wird und sich weiterhin ihrem eigenen Amusement widmen kann.«
»Dann werden die auf meiner Seite sein?«
»Durchaus wahrscheinlich. Doch werden sie sich nicht exponieren, um Sie vor Constable in Schutz zu nehmen. Seine Funktion ist zu wichtig, die muss er erfüllen: Er ist sowohl ein Zugeständnis an als auch ein Schutz gegen die Erfordernisse des sozialistischen Denkens. Fürs Erste werden sie ihn machen lassen.«
»Wie Sie es an dem einen Sonntag gesagt haben? Soll er doch die Portvorräte verkaufen und vorne auf der großen Rasenfläche Kohl anbauen?«
»Ich wage zu bezweifeln, dass sie so weit gehen werden. Aber um Sie werden sie mit Sicherheit kein großes Gewese machen.«
In den kommenden Tagen hingen die Wolken weiterhin grollend am Horizont, und die Luft wurde Stunde um Stunde schwerer und bedrohlicher.
»Schlecht für die Nerven«, sagte Peter Morrison. »Und jetzt, Fielding, lass uns mal unter vier Augen reden.«
Wir gingen in Peters Studierzimmer. Obwohl das Fenster weit offenstand, war es in dem kleinen Raum wie in einem Ofen, und es roch, ganz schwach, nach Peters Füßen, weil er gerne mit ausgezogenen Schuhen am Schreibtisch saß.
»Die kleine Sache, die du mit Christopher hast«, sagte Peter. »Ich will nicht krittelig erscheinen. Das ist uns allen ja schon mal passiert, zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber darum geht es eben: Es ist jetzt der Zeitpunkt erreicht, an dem du das beenden musst.«
»Wir haben nichts wirklich angefangen.«
Peter schüttelte in sanfter Gegenwehr den Kopf.
»Es hat durchaus etwas angefangen«, sagte er, »die einzige Frage ist, wie du es beendest, bevor es zu spät ist. Dabei geht es nicht um Moral, Fielding. Sondern einfach bloß darum, dass du hier inzwischen eine zu wichtige Rolle hast, um dabei erwischt zu werden. Unter den gegebenen Umständen betrifft, was auch immer mit dir passiert, uns alle. Schädliche Einflüsse auf höchster Ebene: Trommelwirbel, rollende Köpfe. Es schadet dem Haus, darum geht’s. Es weckt Aufmerksamkeit. Stört die allgemeine Ordnung.«
»Du rennst bei mir offene Türen ein«, sagte ich zu ihm. »Ich möchte genauso wenig wie du für Aufruhr sorgen. Und ich habe nichts getan, was welchen verursachen könnte.«
»Ich weiß, wie schnell sich so was ändern kann. Schau mich an … Obwohl, lassen wir das besser.«
Peter lächelte schief.
»Wenn du mir einen hilfreichen Tipp geben wolltest …«, ermunterte ich ihn.
»Hilfreiche Tipps, die etwas taugen, sind auf diesem Gebiet rar. Aber es gibt eine wichtige Sache, die du in deinen Kopf reinkriegen musst. Alle machen ein Riesengedöns um das Ganze. Sie reden davon, dass die Jungs für den Rest ihres Lebens verkorkst wären wegen der Erfahrungen, die sie in ihren Privatschulen gemacht haben, und behaupten dann, das sei der Grund, warum es, ganz abgesehen von grundlegenden moralischen Fragen, so immens wichtig sei, Orte wie diesen ›sauber‹ zu halten. Was sie aber nicht wahrhaben können oder wollen«, sagte Peter, für seine Begriffe fast erbost, »ist, dass das, was zwei Jungs privat miteinander anstellen, nicht das ist, was ihnen dauerhaft schadet, sondern der hysterische Aufruhr, der losgeht, wenn sie dabei erwischt werden.«
»Ich komme nicht ganz mit.«
»Also gut. Zwei Jungs verschwinden miteinander im Gebüsch. Einmal, zweimal, zwanzigmal. Sie spenden sich viel Vergnügen, aber solange andere Dinge gleich wichtig sind, wird daraus keine dauerhafte Vorliebe, denn sie werden erwachsen und gehen in eine größere Welt hinaus, die vielfältigere Ablenkungen bereithält. Richtig?
»Richtig.«
»Aber nehmen wir an, man ertappt sie dabei. Drama, Tränen, Anklagen, Briefe an die Eltern, angedrohte Schulverweise, endlose Verhöre: wann, wie oft, mit wem, wo, wie … Und bis dieser Teil der Geschichte ausgestanden ist, ist aus dem, was sonst einfach bloß eine alltägliche Erfahrung gewesen wäre, kaum mehr als ein Zufall, etwas … Folgenschweres, Obsessives geworden. Es hat sich bis ins tiefste Innere der Erinnerung und der Gefühlswelt eingebrannt. Es ist zu etwas geworden, das dich nie verlassen wird, wie eine Wunde, die immer bleiben und für den Rest deines Lebens immer wieder aufreißen wird. Ein Trauma, so nennen es, glaube ich, die Psychologen. Aber die Verwundung wurde ihnen, in den meisten Fällen, nicht durch das eigentliche Geschehnis zugefügt, sondern einzig durch die schonungslose Verfolgung … durch die Rachsucht … derjenigen, die zufällig auf das Geheimnis gestoßen sind. Und tatsächlich kann es sein, dass die zuständigen Stellen so extrem reagieren, dass es sich nicht nur auf die Jungen, die in dem Fall direkt betroffen sind, auswirkt, sondern auch auf jeden anderen in deren Umfeld, der so was irgendwann einmal auch gemacht hat. Und vielleicht sogar auf die, die vollkommen unschuldig sind. Die gesamte Atmosphäre ist aufgeladen mit Schuld, Angst und Faszination. Es ist wie dieses Gewitter, das über uns hängt. Wen wundert es dann, dass aus den Privatschulen so viele … sogenannte … Homosexuelle hervorgehen?
»Du scheinst dich ziemlich ausführlich damit beschäftigt zu haben.«
»Das musste ich tun. Als ich Kapitän dieses Hauses wurde, musste ich mir darüber klarwerden, wie ich meiner Verantwortung gerecht werden kann, wie ich mit allem umgehen würde, was so auftauchen kann – dem hier inklusive.«
»Und du hast entschieden, dass der beste Weg der ist, dass sich die Leute in Ruhe miteinander vergnügen sollen.«
»Sagen wir, ich wollte das Thema so dezent wie möglich behandeln. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass du, eine Person im Rampenlicht, nicht das Risiko eingehst, einen auffälligen Skandal vom Zaun zu brechen. Und du solltest auch daran denken, dass andere weniger tolerant sind als ich.«
»Andere?«
»An einem Ort wie diesem hier gibt es immer Leute, die ihre Nase in alles stecken. Das muss ich dir wohl nicht erklären.«
»Nein, musst du nicht. Und zwar weil ich dir schon vor langem erklärt habe – und das gilt noch immer –, dass ich aufgehört habe mit … den Spielchen im Wald. Mit Christopher ist nichts gewesen. Überhaupt nichts.«
»Dann lass es dabei«, sagte Peter entschlossen. »Das ist alles.«
Peters Warnung war ganz eindeutig wohlgemeint, und sie brachte mich zum Nachdenken. Seit ich dreizehneinhalb gewesen war, hatte ich mich, wie Peter gut wusste, mit einer Reihe von Jungen vergnügt, und ohne irgendwelche negativen Folgen. Aber es war mein Glück, dass es nie jemand mitbekam, und dies wissend hatte ich, schlicht und einfach aus pragmatischen Gründen, einige Monate zuvor einen neuen Anfang gemacht, als ich Aufsichtsschüler geworden war – »eine Person im Rampenlicht«, wie Peter es nannte. In so einer Position konnte man sich einfach keinen Ärger leisten. Und etwas anderes spielte auch noch eine Rolle: Sollte man nicht den Kinderkram langsam mal hinter sich lassen und zur nächsthöheren Stufe, Frauen, aufsteigen? Doch wenn es vielleicht zunächst eine klare Entscheidung gewesen war, nie wieder einem Jungen nahezukommen, so setzten dieser fast umgehend zwei weitere Überlegungen zu: zum einen, dass es zum gegebenen Zeitpunkt noch keine einzige Frau gab, zu der man hätte aufstreben können, und zweitens hatte mir meine Lektüre griechischer und lateinischer Literatur klargemacht, dass man das Beste aus beiden Welten haben konnte. Wenn Horaz, Catull und unzählige Dichter aus der griechischen Anthologie sowohl Jungen als auch Mädchen haben konnten, warum sollte das mir dann nicht vergönnt sein? Es nützte nichts, wenn der Schulvorsteher mir erklärte, dass diese Autoren von den christlichen Moralvorstellungen abgelöst worden waren, denn diese Moralvorstellungen, mit ihrem Gequengel und Gejammer, verabscheute ich einfach.
Dennoch hatte in den vergangenen paar Monaten die Klugheit obsiegt. Die einzige Gefahr eines Rückfalls hatte Christopher dargestellt, und da dieser fest entschlossen war, strenge Grenzen zu setzen, schien die Gefahr nicht allzu ernst zu sein. Ich mochte ihn viel zu sehr, um ihn zu etwas zu drängen (was das angeht, hatte ich noch nie jemanden zu etwas gedrängt), und ich hatte auch nicht vor (Sei nicht begehrlich!), ihn zu überreden. Peter, der sehr klug war und sowohl Christopher als auch mich sehr gut kannte, musste sich dessen wohl bewusst sein. Aber warum warnte er mich dann?
Der einzige Grund, entschied ich, konnte nur sein, eben weil er uns so gut kannte. Vielleicht war ich in meiner klugen Zurückhaltung anfälliger, als ich dachte, und Peter hatte das bemerkt. Aber selbst dann blieb noch meine panische Angst, bei Christopher zu weit zu gehen. Ja. Doch konnte es sein, dass Peter noch etwas anderes bemerkt hatte, dieses Mal bei Christopher, das ihm Anlass zur Sorge bereitete? War das der Grund für seine Warnung – dass Peter, anders als ich, Anzeichen dafür wahrgenommen hatte, dass Christopher, bei all seiner Zartheit, doch nachgeben könnte? Anzeichen dafür, dass seine Entschlossenheit sich lediglich zu Unentschiedenheit erweichte, und dass jene wiederum …
Und so kam es, dass Peter, indem er mich vor etwas warnte, auf das ich auf jeden Fall verzichten zu können glaubte, mich überhaupt erst darauf brachte, dass es wohl doch erreicht werden konnte.
»Du hast zu tun, Christopher?«
»Ich versuche mich für diese Prüfung morgen vorzubereiten. Geografie.«
»Ich setze mich einfach hierhin und bin ganz still.«
»In Ordnung. Aber ich muss wirklich lernen.«
Also schob ich meinen Hintern auf den kleinen Bücherschrank hinter seinem Stuhl, legte meine Hände auf seinen Nacken und begann, seine Schulterblätter zu massieren.
»Bitte nicht.«
»Lern einfach weiter, Christopher. Das wird dich entspannen.«
»Tut es nicht. Es … Tut mir leid, Fielding, aber bitte geh.«
»Ist gut. Kann ich später wiederkommen?«
»Komm wieder und rede mit mir … rede mit mir, Fielding … nach dem Adsum. Falls ich bis dahin mit dem hier fertig bin.«
»Und falls nicht?«
Christopher seufzte, sehr sanft.
»Dann komm trotzdem«, sagte er.
Prüfungen.
»Cum semel occideris, et de te splendida Minos
fecerit arbitria,
non, Torquate, genus, non te facundia, non te
restituet pietas.«
Wenn du einst tot bist und Minos sein hohes Urteil über dich gefällt hat, wird deine Herkunft nicht, Torquatus, all deine Beredtheit nicht – noch nicht einmal deine Tugendhaftigkeit selbst dich zurückbringen.
Ich hielt inne, daran erinnere ich mich, und ich dachte: Jetzt gilt es, jetzt sollen sie es aber wissen. Dann schrieb ich:
Diese Passage ist entscheidend. Selbst überzeugteste Moralisten würden Horaz ohne Weiteres zustimmen, dass weder eine hohe Geburt noch wohlgewählte Worte im Angesicht des Jüngsten Gerichtes der Seele Fürsprecher sein können. Doch dann holt der Dichter zu einem wahren Paukenschlag aus:
»… non te
restituet pietas.«
Nicht einmal die Tugendhaftigkeit selbst wird einem helfen. Es ist nämlich alles eitel: nicht nur Gold und Silber, nicht nur weltlicher Ruhm und Errungenschaften, sondern Pflichterfüllung, Glaube und Keuschheit ebenfalls. Der moralisch höchststehende Charakter kann einem keinen Vorteil unter den Schatten verschaffen.
Ich gab meinen Essay ab (so erinnere ich mich) und verließ den Raum. Es stand noch ein Jahresabschlussexamen aus, bei dem ich, mit etwas Glück, einen Preis oder zwei würde einheimsen können. Die Ergebnisse würden erst am letzten Tag des Schulquartals bekanntgegeben werden. Bis dahin waren sieben Tage abzuwarten, in denen nichts zu tun war, als sie zu genießen. Es waren ein Cricketmatch zwischen den altsprachlichen »Scholars« und dem Rest der Schule angesetzt, das Endspiel zwischen den einzelnen Häusern der Schule, die Boxkämpfe und die Schwimmwettbewerbe der Unterstufenschüler. Und andere sportliche Disziplinen? Die ganze Zeit schon seit Peters Warnung hatte ich Christopher mit neuen Augen gesehen. Es war möglich, dessen war ich nun fast gewiss. Und ohne ihm zu nahe zu treten? Ja – mein Körper war nichts, was bei ihm Anstoß erregte, das wusste ich, er war einfach nur nervös, weil es ihm noch nie vorher passiert war. Wenn ich den richtigen Augenblick wählen würde, es richtig angehen würde, würde alles bestens sein. Und ohne Skandal (insistierte Peters Stimme)? Niemand brauchte jemals etwas davon mitzubekommen. Und eines, vor allem, war sicher: Kein Maß an Keuschheit würde den vergehenden Sommer verlängern oder mich von den Schatten zurückbringen.
In dieser Nacht brach, endlich, das Unwetter los und klärte die Luft und den Himmel. Die Sonne trocknete am nächsten Tag die Cricketfelder für die Freundschaftsspiele, mit denen die Saison abgeschlossen wurde; und das Wetter war nun (oder so schien es zumindest) für alle Zeiten auf schön umgeschwenkt. Alle waren nun nicht mehr phlegmatisch und reizbar, sondern herzlich und heiter – außer Somerset Lloyd-James, der noch niemals auch nur eines von beidem gewesen war und in jedem Fall immer gerade über einem Problem brütete, das er zum bestehenden Zeitpunkt noch nicht offenbaren wollte.
Die Scholars gegen den Rest der Schule war als ganztägiges Match geplant. Alles andere als eine traditionelle Spielpaarung, hatte es diesen Wettbewerb bisher noch nie gegeben, und vor allem der Schulvorsteher (ein großer Cricketfan) hatte in diesem Jahr mit großem Engagement die Trommel dafür gerührt, denn er hatte eine ungewöhnlich große Zahl guter Spieler in seinen Latein- und Griechischklassen der Mittel- und Oberstufe. Angeblich hatte er zwei zu eins auf den Sieg der Scholars gewettet, gegen den Leiter der Unterstufe; ob das stimmte, habe ich nie herausgefunden, aber wenn, dann war die Quote angemessen, weil sich die Scholars zwar durch ein stilvolleres Auftreten und verheißungsvolle Zukunftsaussichten auszeichneten, ihnen aber ein Team gegenüberstand, das viel härter im Nehmen und viel erfahrener war und acht Mitglieder der Schulelf aufbot.
Am Morgen war das Spiel langweilig. Die Scholars, die zuerst am Schlag waren, trödelten und tüddelten eine geschlagene Stunde lang herum, nach der sie gerade einmal 30 Runs auf der Anzeigentafel vorweisen konnten und 3 Wickets verloren hatten. Zu diesem Zeitpunkt war ich selbst dran und schaffte es, mit zuverlässiger Unterstützung eines jungen Scholars namens Paget, über 50 weitere Runs in derselben Anzahl von Minuten reinzuholen – nur um dann, als ich gerade so richtig in meinem Element war, als Schlagmann auszuscheiden, weil ich einen derben Direktwurf schlecht erwischte und genau in die Hände von Christopher rüberspielte, der im Mid-On stand. Bald danach kamen die Spieler zum Lunch in den Pavillon. Der Stand war nun 120 für 5 bei uns Scholars – was, da uns der ebene Boden im Pitch eigentlich zugutekam, wie das schnelle Outfield auch, bestenfalls eine mittelmäßige Darbietung darstellte.
Der Lunch, inklusive einem Bierfass, wurde aufgetragen, und die beiden Pädagogen, die angeblich ihr Geld auf das Spiel gesetzt hatten, standen der Lunchgesellschaft vor. Das Essen war gut (nach damaligen Maßstäben), und um das Vergnügliche dieses Anlasses noch zu steigern, waren einige Gäste von Ansehen eingeladen worden, die kein Cricket spielten, darunter zwei externe Prüfer der Griechisch- und Lateinklassen, der Schuldirektor und, als herausragende »Persönlichkeit« der Schülerschaft, Somerset Lloyd-James, der neben mir saß. Er war schon immer ein gieriger Kerl gewesen, wenn sich die Gelegenheit bot, und so leerte Somerset nun rasch drei Krüge Bier und musterte mich dann mit dem glasigen Blick in seinen Augen, der (wie ich aus vierjähriger Erfahrung wusste) bedeutete, dass er auf Hilfe oder auf Informationen besonderer Art aus war.
»Es scheint wohl«, sagte er etwas schwerfällig, »dass der dickste Preis von allen entweder bei dir oder bei mir landen wird.«
»Was landet?«, sagte ich, leicht abgelenkt, weil ich gerade gesehen hatte, wie der Schulvorsteher im Gespräch mit einem der externen Prüfer mit dem Finger auf mich gezeigt hatte und ihm, einem redseligen, pummeligen Hausdirektor aus Oxford, nun etwas ins Ohr flüsterte.
»Das Amt des Schulkapitäns nächsten Sommer. Bis April ist es vergeben. Aber dann wird es entweder an dich oder an mich gehen.«
»Ach ja? Wo hast du das denn her?«
»Ich habe meine Quellen.«
»Warum müssen wir jetzt darüber reden? April ist ja noch ewig hin.«
»Ich dachte, du wüsstest es vielleicht gern.«
»Und vermutlich möchtest du nun im Gegenzug auch etwas wissen.«
Somersets Augen wurden glasiger als jemals zuvor.
»Ob du irgend…eine Meinung … dazu hast?«
»Also, ich werde dir die Krone nicht neiden, wenn sie auf deinem Kopf landet. Und ich hoffe, du siehst das bei mir genauso. Alles klar?«
Offenbar war es das, denn Somerset fing nun an, sehr schnell viel Essen in sich hineinzuschaufeln, und ich wurde in ein Gespräch mit dem oben am Tisch sitzenden pummeligen Oxforder Hausdirektor hineingezogen, der wissen wollte, wie meine Mitschüler auf den Fleming-Report zur Zukunft der Privatschulen reagiert hatten. Nachdem ich das so gut wie möglich hinter mich gebracht hatte, kam mir der seltsame Wortwechsel noch mal in den Sinn, den Somerset ach-übrigens-einfach-mal-so-aus-dem-Nichts-heraus angeleiert hatte, und wollte das Thema gerade wieder aufnehmen, als das untere Ende des Tisches in Aufruhr geriet. Der alte Frank, der am heutigen Tag als einer der Schiedsrichter fungierte, war über seinem Teller zusammengebrochen.
Der Schulvorsteher, unser Hauptgastgeber, übernahm sofort das Kommando. Ohne sich auch nur einen Daumenbreit von seinem Sitz zu erheben und nur in Form von leisen und knappen Anweisungen, die er den Umsitzenden gab (darunter dem Schuldirektor und dem Besucher aus Oxford), hatte er innerhalb von zehn Minuten festgestellt, dass Frank ernsthaft krank war, umgehend Beistand für ihn organisiert, einen Krankenwagen rufen und Frank überführen lassen, ein Privatzimmer im Hospital für ihn beschafft, Christopher beruhigt (mit dem der alte Gentleman gerade gesprochen hatte, als er zusammenbrach), alle überzeugt, dass es nun keinen Anlass zur Sorge mehr gab, und Somerset, der zwar nicht spielen, aber fachsimpeln konnte, zum Ersatzschiedsrichter ernannt. Ich war von dem Ereignis so bestürzt und zudem aufgekratzt, wenngleich mit schlechtem Gewissen, weil etwas Aufregendes passiert war, und so voller Bewunderung für das professionelle Handeln des Schulvorstehers, dass ich die merkwürdige Wendung, die das Gespräch mit Somerset genommen hatte, vollkommen vergaß (zumal mir das Thema nichts bedeutete und ich bloß neugierig war, wieso er es bei so unpassender Gelegenheit angeschnitten hatte) und einige Wochen lang nicht mehr daran dachte.
Nach dem Lunch verlief das Spiel für die Scholars besser, als wir zu hoffen gewagt hatten. Paget, ein stämmiger Fünfzehnjähriger, bekam drei lockere, bierschwere Bälle im ersten Over und konnte mit zwei sauberen Vierern und einem wunderschönen Sweep ins hintere Feld, der sechs Runs einbrachte, glänzen. Bevor das andere Team, vom Imbiss und dem beim Essen dargebotenen Drama noch ganz eingenommen, begriff, was passierte, hatte er vierzig schnelle Runs reingeholt, während sein Partner, ein schlaksiger und intelligenter Junge aus der Unterstufe, sich bei den sehr wenigen Bällen, die überhaupt bei ihm ankamen, wacker schlug und sie einfach blockte.
Nachdem so zwanzig Minuten vergangen waren (bei einem Stand von nun etwas über 160 für 5), wurden zwei schnelle Werfer aufs Feld geschickt, um das Ergebnis niedrig zu halten – und waren sogleich in jeder erdenklichen Form glücklos. Der schlaksige Junge (der »Funkler« Parkes genannt wurde, weil es seine Marotte war, das Licht in seinen Brillengläsern spielen zu lassen) ließ zwei gerade und mittig geworfene Bälle leicht über den Schlägerrand springen, so dass sie überraschend zwischen den Slip-Feldspielern hindurchschossen, und holte so vier; bei Paget, dem es nicht richtig gelang, mit einem Square Cut den Ball zu stoppen, ließen die Feldspieler auf der Gully-Position den Ball lässlich durch; und der bessere der beiden Werfer stolperte anschließend über seine eigenen Füße, verletzte sich dabei am Knöchel und wurde stöhnend vom Feld geschleppt. Aufgrund all dessen, aber auch der allgemeinen Unpässlichkeit, unter der die Spieler in Form von Schläfrigkeit, vollem Magen und Faulheit zu dieser Zeit am Nachmittag immer leiden, verfiel die Moral des Restschulteams wie eine vergammelnde Makrele. 175 für 5 … 180 … 190 … 195 … Das Ziel an so einem Tag war normalerweise 300 oder mehr, aber alles über 270 war heute schon mehr als zufriedenstellend, und bei allem über 230 würden wir zumindest mit dem Hauch einer Chance dastehen.
205 … 210 … und noch ein paar schneidige Runs von Paget. Aber nun, bei einem Stand von 224 für 5, wurde Peter Morrison eingesetzt.
Peter warf langsame Off-Breaks, bei denen er es jedesmal schaffte, dass sie immer in genau derselben Geschwindigkeit und im immerselben Winkel die Pitch verließen. Paget beschloss, nachdem er den ersten Off-Break spät und aus dem Standbein heraus weit übers Mid-Wicket hin geschlagen und so zwei Punkte gemacht hatte, mit dem nächsten Wurf genauso zu verfahren. Und da kam er, von Peter in der üblichen Art geworfen, in Peters üblicher Höhe, in Peters praktisch unveränderlichen Weite; und da war Paget, mit erhobenem Schläger und erwartungsvoll verharrendem Körper – um zu erleben, wie durch ein groteskes Nichteintreten der üblichen Naturgesetze der Ball, statt sich zu ihm hinzubewegen, direkt geradeaus weiterflog und mit einem traurigen Klack den äußeren Stab des Wickets traf.
226 für 6 – und ein besonders schönes Ergebnis, wenn man den Spielstand vor dem Lunch bedachte. Aber gar nicht mehr schön, nachdem unser nächster Schlagmann seinen zweiten Ball versehentlich so hochschlug, dass er gleich nebenan am Square Leg herunterplumpste, und der nachfolgende Spieler beim Versuch, sechs Punkte zu machen, durch einen brillanten Fang an der Long-On-Grenzlinie auch gleich ausschied. 226 für 8, und keiner unserer beiden letzten Spieler gehörte zu denen, die auch nur halbwegs fähig waren, einen Schläger richtig zu halten. In fünf Würfen (und zwar ausgerechnet denen von Peter) hatten wir unsere gute Position verloren und waren in eine Situation geraten, in der wir jeden Run, der sich herausholen ließ, brauchten.
Genau jetzt bewies Funkler Parkes, der schlaksige Junge, dass er nicht nur ein kluger Kopf, sondern auch ein echter Cricketspieler war. Nachdem unsere Nummer 10 irgendwie den letzten Ball von Peters Over überlebt hatte, sah sich Funkler einem recht guten Spieler der ersten Elf gegenüber, der mittelschnelle Leg-Cutter warf. Statt die ersten davon zu blocken oder durchzulassen, wie er es sonst während des bisherigen Spiels getan hätte, platzierte Funkler seinen rechten Fuß direkt vor seinem Wicket und ließ behende seinen Schläger zum Ball herabfallen, als dieser ankam, womit er ihn mitten durch die beiden Fänger auf der Slip-Position hindurchschickte und vier Runs holen konnte – einen so wahnsinnig späten Cut hatte ich selten gesehen. Der Werfer, der so einen Abwehrschlag für nicht wiederholbar hielt, warf noch zwei weitere Male auf genau dieselbe Art, und war ziemlich verärgert, als er denselben Schlag noch zwei Mal vorgeführt bekam. Den vierten Ball des Overs, der schneller war und auf die inneren Stäbe des Wickets zielte, parierte Funkler sehr entschlossen; aus dem fünften holte er dank eines verschlafenen Mid-On-Spielers einen kurzen Run heraus; und auch der sechste wurde von Nummer 10 wieder überlebt.
Nachdem er als Schlagmann jetzt Peters idiotische Würfe zu bewältigen hatte, denen er sich kräftemäßig nicht gewachsen sah, besann sich Funkler wiederum auf seine Intelligenz. Er stellte sich breitbeing direkt vors Wicket und kloppte den erwarteten Off-Break hinüber ins verlassene Fine Leg, eine Strategie, die ihm zwei Runs aus den beiden ersten Bällen einbrachte. Peter schickte daraufhin den Mid-Wicket-Spieler dorthin, um diesem Ärgernis ein Ende zu machen, woraufhin Funkler seinen Schlag kräftig auf die vorherige Mid-Wicket-Position lenkte und zwei weitere bekam. Auf diese besonnene Weise zwang er den Spielstand über die 240 hinaus auf 250 und noch einige Runs weiter, und wäre wohl immer noch am Schlag, ein kleiner Odysseus der Spielfeldmarkierungen, hätte sich nicht unser tölpelhafter Spieler mit der Nummer 10 vor einem leichten, kurzen Run am Ende eines Overs gedrückt und zu Beginn des nächsten dann das Feld verlassen müssen. Nummer 11 überlebte schmachvoll noch zwei weitere Bälle, dann war das Innings der Scholars mit einem passablen, aber alles andere als üppigen Ergebnis von 256 beendet.
Das Problem auf Seiten der Scholars war, dass wir keine verlässlichen schnellen Werfer hatten. Obwohl Paget den Ball für jemanden seines Alters ganz schön zackig hinüberschickte, konnte er allein mit der Geschwindigkeit kaum etwas gegen ausgewachsene Jünglinge ausrichten, auch machte er mit dem Ball nicht viel, weder in der Luft noch außerhalb der Pitch. Das übrige Bowling bestand vor allem aus mittelschnellen oder langsamen bis mittelschnellen Off-Breaks und In-Swingers, alle ohne irgendwelche Kniffe. Was jedoch alle unsere Werfer konnten, war, durchgängig die Wurfweite zu halten, und obwohl das Restschulteam es nicht schwer fand, so zu spielen, kamen sie doch nur langsam zu Punkten.