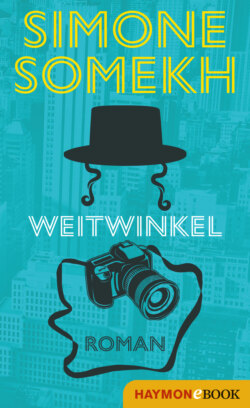Читать книгу Weitwinkel - Simone Somekh - Страница 6
ZWEI Beide auf der Suche nach einem Halt
Оглавлениеim Leben, hatten meine Eltern im letzten Jahr ihres Studiums am College von Brandeis beschlossen, sich der Religion zuzuwenden. Sie hatten sich im Haus des Rabbiners von Waltham, der der Chabad-Gruppierung angehörte, kennengelernt. Sie kamen jeden Freitag dort zusammen, bei Sonnenuntergang verließen sie den Campus der Universität, überquerten laufend die Gleise des Zugs, der Richtung Bostoner North Station fuhr, und betraten die kleine Villa des Rabbiners, wo sie gemeinsam mit Dutzenden anderen Studenten zum Abendessen blieben. Ich weiß nicht genau, was sie dazu brachte, einen Lebensweg anzustreben, der stärker von Religion geprägt war. Vielleicht sahen sie in den Lebens- und Verhaltensregeln, die die Orthodoxie in zwischenmenschlichen Beziehungen und in jener zu Gott vorschrieb, die Möglichkeit, ein sinnerfülltes Leben in Sicherheit und Ordnung zu führen. Vielleicht war es jenes Gefühl von Zugehörigkeit, das sie jedes Mal empfanden, wenn sie ihren Fuß über die Schwelle des Hauses des Rabbiners setzten, und das sie mit der Kraft der Bekehrung anzog, die dann auch rasch und unaufhaltsam erfolgte.
Nach dem Universitätsabschluss übersiedelten sie nach Boston und beschlossen, sich mit dem ultraorthodoxen Rabbiner von Brighton auf die Hochzeit vorzubereiten, wohin sie anschließend als junges Ehepaar zogen.
Der Prozess der Eingliederung in die Gemeinde zog sich ziemlich lange hin. Während der innig herbeigesehnte Erstgeborene auf sich warten ließ, wurden Mutters Röcke immer länger, und Vater bestieg während einer Arbeitsreise nach Manhattan den Zug nach Brooklyn, wo er seinen ersten schwarzen Borsalino erstand. Sie frequentierten mit großem Eifer die Gemeinde und schlossen eine solide Freundschaft mit dem Ehepaar Fischer, das bereits drei Söhne hatte und meine Eltern häufig zum gemeinsamen Sabbatmahl einlud. Ihr Haus füllte sich mit religiösen Büchern, und sobald sie genügend Geld gespart hatten, bauten sie die Küche um und unterteilten sie in zwei Hälften, eine für die fleischigen und eine für die milchigen Lebensmittel, jede mit eigenem Spülbecken und eigener Spülmaschine.
Als meine Eltern schon nicht mehr daran glaubten, ein Kind bekommen zu können, wurde Mutter schwanger. Die Freude über die Ankunft eines Kindes und der Stolz darüber, dass es ein Junge war, waren riesengroß; die Gemeinde scharte sich um sie mit einer Zuneigung, die weit über jenes „Masel tov!“ hinausging, mit dem man sich gewohnheitsmäßig beglückwünschte. Der kleine Ezra enttäuschte dann auch niemanden: Alle verliebten sich in mein pausbäckiges Gesicht mit den schwarzen Locken und den durchdringenden Augen.
Sechzehn Jahre später waren meine Eltern noch immer stolze Mitglieder der ultraorthodoxen Gemeinde – und das trotz mir. Zu ihrer Erleichterung verkroch ich mich täglich neun Stunden lang in der Nachmanides und verspürte kein Bedürfnis mehr, mich auf- und davonzumachen. Mutter und Vater hatten sogar widerwillig meine neue Art, mich für die Schule zu kleiden, akzeptiert, nämlich ohne schwarzen Hut und ohne Jacke, die ich zuvor sogar im Sommer getragen hatte.
Als der Rabbiner der Gemeinde neunzigjährig und mittlerweile ohne Bewusstsein starb und der Welt zwei Söhne, vier Töchter, achtundzwanzig Enkel und fünfundvierzig Urenkel hinterließ, übernahm sein erstgeborener Sohn trotz einiger Proteste seine Stelle. Viele waren der Ansicht, dass er nicht die Autorität des Vaters besaß. Er erwies sich jedoch als starke Persönlichkeit und ließ sich auch dann nicht einschüchtern, als er wegen einiger unwesentlicher, allerdings als zu offen erachteter Entscheidungen das Misstrauen der konservativsten Familien auf sich zog. Nach der Trauerzeit versetzte er die gesamte Gemeinde in Bestürzung, als er die Entscheidung des Rabbinischen Rates von Amerika unterstützte, zusätzlich zur traditionellen Ketubba einen verbindlichen vorehelichen Vertrag einzuführen. Dieser sollte eine der heikelsten Angelegenheiten innerhalb unserer Gemeinschaft regeln: zwischen Männern, die sich weigerten, den Scheidungsantrag der eigenen Frau zu unterschreiben, und Frauen, die in einer unerwünschten Ehe gefangen waren und keine neue eingehen konnten. Das religiöse Gesetz war in solchen Fällen machtlos, und der Rabbinische Rat hatte beschlossen, ein gesetzliches Dokument einzuführen, das die Ehemänner dazu zwang, den Frauen die Scheidung zu gewähren, sobald ein rabbinisches Gericht dies für angebracht erachtete.
Der Rabbiner Hirsch ließ nun alle Paare der Gemeinde, die heiraten wollten, einen solchen vorehelichen Vertrag bei einem Notar unterzeichnen. Die Mehrheit fühlte sich durch diese Veränderung gekränkt: Den Vertrag zu unterschreiben kam für sie dem Eingeständnis gleich, dass das jüdische Gesetz nicht ausreichend war und durch jenes des Staates ergänzt werden musste. Mutter hingegen war zutiefst beeindruckt von der Entscheidung des Rabbiners, ohne es sich groß anmerken zu lassen. Jedoch ließ sie es sich nicht nehmen, beim Abendessen ihrer Anerkennung Ausdruck zu verleihen, bei geschlossener Tür also und in Anwesenheit von mir und Vater, der darauf mit einem hässlichen und vulgären Gesichtsausdruck reagierte.
Freitagabend: Waffenstillstand. Ich war mit einem Ausgezeichnet in Trigonometrie heimgekommen, dachte aber gar nicht daran, das Ergebnis Mutter und Vater zu zeigen. Ich war erschöpft und froh, dass endlich der Sabbat begann. Mutter war gerade dabei, die Challot ins Backrohr zu schieben, die sie zuvor mit Eigelb bestrichen hatte, die Deli Rolls und auch den Apfel-Zimt-Kuchen, allesamt Gerichte, die sie jede Woche zubereitete und die Vater und ich zutiefst liebten.
„Gut Schabbes“, wünschte sie Vater und mir, als wir die Wohnung verließen und uns zur Synagoge aufmachten, die sich zwei Blöcke weiter befand. Nachdem wir gebetet und alle Männer der Gemeinde gegrüßt hatten, machten wir uns auf den Heimweg, unser gewohntes Schweigen einhaltend. Aus einem vorbeifahrenden Auto ertönte ein Disco-Song, den ich vom Handy eines Schulkollegen kannte, aber nie gewagt hätte zu Hause anzuhören.
Nachdem er den Segen über der Challa gesprochen hatte, teilte uns Vater mit, dass Frau Taub ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Binyomin Fischer hatte es ihm in der Synagoge erzählt.
„Was fehlt denn der Frau Taub?“, fragte ich und fügte, als mir niemand antwortete, ein leises „Mutter?“ hinzu.
„Sie hat ein schlimmes Leiden“, war ihre knappe Antwort.
Ein schlimmes Leiden … Ester Taub hat einen Tumor, dachte ich.
„Wird sie sterben?“, setzte ich nach.
„Ezra!“, brach es aus Mutter heraus.
„Ich frage ja nur. Ich möchte verstehen, wie schlimm es ist.“
„Ja“, ergriff Vater das Wort. „Es scheint ziemlich schlimm zu sein, aber sie wird sich erholen, so Gott will. Wir müssen nur für sie und für ihre leidgeplagte Familie beten.“
Angespanntes Schweigen breitete sich aus. Mutter betete, Vater fuhr fort, sich den Deli Rolls zu widmen, und ich dachte an die Familie Taub, eine der religiösesten der Gemeinde. Herr Taub verbrachte seine Tage mit dem Studium der Heiligen Schriften in der Synagoge, während seine Frau im Kindergarten unserer Gemeinde mitarbeitete. Wie viele Kinder sie wohl hatten? Sechs, sieben, acht? Alle mit rotziger Nase und schmutzigen Kleidern, weil ihre Mutter allzu sehr damit beschäftigt ist, fremden Kindern die Nase zu putzen, während der Vater sich vor lauter Bücherlesen die Augen ruiniert, dachte ich in einer Anwandlung von Boshaftigkeit.
„Nach dem Sabbat rufe ich Leah Fischer an und frage sie, wie wir Esters Mahlzeiten organisieren“, sagte Mutter.
„Ja, Binyomin hat etwas in diese Richtung angedeutet. Wir müssen auch klären, was mit ihren Kindern geschieht.“
Während ich die Teller in die Küche trug, warf ich einen Blick zum Fenster hinaus: Es hatte zu schneien begonnen. Nützlich? Nützlich, dachte ich. Ich hatte große Lust, ein paar Fotos vom verschneiten Brighton zu machen.
Gegen sechs, sobald der Sabbat beendet war, wickelte ich mich in meinen langen elektrik-blauen Schal, das einzige bunte Kleidungsstück, das ich besaß, lief hinaus auf die Straße, ohne die Tür hinter mir zu schließen, und warf mich ins Abenteuer. Die Stadt lag friedlich da, in eine Decke vermeintlicher Ruhe gehüllt, unter der ein Anflug von Schwermut lauerte. Mit unbändiger Lebenslust, die schon allzu lange darauf wartete, auszubrechen und die Welt zu entdecken, machte ich mich in die finsteren und verlassenen Straßen unseres Viertels auf, die Nikon unter dem Mantel versteckt.
Ich fotografierte gerade eine Kiefer, deren Äste von einer schweren Schneeschicht nach unten gedrückt wurden, als mir eine dunkle Gestalt entgegenkam.
„Ezra?“, rief sie fragend, und ich erkannte erst nach einer Weile, dass es der Rabbiner Hirsch war.
„Schalom“, grüßte ich und streckte ihm die Hand entgegen.
„Es freut mich, dass du nicht aufgehört hast, dich deiner Leidenschaft für das Fotografieren zu widmen“, sagte er. Mich überraschten seine Worte, kannte er doch sicher den Grund, weshalb ich von der Yeshiva High School verwiesen worden war. „Augenblicke dieses seltsamen Lebens, das uns von Gott geschenkt wurde, festzuhalten, ist eine vortreffliche Handlung.“
Dieser Satz gefiel mir. Vielleicht konnte der Rabbiner ein möglicher Freund und Verbündeter sein, erwog ich im Stillen.
„Danke, Rabbi“, antwortete ich und versuchte, jenen widerwilligen Ton zu vermeiden, den ich mittlerweile in den Gesprächen mit meinen Eltern anschlug. „Wohin sind Sie unterwegs?“, fragte ich neugierig.
„Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich war im Krankenhaus, Frau Taub besuchen.“ In seiner Stimme schwang tiefe Trauer mit. Ich hätte gern etwas unternommen, um ihm seinen Schmerz zu erleichtern, doch mir fiel nichts ein.
„Geht es ihr sehr schlecht?“
Es war kalt und dunkel, der Rabbiner nickte mit Nachdruck. „Ich überlasse dich wieder dem Fotografieren.“
„Ach, ich glaube, ich gehe jetzt auch heim.“
„Es gibt Dinge auf der Welt, die sich unserem Verstand entziehen“, bekräftigte der Rabbiner, bevor er sich entfernte. „Aber Gott hat einen Plan.“
Ob das Objektiv meiner Nikon wohl imstande war, diesen Plan einzufangen, denn mir gelang beim besten Willen nicht, ihn zu erkennen, ging mir auf dem Heimweg durch den Kopf.
Ich hatte mir zwischen den beiden Welten, jener der Gemeinde und jener der Nachmanides, eine Nische eingerichtet. Meine Klassenkameraden stellten nicht viele Fragen, wussten sie doch, woher ich kam und dass etwas schiefgelaufen sein musste, wenn ich nicht mehr die High School meiner Gemeinde besuchte. Ich hatte keine Freunde unter ihnen und fühlte mich oft unwohl. Ich war anders, sie waren anders.
Sie waren modisch angezogen, befolgten dabei allerdings einen Kleiderkodex, knielanger Rock und bedeckte Schultern bei den Mädchen, Hemd und keine Jeans bei den Jungs. Die Klassen waren gemischt, auch wenn kein Junge und kein Mädchen es je gewagt hätten, einander in Anwesenheit einer Lehrperson zu berühren. Das Niveau der säkularen Studien war höher als in der Yeshiva High School, jenes der jüdischen allerdings niedriger. Am Morgen versammelte man sich in der Synagoge der Schule, um zu beten, mit dem einzigen Unterschied, dass dort die Mädchen auf der anderen Seite der Mechiza saßen.
Nach geraumer Zeit begann ich, mit einigen in der Klasse mehr Kontakt zu haben. Sie wandten sich an mich mit Fragen, die ich als verbohrt und aufdringlich empfand.
„Stimmt es, dass die Frauen deiner Gemeinde abgesondert leben?“, fragte mich eines Tages ein Junge namens Adam.
„Nein“, gab ich zur Antwort und entfernte mich.
Es stimmte tatsächlich nicht. Die Frauen meiner Gemeinde waren nicht abgesondert. Es waren aktive Frauen, die oft sehr energisch und mit größerem Einfluss am Leben der Gemeinde teilnahmen als ihre Ehemänner. In einigen Familien waren es die Frauen, die das Familieneinkommen bestritten. Während die Männer ihre Tage mit dem Studium verbrachten, waren sie es, die die wichtigsten Entscheidungen trafen, sich um das Haus kümmerten und das Familienleben am Laufen hielten. Von außen betrachtet mochten sie vielleicht geplagt, schwach und stumm erscheinen, aber in Brighton hätte ich nie diese Wörter verwendet, um die ultraorthodoxen Frauen zu beschreiben.
Beim Mittagessen kam Adam an meinen Tisch, um sich zu entschuldigen.
„Es tut mir leid wegen vorhin, ich wollte dich nicht beleidigen.“
„Du hast mich nicht beleidigt“, antwortete ich kurz angebunden.
„Ich habe mich schlecht ausgedrückt. Ich meinte nicht ‚abgesondert‘. Ich wollte … ich wollte damit sagen, dass sie weniger Entscheidungsgewalt über ihre Zukunft haben. Sie wissen von klein auf, dass sie heiraten und Kinder kriegen müssen, dass das ihr Leben sein wird.“ Adam schaute mich eindringlich an in der Hoffnung, dass ich mich nicht wieder umdrehte und ging.
„Warum? Können denn die charedischen Männer Entscheidungen über ihr Leben treffen?“, entgegnete ich. „Auch sie wissen schon als Kinder, dass sie heiraten und Kinder machen müssen, und dass das ihr Leben sein wird.“
Dem entgegnete Adam nichts mehr.
Abends im Bett gingen mir seine Worte durch den Kopf. Ich hatte ihn zum Schweigen gebracht, dachte ich zufrieden. Dennoch konnte ich nicht aufhören mich zu fragen, ob ein Teil seiner Worte nicht doch der Wahrheit entsprach. In meiner Welt waren die Frauen genauso Gefangene wie die Männer. Der Unterschied lag darin, dass ihnen im religiösen Leben eine gänzlich säkulare Rolle zugeschrieben wurde. So war es ihnen nicht erlaubt, dieselben Schriften wie die Männer zu studieren. Sie durften nicht an den religiösen Riten und Ämtern in der Synagoge teilnehmen, sondern diesen nur hinter der Mechiza beiwohnen. War es das gewesen, was Adam mit „abgesondert“ ausdrücken wollte?
Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als jemand schnellen Schrittes die Treppe hinunterlief. Es musste Vater sein. Vom unteren Stock drangen Stimmen herauf, vielleicht sprach er mit jemandem am Telefon.
Ich hörte die Schlafzimmertür meiner Eltern aufgehen und Mutter heraustreten. Ich öffnete die Tür meines Zimmers einen Spalt breit und lauschte.
„Wir gehen jetzt los“, sagte Vater am Telefon. „Fünf Minuten und wir sind da.“
Ich warf einen Blick auf die Uhr: Es war viertel vor zwölf, bald Mitternacht. Ich öffnete die Tür ganz und ging die Treppen hinunter. Mutter war dabei, sich Mantel und Schuhe anzuziehen, während Vater bereits fertig zum Gehen war.
„Wohin geht ihr?“, fragte ich.
„Ezra“, sagte Mutter traurig, „Frau Taub ist gestorben.“
„Baruch Dayan Emet“, flüsterte ich.
Meine Eltern verabschiedeten sich von mir und machten sich zu den Taubs auf, wo wohl, so stellte ich mir vor, die Totenwache stattfand.
Ich setzte mich auf den Diwan, erleichtert, nicht mitgehen zu müssen. Ich wollte nicht sehen und nicht wissen. Wollte nicht gezwungen sein, über das Geschehene nachzudenken.
Zehn Minuten später war mir allerdings klar, dass es klüger gewesen wäre mitzugehen. Es war nach Mitternacht, ich war allein im Haus und würde nicht so schnell wieder in mein Zimmer gehen und einschlafen können. Ich hatte das Bild der toten Frau Taub vor Augen, die ausgestreckt auf einem Krankenhausbett lag, schauerlich und furchterregend, und der Gedanke an ihre Kinder, die fortan keine Mutter mehr hatten, beunruhigte mich zutiefst. Sie würden nie mehr mit ihr sprechen, ihr nie mehr einen Kuss geben oder von ihr zubereitete Speisen essen können. Oder vielleicht war etwas im Tiefkühlschrank zurückgeblieben, aber sie würden es nicht anrühren, bestürzt vom Gedanken, den letzten konkreten Beweis der Existenz ihrer Mutter aufzuessen. Bevor mich meine Gedanken an noch schlimmere Orte führen konnten, schlief ich auf dem Sofa ein.
„Ester Taub war eine beeindruckende Frau. Geboren in Brighton, verheiratet in Brighton, gestorben in Brighton, war sie eine der treuesten und leuchtendsten Seelen unserer Gemeinde. Ester war für uns alle eine Säule. Sobald ein Kind geboren wurde, war sie die Erste, die das Haus des Neugeborenen mit einer Auflaufform voll Reis, Huhn und Kartoffeln aufsuchte, damit die Familie zu essen hatte, solange die Mutter sich erholen musste. Wenn ein Alter erkrankte, war sie es, die als Erste die Zeit fand, ihm Gesellschaft zu leisten, notfalls in Begleitung ihrer Kinder, möge Gott sie segnen. Ester hat uns nie mit Worten belehrt, sondern immer mit Taten, und war so in ihrer Demut ein Vorbild für alle Frauen unserer Gemeinde. Genauso wie in der biblischen Erzählung von Ester, der Königin von Persien, war unsere Ester bis zu ihrem Tod ein Beispiel an Kraft für das jüdische Volk, der Gemeinde treu und der Familie ergeben, auch dann noch, als die Krankheit ihr die ersten Schläge zufügte. Wir erinnern uns an Ester mit einem Lächeln auf den Lippen. Wir erinnern uns an sie als eine Quelle des Segens, die dazu beigetragen hat, unserer Gegenwart mehr Glanz und unserer Zukunft mehr Beständigkeit zu verleihen, in Erwartung, sie wieder in die Arme schließen zu können, sobald der Messias erscheinen wird. Amen.“
„Amen“, wiederholten die Anwesenden im Chor.
Neben dem Rabbiner Hirsch, der soeben gesprochen hatte, stand Herr Taub, ein Skelett mit dunklen Ringen unter den traurigen Augen. Neben ihm die Kinder mit tränenüberströmten Gesichtern. Ich zählte sie: Es waren sieben. Shmuel, Carmi, Nechama, Tuvia, Ayala, Sheyna und die kleine Rivki, die wohl gerade einmal zwei Jahre alt war.
Auf dem Weg zum Friedhofsausgang holte mich der Sohn von Binyomin Fischer ein. Er hieß Dani, lebte in Brooklyn und war vor kurzem Vater eines zweiten Kindes geworden.
„Wie geht es dir, Ezra?“
„Danke, gut.“
„Meine Frau und ich denken oft an dich, wegen der Fotos. Ich bin dir noch immer sehr dankbar dafür.“
„Keine Ursache.“
Wir gingen gemeinsam weiter. Dani war mir nie besonders sympathisch gewesen, doch jetzt spürte ich, dass er ernsthaft etwas mit mir besprechen wollte.
„Es ist schon ein Weilchen her, dass ich dich gesehen habe.“
„Nun ja, du lebst in Brooklyn“, gab ich ungeduldig zurück.
„Ja, das stimmt. Und du gehst auch nicht mehr auf die Yeshiva, falls ich nicht irre, oder?“
Aha. Das war es also. Ich begann zu verstehen, worauf er hinauswollte. Ich schaute ihn schief an und hoffte, dass das ausreichen würde, um die Botschaft ankommen zu lassen: Ich habe keine Lust darüber zu reden, und schon gar nicht mit dir. Doch Dani Fischer ließ nicht locker.
„Wie ist sie denn so, die … Schule?“
„Die Nachmanides, meinst du?“, sagte ich und sprach den Namen der Schule überdeutlich aus.
„Ist sie sehr … liberal?“
„Ich weiß nicht, was du unter liberal verstehst.“
Dani seufzte tief und ich hoffte, dass damit unser Gespräch zu Ende war.
„Was für eine Tragödie“, fuhr er fort und kam auf den Tod von Frau Taub zu sprechen, „wirklich, eine Tragödie.“
Ich beschränkte mich auf ein zustimmendes Nicken.
„Tragödien wie diese erinnern uns daran, dass uns nichts sicher gegeben ist. Wir müssen den anderen immer das Beste von uns geben, vor allem unseren Eltern, denn einen Augenblick sind sie hier, im nächsten hingegen, wer weiß.“
Ich blieb abrupt stehen. Tragödien wie diese lehren uns, nur dann zu sprechen, wenn man etwas Sinnvolles zu sagen hat, dachte ich bei mir, blieb aber still. Ich nickte noch einmal und entfernte mich mit einer unerklärlichen Wut im Bauch.
Dieses ganze Gespräch hatte nur dazu gedient mir zu sagen, dass ich darauf achtgeben solle, wie ich mich meinen Eltern gegenüber verhielt. Auch sie konnten, wie Frau Taub, sterben, und dann wäre es zu spät, die begangenen Fehler wiedergutzumachen. Vielleicht war Dani von Binyomin Fischer geschickt worden, dachte ich, und dieser wiederum von meinem Vater. Nur zu, benutzt den Tod einer armen Frau, um das Gehirn des kleinen dummen Ezra Kramer auf Vordermann zu bringen, welch bessere Gelegenheit gab es dafür als diese? Idioten, dachte ich. Idioten und noch mal Idioten. Sie gaben mir immer das Gefühl, rebellisch zu sein. Plötzlich verspürte ich den Wunsch, etwas Extremes, Skandalöses zu tun, das ihnen zumindest die Berechtigung gab, mich wie einen Rebellen zu behandeln.
Ich begann nach Hause zu laufen und rastete bald schwitzend und keuchend auf einem Mäuerchen aus. Vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht zu sterben, dachte ich, so wie es Frau Taub gemacht hatte. Ich hatte keine sieben Kinder, die ich in der Welt zurücklassen würde, es wäre also ein Leichtes für mich, und nützlich. Ich würde mir einige Mühen ersparen, keine Streitereien mit meinen Eltern mehr, keine Zweifel, keine Entscheidungen, nur eine lautlose Dunkelheit, die mich umhüllen und nach und nach von den Haaren bis zu den Zehenspitzen verschlingen würde.
Die darauf folgende Woche war für alle sehr anstrengend. Der Gedanke an den schluchzenden Shmuel Taub erschütterte mich noch immer. Mutter vergoss ihre Tränen, und Vater, der uns seine Liebe nicht mit Worten zeigen konnte, brauchte sein ganzes Repertoire an Grimassen auf, um sich dadurch erst recht in beklommenem Schweigen zu isolieren. Er war nie imstande gewesen, seine Gefühle auszudrücken, und in Situationen wie diesen zeigte er sich von seiner schlechtesten Seite.
Obwohl wir nie in engerer Verbindung mit der Familie Taub gestanden waren, ließ uns der Tod von Ester zutiefst betroffen zurück. Als Vertreter des konservativsten Flügels der Gemeinde hatten die Taubs meine Eltern seit jeher argwöhnisch beäugt, als warteten sie nur darauf, sie beim ersten falschen Schritt auf frischer Tat zu ertappen. Weil diese nicht religiös geboren und aufgewachsen waren, trauten sie dem Glauben meiner Eltern nicht. Ich konnte mir ihre mangelnde Wertschätzung nicht erklären. Die Entscheidung, orthodox zu leben und damit ein Leben ohne Verbote aufzugeben, war ein dermaßen mutiger Schritt, dass der Zweifel am Glauben jener, die ihn vollzogen, reinem Irrsinn gleichkam.
Eines Abends schaute Frau Fischer bei uns vorbei, um einige Klappstühle zurückzubringen, die sie sich für das Sabbatmahl mit Verwandten aus New York geborgt hatte.
„Ayala Taub wird die nächste Zeit bei uns leben“, verkündete sie.
„Die arme Kleine“, beeilte sich Mutter zu sagen. „Wie geht es ihr denn?“
„Sie ist wunderbar, eine Blume, möge Gott sie so bewahren. Sie spricht kein Wort. Ich habe angeboten sie aufzunehmen, bis sich ihr Vater erholt hat.“
„Falls es nötig sein sollte, können auch wir eines der Kinder aufnehmen. Wir haben zwar nicht viel Platz, aber du weißt, wie glücklich wir uns schätzen würden, ihnen zu helfen.“
„Ich weiß, ich weiß. Sie sind gerade dabei, alles zu organisieren, und ich bin mir sicher, dass sie an euch herantreten werden, sollte es notwendig sein.“
Als Frau Fischer gegangen war, wandte sich Mutter an meinen Vater. „Was glaubst du, warum haben sie uns nicht gefragt?“, und fuhr fort, da sie von ihm keinerlei Antwort erhielt: „Morgen, wenn du den Rabbiner Hirsch siehst, könntest du ihm ja unsere Bereitschaft mitteilen.“
Doch auch der Rabbiner Hirsch sagte nichts anderes als Frau Fischer – falls es nötig sei, würde man sich an sie wenden. Und so vergaßen meine Eltern die Angelegenheit und schauten zu, dass sie ihr Leben bis zum Monatsende weiterbrachten.
Ich hatte begonnen, mich neben Adam Sachs zu setzen. Mit der Zeit kamen wir auf alles Mögliche zu sprechen, und nach und nach beantwortete ich die Fragen, die ich bis vor kurzem als aggressiv und unpassend empfunden hatte.
Adam war um einiges größer als ich und hatte schwarze, glatte Haare. Er trug meistens weiße Polos und war nicht gerade ein brillanter Schüler. Es war mir ein Rätsel, wie er es in Trigonometrie in den Fortgeschrittenenkurs geschafft hatte. Oft musste ich ihm die Aufgaben noch einmal erklären, obwohl es bereits der Lehrer im Unterricht ausführlich getan hatte.
Mir war klar geworden, wie bequem und wichtig es war, einen Schulfreund zu haben. Jemanden, auf den man zurückgreifen konnte, wenn man fehlte, mit dem man gemeinsam Mittagessen konnte und quatschen, wenn einem fad war. Nachdem ich ihn eine Zeitlang beobachtet und festgestellt hatte, dass er ruhig und freundlich, aber ohne Freunde war, fragte ich: Nützlich?, und gab mir selbst die Antwort: Nützlich. Und so begannen wir einander als Freunde zu betrachten, obwohl mich seine Berechenbarkeit und seine zumeist unkritische Haltung bisweilen nervten. Er war ein guter Junge, aufgeschlossen und in sich ruhend. Die Hauptsache aber war, dass er keinen Wert darauf legte, wie ich mich kleidete. Seine Eltern hatten sich getrennt, als er und seine Schwester die Middle School besuchten. Die Trennung war ziemlich kompliziert verlaufen. Beide besaßen Geld wie Heu, und hätten sie Anwälte hinzugezogen, wäre alles noch viel komplizierter geworden. Sie hatten sich jedoch bemüht, als erwachsene Menschen zu handeln, ließen etwas Zeit verstreichen, damit sich die Situation beruhigen konnte, und lebten anschließend ohne Scheidung und möglichst ohne große Gefühle weiterhin unter demselben Dach.
Eines Tages kam Adam auf mich zu, während ich ein Buch aus meinem Spind holte, und fragte mich: „Gehst du heute auf die Grillparty von Elisha Katz?“
„Welche Grillparty?“, antwortete ich.
„Die bei ihm zu Hause stattfindet, heute Nachmittag. Gehst du nicht?“
„Ich glaube nicht, dass ich eingeladen bin.“
Adam blieb der Mund offen, sein Blick war traurig und verlegen. Er versuchte gar nicht erst einzuräumen, dass es sich vielleicht um ein Versehen handelte, denn es war glasklar, dass Elisha Katz mich nicht eingeladen hatte, weil ihn meine Zugehörigkeit zur ultraorthodoxen Gemeinde abstieß. „Das tut mir leid“, war alles, was er herausbrachte.
„Macht nichts“, beeilte ich mich zu sagen. „Es ist nämlich so, dass mir meine Eltern wohl gar nicht erlaubt hätten, zu Hause bei Elisha Katz zu essen.“
Dabei wollte ich „So eine Scheiße“ sagen. Doch spürte ich gleichzeitig, dass es mir ziemlich egal war, denn ich hatte mit diesen Leuten so gut wie gar nichts gemein. Ich blieb tausendmal lieber allein zu Hause, als einen Nachmittag lang den Versuch zu unternehmen, mich in eine Gruppe einzufügen, in der ich von vornherein keinen Platz hatte. Mich machte nicht die ausgebliebene Einladung traurig, sondern der aufrichtig niedergeschlagene Gesichtsausdruck Adams.
„Wir können zusammen etwas unternehmen, wenn du Lust hast“, sagte er schließlich.
Es war das erste Mal, dass wir gemeinsam den Nachmittag verbrachten. Unmittelbar nach Schulschluss gingen wir nach Brookline zu ihm nach Hause. Da ich kein Handy besaß, konnte ich meine Eltern nicht darüber informieren, beschloss jedoch, dass sie es überleben würden, auch wenn sie es nicht wussten.
Im Wohnzimmer stand ein riesiger Plasmafernseher. Ich fragte Adam, was er und seine Familie so schauten.
„Wir schalten ihn am Abend ein, während wir das Abendessen zubereiten. Manchmal schauen wir Nachrichten, aber hauptsächlich so alte Serien wie Immer wieder Jim oder Friends, weißt du. Meine Eltern wollen nicht, dass wir MTV oder so Zeug schauen, sie sagen, dass die Sendungen dort zu explizit sind.“
„Was ist MTV?“
„Wie bitte? Das meinst du wohl nicht im Ernst. Weißt du echt nicht, was MTV ist?“
„Ich habe keinen Fernseher zu Hause.“
Adam ließ einen Pfiff los, um seinem maßlosen Erstaunen Ausdruck zu verleihen, das in etwa bedeuten sollte: Ich wusste, dass ihr verrückt seid, aber so? Er versuchte mir von Sendungen wie Pimp My Ride oder Skins zu erzählen, von den Dokumentarfilmen von National Geographic und von Jersey Shore, einer Realityshow, in der Italo-Amerikaner einen Sommerurlaub in New Jersey verbrachten und an den Abenden in eine Diskothek namens Karma gingen. Adam erklärte mir, dass das die Art von Fernsehprogramm war, die er nur in Abwesenheit seiner Eltern schaute, und ich dachte mir, dass ich Besseres mit meiner Zeit anzufangen wusste, als einem Grüppchen vulgärer Menschen bei ihren Discobesuchen zuzuschauen.
„Schau, das ist The Situation, einer der Protagonisten, weißt du.“ Er hielt mir sein iPhone hin und zeigte mir das Foto eines glattrasierten und gebräunten Muskelprotzes. Erst jetzt fiel mir auf, wie oft Adam „weißt du“ sagte, was mich ziemlich nervte. „Nein, ich weiß nicht“, wollte ich erwidern.
„Er lässt sich mit Wachs enthaaren und geht ins Solarium, aber er ist nicht schwul, weißt du, das ist das Komische an der Sache.“
„Schwul?“, fragte ich.
„Ja, weißt du, meistens sind es ja die Schwulen, die diese ganzen Schönheitsprozeduren machen, aber …“, Adam unterbrach sich, „du weißt doch, was das bedeutet, oder?“
„Ich habe das Wort in der Schule gehört, aber ich weiß nicht genau, was …“, sagte ich etwas verärgert, ohne den Satz zu Ende zu führen.
Zwischen dem einen „Weißt du“ und dem nächsten erklärte er mir, dass „schwul“ homosexuell bedeute, was wiederum ein Ausdruck für Menschen sei, die sich zu Personen desselben Geschlechts hingezogen fühlten. Männer, die sich in Männer verliebten, Frauen, die in Frauen verliebt waren. Plötzlich erinnerte ich mich an ein Gespräch zwischen Mutter und Vater, das ich, mein Ohr an ihre Schlafzimmertür gepresst, mitangehört hatte. Es war von einem Rabbiner die Rede gewesen, der von der Yeshiva, an der er unterrichtete, verwiesen worden war, weil er einige Jungen zur gemeinsamen Ausübung verbotener Praktiken verführt hatte.
Hier nun, in Adams Wohnzimmer, verwunderte es mich, dass er von „Liebe“ sprach, hatte ich es mir doch angewöhnt, solche Handlungen als sexuelle Perversionen zu betrachten, als einen verabscheuungswürdigen Wunsch nach etwas, was sonderbar und verboten war. Adam hingegen sprach von verliebten Menschen, die heiraten und Familien gründen wollten.
„In meiner Gemeinde spricht man nicht viel darüber, aber man schweigt es nicht tot. Einmal hat ein Rabbiner sogar einen Vortrag über Homosexualität im Judentum gehalten“, sagte er. „In deiner hingegen ist es wohl ein Tabu.“
„Ich glaube, darin liegt der Unterschied zwischen deiner und meiner Gemeinde“, erwiderte ich. „Ihr mögt vielleicht die Richtung, in die sich die Gesellschaft entwickelt, nicht gutheißen, aber ihr sprecht doch darüber und versucht, einen Bezug zur Religion herzustellen. Das ist ein wenig widersprüchlich, wenn du es genau betrachtest. Bei uns, wenn etwas von der Religion verboten ist, spricht man nicht darüber und aus. Außerdem bedeutet die Tatsache, dass etwas von der modernen Gesellschaft akzeptiert ist, noch lange nicht, dass es auch moralisch richtig ist.“
„Mir kommt das Verhalten deiner Gemeinde widersprüchlicher vor. Ob ihr wollt oder nicht, wir leben in dieser Welt. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und weiter so tun, als ob die Dinge da draußen sich nicht verändern.“
Es war das erste Mal, dass Adam seine Meinung äußerte. Das war befreiend und brutal zugleich, für ihn wie für mich. Zwischen all diesen „Weißt du“ gab es also einen Kopf, der dachte.
Darauf fiel mir nichts ein. Unversehens fand ich mich auf der anderen Seite der Debatte wieder, auf jener, die verteidigte, und nicht auf jener, die angriff. Es erschien mir absurd, einen Lebensstil zu verteidigen, den ich seit jeher verachtete. Mir wurde schlagartig bewusst, wie befremdlich ich von außen betrachtet wirken musste. Ich äußerte mich zwar kritisch, klammerte mich aber weiterhin an das, was mir von klein auf beigebracht worden war. Nie würde ich den Mut aufbringen, meine Gemeinde zu verlassen. Meine Zugehörigkeit zu jener Welt lief durch meine Venen. Weglaufen würde bedeuten, sie sich aufzuschneiden, eine nach der anderen, um schließlich zu verbluten. So war ich zwar von der Yeshiva High School abgegangen, kleidete mich aber noch nach den ultraorthodoxen Vorschriften. In meiner Klasse rasierten sich die Jungs die ersten Barthaare, ich hingegen ließ sie wachsen. Ich fand sie schrecklich, so spärlich und dünn, wie sie sprossen, und hasste sie aus ganzem Herzen. Doch hätte ich es nie gewagt, sie abzuschneiden. Mein Vater hatte Glück gehabt: Er war in der Welt draußen großgeworden und hatte sich über fünfzehn Jahre lang jeden Tag rasiert, bevor er sich den Bart wachsen ließ, der nun dicht und struppig war.
Als ich am Abend nach Hause zurückkehrte, fand ich meine Eltern niedergeschlagen neben dem Telefon sitzend vor. Doch es war nicht eine Nachricht von mir, auf die sie gewartet hatten.