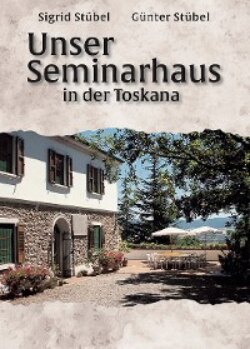Читать книгу Unser Seminarhaus in der Toskana - Stübel Sigrid und Günter - Страница 6
Оглавление1. Der Traum vom Seminarhaus
1.1 Die Geburt des Traumes
Wir waren kurz davor, unseren Traum zu verwirklichen. Wir, das waren meine Frau Sigrid und ich und unser Freund Michael, sowie dessen Freunde. Der Traum war, ein Seminarhaus ins Leben zu rufen, in dem Themen, die über das Alltagsleben hinausgehen, für interessierte Gruppen bearbeitet werden sollten. Unser gemeinsames Vorbild war die Akademie am Meer auf der Insel Sylt.
Dem dramatischen Moment im Mai 1980, an den ich mich sehr genau erinnere, gingen bestimmt 50 oder mehr Treffen voraus, bei denen wir unsere Pläne konkretisierten. Die Ideen fanden in einem 30-seitigen Grundsatzprogramm ihren Niederschlag. Dort waren Themen, Inhalte, mögliche Referenten, Orte und Ziele so genau festgehalten, dass wir sofort hätten starten können, sobald wir den geeigneten Ort gefunden hätten.
1.2 Schloss in St. Dié
Wir einigten uns auf ein Anwesen mit vielen Zimmern, einer ansehnlichen Umgebung und mit überschaubaren Kosten. Da boten sich die zahlreichen Schlösser, die damals auf dem Markt waren, an. Tatsächlich fanden wir auch unser Schloss in den Vogesen in St. Dié.
Ein eindrucksvolles Gebäude mit 60 Zimmern und einem traumhaften Park. Nachdem vorher Erkundigungen Einzelner zur Zufriedenheit stattgefunden hatten, trafen wir uns, wild entschlossen zum Kauf, auf dem Schloss. Wir hatten einen Notartermin am Nachmittag vereinbart und verbrachten den Vormittag mit der Bewunderung des Schlosses und seiner Umgebung.
Wir hatten uns auf die Reise nach Frankreich richtig gefreut und meinen Schwiegervater, der Frankreich sehr liebte, mitgenommen. Da er schlecht zu Fuß war, lieferten wir ihn in der Dorfkneipe mit dem Versprechen ab, ihn spätestens um 17.00 Uhr wieder abzuholen.
Es war Frühlingszeit und die ersten Tulpen und Narzissen verbreiteten bei unserer Ankunft im Park einen leuchtenden Glanz. Beeindruckend waren die großen Gesellschaftsräume des zukünftigen Seminarhauses, in denen wir schon unsere Gäste im Kreis sitzen sahen. Der offene Kamin verhieß eine gemütliche Atmosphäre. Wir konnten auch die Luftheizung, die mittels Luftröhren für angenehme Temperaturen in den Räumen sorgen sollte, unter die Lupe nehmen. Da bekamen wir schon großen Respekt vor unserer Aufgabe. Denn der Hausmeister war gerade dabei, ganze Baumstämme in den riesigen Ofen zu stecken, um die Räume dem noch etwas kühlen Frühlingstag anzupassen. Einerseits eigneten sich die Zimmer geradezu ideal für die Übernachtungsbedürfnisse unserer Seminarteilnehmer, andererseits ahnten wir schon, welche Anstrengungen sich hinter der Instandhaltung des Gebäudes verbargen. Guten Mutes verließen wir uns aber auf unsere Pläne.
Wir hatten ja im Kopf, dass viele freiwillige Helfer kommen würden, wie wir es z.B. vom Esalen-Institut in Big-Sur, Kalifornien, was ebenfalls unser Vorbild war, kannten. Die Gerüche aus der Küche ließ uns das Wasser über die französischen Köstlichkeiten, die wir unseren Gästen servieren wollten, im Mund zusammenlaufen. Der Blick über den Rasen vor dem Eingang lud zu einer Meditation im Freien ein und das lebhafte Vogelgezwitscher vollendete den Eindruck der unversehrten Natur.
Wir versicherten uns bei der kleinen Zusammenkunft noch einmal unseres Glückes, das Richtige gefunden zu haben. Die eine Million DM Kaufpreis für das Schloss und den Park können wir stemmen, da jeder ja nur 100.000 DM einzubringen hatte. Das stellte eine Größenordnung dar, die für dieses Prachtstück angemessen war. Schließlich gab es auch einen Business-Plan, aus dem sich die Rendite für eventuelle Zinsbelastungen und den nötigen Unterhalt ergaben.
1.3 Beim Notar
Nach einem kleinen Vesper mit mitgebrachten Kleinigkeiten machten wir uns auf den Weg zum Notar. Der Termin war auf 15.00 Uhr vereinbart. Das Büro befand sich inmitten des mittelalterlichen Ortes St. Dié in Lothringen in einem historischen Gebäude. Es roch beim Eintreten etwas nach Geschichte, aber es verstärkte nur das Gefühl der Feierlichkeit des Augenblicks. Der Notar war ein freundlicher, alter Herr, der die klassische Welt des historischen Augenblicks repräsentierte, in dem die ehrwürdigen Steine in unsere Hände übergehen sollten. Unser Gegenüber war leider nicht der adlige Graf, dem das Anwesen bisher gehörte, sondern ein unscheinbarer Rechtsanwalt, der sich laut Vollmacht als derjenige auswies, der zum Verkauf berechtigt war. Der Notar sprach als Lothringer ein perfektes Deutsch, was die Verhandlungen sehr erleichterte.
Kurz bevor er mit der Verlesung des Kaufvertrages begann, meldete sich Peter zu Wort. Sein Hüsteln durchbrach die angespannte Stille und führte mitten in unserer freudigen Erwartung zu einer ungeduldigen Anspannung. „Ich habe mir noch eine kleine Ergänzung zum Kaufvertrag überlegt“, begann er seinen Einwurf. „Ich habe von meiner Großmutter einen tollen Marmortisch aus dem 18. Jahrhundert geerbt. Der würde super in das östliche Eckzimmer mit dem Erker passen. Ihr habt doch sicher nichts dagegen, wenn ich den dort passend zur übrigen alten Einrichtung einbringen würde. Natürlich müssten wir das Zimmer dann abschließen und vor den Gästen schützen.“ Der kurze Einwand verschlug mir die Sprache und auch von den Anderen kam zunächst kein Kommentar, sondern es herrschte nachdenkliches Schweigen.
Auf einen Schlag redeten jedoch alle im Beisein des Notars und des Verkäufers durcheinander. „Das geht ja gar nicht!“ warf Michael mit empörtem Ton ein. „Wie aus meinem Grundsatzprogramm hervorgeht, dem ihr alle zugestimmt habt, wollen wir ein offenes Haus haben, in dem sich jeder frei bewegen kann. Das entspricht auch dem Geist, den wir mit unseren Veranstaltungen vermitteln wollen.“ Ähnlich äußerten sich auch zwei oder drei aus unserer Runde. Diese hatten aber nicht mit den engen Bindungen der Übrigen zu Peter gerechnet. Sehr heftig wurden Peters Ansprüche verteidigt. „Wenn es nicht möglich ist, ganz wenige private Lieblingsgegenstände in den Räumen unterzubringen, dann mache ich auch bei dem Projekt nicht mit. Wir sind ja nicht in einer kommunistischen Kommune, bei der Individualität nicht mehr gefragt ist“ - das war der Tenor der Gegner des Grundsatzprogrammes, das Michael verteidigte. Nach kurzem Nachdenken gaben meine Frau und ich Michael recht und wir verteidigten die offene Gesellschaft. Es war erstaunlich wie heftig die Argumente wegen dieses Marmortisches ausgetauscht wurden. Persönliche Angriffe vor allem auf Michael und uns, weil wir angeblich die ganze Gruppe dominieren würden, folgten.
Mir wurde langsam klar, dass hinter dem Marmortisch mit dem geschlossenen Eckzimmer mehr als nur die private Vorliebe stand. Hier machte sich ein lang aufgestautes Missbehagen bei denen Luft, die bisher eher Mitläufer gewesen waren und auf deren Ansichten, wegen der Dominanz von Michael bei den psychologischen und philosophischen Fragen, zu wenig eingegangen worden war. Auch ich bekam wegen meines Organisationstalentes und wegen meiner betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, die ich nach meinem Gefühl selbstlos in die Gruppe eingebracht hatte, mein Fett ab. Inzwischen war es über fünf Uhr nachmittags und ich wurde zunehmend nervös, weil wir meinem Schwiegervater ja 17.00 Uhr als Abholungszeit versprochen hatten.
Dies war kein kleiner Streit um den Marmortisch mehr, sondern das ganze Projekt stand gruppendynamisch vor dem Aus. Ziemlich frustriert brachen wir die Verkaufsverhandlungen ab, entschuldigten uns bei Notar und Verkäufer und machten uns getrennt auf die jeweiligen Heimwege.
Da es inzwischen 18.00 Uhr war, suchten wir mit schlechtem Gewissen die französische Kneipe auf, in der wir meinen Schwiegervater zurückgelassen hatten. Wir erwarteten einen vorwurfsvollen Vater, der einsam in einer Ecke ungeduldig auf die Heimfahrt wartete.
Doch als wir die Kneipe betraten, kam uns ein lautes, bunt gemischtes französisch Palaver, inmitten einer rauchgeschwängerten Tischrunde, entgegen. Die vielen Viertele vom Rotwein konnten wir förmlich riechen. Mitten drin saß mit glücklichem Gesicht mein Schwiegervater. Er erzählte in fließendem Französisch und unter lautem Beifall den Anwesenden von seinen Erlebnissen im Jahr 1944 auf der Flucht von der Atlantikküste nach Deutschland. Offensichtlich erhielt er dabei so viel Hilfe der französischen Bevölkerung, dass er dabei die Franzosen lieben gelernt hatte. Dies ließ er auch seine Zuhörer spüren. Erleichtert hörten wir selbst noch eine Weile zu und mahnten dann vorsichtig zur Heimreise.
Auf dem Weg ließen wir den Nachmittag noch einmal vor unseren Augen passieren. Wir konnten uns rasch auf unsere gegenseitigen Erkenntnisse einigen. Diese bestanden nämlich aus der einfachen Überlegung, dass das Projekt an und für sich toll ist, dass das aber mit einer Gruppe von zehn Leuten nicht zu packen sei. Das Gruppen-Projekt St. Dié war gestorben.
Noch auf der Heimfahrt wich das Frustgefühl einer neuen schwungvollen Haltung, die sich fast bis zur Euphorie steigerte. Wir beschlossen nämlich: „Das machen wir jetzt zu Zweit, nur ein wenig kleiner!“