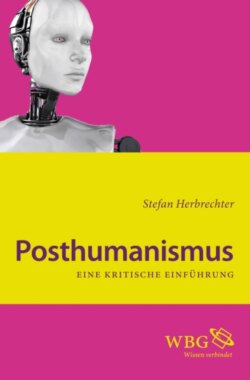Читать книгу Posthumanismus - Stefan Herbrechter - Страница 6
Für einen kritischen Posthumanismus
ОглавлениеIn irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der „Weltgeschichte“; aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Athemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Thiere mußten sterben. – So könnte Jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustrirt haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Denn es giebt für jenen Intellekt keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte. Sondern menschlich ist er, und nur sein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm drehten. Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, dass auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Centrum dieser Welt fühlt. Es ist nichts so verwerflich und gering in der Natur, was nicht durch einen kleinen Anhauch jener Kraft des Erkennens sofort wie ein Schlauch aufgeschwellt würde; und wie jeder Lastträger seinen Bewunderer haben will, so meint gar der stolzeste Mensch, der Philosoph, von allen Seiten die Augen des Weltalls teleskopisch auf sein Handeln und Denken gerichtet zu sehen. (Nietzsche, 1973: 369–70)
Dieser oft zitierte Ausspruch Nietzsches aus „Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne“ (1873, § 1) könnte durchaus sowohl als ein Ausgangspunkt wie auch als vorweggenommene Zusammenfassung des Phänomens dienen, das hier unter dem Begriff „Posthumanismus“ kritisch untersucht werden soll. Nietzsches nihilistisch-relativierende Provokation an das „kluge Tier“ Mensch richtet sich einerseits gegen den Kleinmut seines christlich inspirierten Humanismus mitsamt seiner selbsterwirkten und selbstverschuldeten Gottlosigkeit, andererseits bereitet sie das Terrain für eine vermeintlich befreiend-vitalistische Übermenschwerdung vor. Es scheint nun, dass Nietzsches „Umwertung aller Werte“, die die traditionelle Unterscheidung von Wahrheit und Lüge im moralisch-humanistischen Sinne aussetzt und eine völlig neue, radikal nicht-moralische nachhumanistische Situation beschreibt, im 21. Jahrhundert in greifbare Nähe gerückt ist. Während Nietzsches Nihilismus jedoch den Hochmut der Spezies mitsamt seiner selbstproklamierten anthropozentrischen „Weltgeschichte“ verspottet, treibt diese, von neuen Bio-, Nano- und Infotechnologien beflügelt, mit der Vision einer technologisch induzierten Selbstüberwindung und Selbstüberbietung ihre eigene Hybris auf die Spitze. Es ist daher anzunehmen, dass Nietzsche, obwohl immer wieder als posthumanistischer Vordenker proklamiert, nicht besonders beeindruckt von der verbreiteten technophilen Posthumanisierungseuphorie wäre. Die Mission des „menschlichen Intellekts“ einfach auf die Maschinenprothese zu übertragen ermöglicht noch nicht das ersehnte Kommen des Über-menschen, der sich einerseits nicht zu schade wäre, sich mit einer „Mücke“ zu verständigen und von ihr zu lernen, andererseits den humanistisch-narzisstischen „Pathos“ aus den Angeln heben könnte.
Wie jedoch soll der Philosoph „das Teleskop“ ausrichten, um nicht überall schon den Menschen in all seiner Herrlichkeit oder Niedertracht zu erkennen? Dies könnte sich als die schwierigste und daher wichtigste, dringendste und „kritischste“ Aufgabe einer „postanthropozentrischen“ und demnach posthumanistischen Philosophie erweisen. Ansätze hierfür gibt es viele. Einen besonders wertvollen jedoch stellen die sogenannten Poststrukturalisten und Dekonstruktivisten mit ihrem radikalen Antihumanismus dar. Dieses Buch stellt sich daher die Aufgabe, die gegenwärtige technologiegesteuerte „Posthumanisierung“ als das neuste kulturelle Symptom einer langwierigen Malaise zu analysieren, die dem Humanismus als Ideologie und als Diskurs selbst innewohnt. Um eine Kritik der scheinbar unausweichlichen Ablösung der Spezies Mensch und der damit verbundenen Euphorie oder Apokalyptik auszuführen, erscheint eine Rückverankerung von gegenwärtiger (Techno-)Kulturkritik in der antihumanistischen Theorie der 1970er und 1980er Jahre unbedingt vonnöten. Wo Propheten einer Post- oder Transhumanität das „Ende des Menschen“ proklamieren, will ein hier vertretener kritischer Posthumanismus lediglich das mögliche Ende einer bestimmten Sichtweise des Menschen, nämlich das des Humanismus untersuchen und eventuell dessen Wandel forcieren helfen. Man könnte es auch so zugespitzt formulieren: Wer den Menschen liebt, sollte sich kritisch mit seiner anthropozentrischen Ideologie auseinandersetzen.
Dies könnte man als vorläufige Definition des Posthumanismus ansehen: Das kulturelle Unbehagen oder die Euphorie, die aus dem Gefühl enstehen, wenn man die Idee des „Postanthropozentrismus“ ernst zu nehmen beginnt. Den Menschen nach dem „Ende des Menschen“ zu denken, ohne in apokalyptische Mystik oder neue Formen von Spiritualität und Transzendenz zu verfallen – dies ist die Haltung, die hier unter dem Begriff „kritischer Posthumanismus“ vertreten werden soll. Das Wort „kritisch“ hat hierbei eine doppelte Funktion: Es verbindet einerseits Aufgeschlossenheit gegenüber der Radikalität des technokulturellen Wandels, andererseits betont es eine Kontinuität mit schon lange existierenden Denkformen, die sich kritisch mit dem Humanismus, teilweise aus der humanistischen Tradition selbst heraus, beschäftigt haben. Es gilt also, die etablierte antihumanistische Kritik eu zu lesen, auf die neuen Herausforderungen abzustimmen und eventuell zu radikalisieren.
Einen interessanten Einstieg bietet hier Jean-François Lyotard, der in seinem Aufsatz „Une fable postmoderne“ Nietzsches Fabelthema wiederaufnimmt: „Wie könnten der Mensch und sein Gehirn, oder eher das Gehirn und sein Mensch, zu dem Zeitpunkt aussehen, wenn sie diesen Planeten vor seiner Zerstörung für immer verlassen – dies erklärt die Geschichte nicht“ (Lyotard, 1993: 79). Lyotard setzt sich hier mit der Möglichkeit einer „entkörperlichten“ Erzählung auseinander. Falls es gegen Lebensende unseres Sonnensystems noch Menschen geben sollte, werden sich diese, um die Explosion der Sonne überleben zu können, technologisch und evolutionsmässig vollkommen transformieren müssen. Sollte es eine Fortsetzung der Erzählung nach diesem extremsten aller Enden geben, muss eine erzählende Lebensform dem Inferno zwangsläufig entkommen. Lyotard sieht also eine Art Posthumanisierung als notwendige Transformation an, um den Bedingungen gerecht zu werden, die nötig wären, eine abgewandelte Form (noch)menschlichen Lebens auf eine intergalaktische Reise zu schicken.
Von einem kosmischen Standpunkt aus betrachtet, ist die Vorgeschichte dieser Fabel eine Erzählung, die erklärt, wie sich die beim Urknall freigesetzte Energie nach dem Gesetz der Entropie ausbreitet und, unter den ganz besonderen und unwahrscheinlichsten Bedingungen, lokalisiert der Entropie entgegengesetzte Systeme und Lebensformen entstehen, darunter die Erde und der Mensch. Das System „Mensch“ zeichnet sich durch sehr unwahrscheinliche evolutionäre Eigenschaften, wie die Herausbildung von körperlichen (vgl. Werkzeuge) und symbolischen „Techniken“ (Sprache) aus. Diese Techniken besitzen darüberhinaus „Selbstreferentialität“, welche sie sowohl perfektibel als auch über Generationen hinweg übertragbar machen und die Schöpfung von Gemeinschaften und sozialen Systemen ermöglichen. Unter diesen Systemen behauptet sich schliesslich eine besonders erfolgreiche Form, nämlich die der liberalen Demokratie, gegenüber anderen sozial-politisch-ökonomischen Gesellschaftsformen, weil sie ihr autoritäres Kontrollprinzip der freien Kreativität zum Zweck der Selbstoptimisierung unterzuordnen weiss. Als Nebenprodukt schafft sie das eschatologische Prinzip des „Fortschritts“. Das einzig verbleibende Hindernis für dieses System ist das Altern des Sonnensystems und die damit verbundene nötige „Selbsttransformation“ des Systems Mensch, um unter radikal veränderten Bedingungen überleben zu können:
Zu dem Zeitpunkt da diese Geschichte erzählt wird sind bereits Nachforschungen auf folgenden Gebieten im Gange: Logik, Ökonomie und Finanztheorie, Informatik, Konduktorphysik, Astrophysik und Raumfahrt, Biologie und Medizin, Genetik und Ernährungswissenschaft, Katastrophentheorie, Chaostheorie, Strategie und Ballistik, Sportwissenschaft, Systemtheorie, Linguistik und spekulative Literatur – all diese Nachforschungen sind bereits mehr oder weniger damit beschäftigt, den Körper des sogenannten „Menschen“ zu testen, zu verändern oder ihn zu ersetzen, so dass sein Gehirn auch unter den im Weltall existierenden energetischen Bedingungen funktionsfähig bleibt. Auf diese Art bereitet sich der letzte Exodus des negentropischen Systems von der Erde vor. (85–86)
Diese Erzählung besticht zwar durch ihren Realismus, ist jedoch schon nicht mehr ganz „realistisch“ im humanistischen, literarisch-stylistischen Sinne, denn nicht der Mensch ist der Held dieser Geschichte sondern der Kampf zwischen Entropie und Negentropie. Der Mensch ist sozusagen nur ein Nebenprodukt und der Held der Geschichte ist im Grunde gar kein „Subjekt“ mehr:
Die menschliche Gattung ist nicht der Held der Fabel. Sie ist vielmehr eine komplexe Organisationsform von Energie. Wie die anderen Formen auch, ist sie wahrscheinlich vergänglich. Andere, komplexere Formen können auftauchen und sie besiegen. Eine dieser Formen ist vielleicht bereits schon zum Erzählzeitpunkt dieser Fabel durch die technowissenschaftliche Entwicklung in Vorbereitung. (87)
Wer (oder was) schließlich das komplexe System darstellt – ob Mensch, Cyborg oder eine ganz andere Organisationsform – lässt sich nicht vorhersagen. Allerdings wird es eine komplexe Lebensform sein müssen, die denjenigen Bedingungen gewachsen ist, die herrschen werden, sobald sich die Sonne in eine Supernova verwandelt. Die Fabel sieht daher nicht direkt einen „Überlebenden“ als solchen vor, zumal es fraglich sein wird, ob die notwendige komplexe Form einer systemischen, negentropischen Organisation überhaupt noch als Lebensform erkennbar sein wird. Diese Ungewissheit selbst ist es, die die Fabel voranbringt und die Notwendigkeit des Fabulierens darstellt und den Erfindungsreichtum garantiert, von dem der technologische Fortschritt abhängt, der wiederum zum Überleben notwendig ist, usw. Lyotard bezeichnet diese Erzählung als „postmodern“, da sie sich „nach einer Kontamination durch die Moderne“ situiert, sich aber gleichzeitig von dieser „kurieren“ will (89). Im gleichen Sinne könnte man sagen, dass diese Erzählung „posthumanistisch“ ist, wenn man wie Lyotard die Moderne mit dem Christentum, Augustinus und dem Neoplatonismus beginnen lässt und sie vor allem unter dem Aspekt ihrer „Eschatologie“ versteht:
Mir scheint für die Vorstellung der Moderne wesentlich, dass sie ihre Legitimität vorauswirft und sie jedoch gleichzeitig auf einen verloren gegangenen Ursprung gründet. Die Eschatologie verlangt somit eine Archäologie. Dieser Zirkel, der im Grunde dem hermeneutischen Zirkel gleichkommt, macht die Geschichtlichkeit als moderne Zeitvorstellung aus. (91)
Wohingegen die beschriebene postmoderne (oder posthumanistische) Fabel weder strenggenommen eschatologisch, noch geschichtlich, noch emanzipatorisch, sondern rein diachron ist. Sie ist weniger hermeneutisch zirkulär als rein „kybernetisch“ organisiert (92). Diese Fabel entspricht auch nicht einer „neuen“, letzten oder ultimativen, humanistisch-anthropozentrischen „großen Erzählung“ der Moderne wie Lyotard diese in La Condition postmoderne (1979), unter dem Namen „Aufklärung“, „Marxismus“ und „Liberalismus“, beschreibt. Sie ist eher „inhuman“ (Lyotard, 1988a), indem sie sowohl die Unwahrscheinlichkeit des energetischen Systems „Mensch/Gehirn“, als auch dessen notwendige Endlichkeit ausdrückt:
Die „Mensch“ oder „Gehirn“ genannte Form müsste von einer anderen, komplexeren überholt werden, sollte sie das Verschwinden dieser Lebensbedingungen [wie sie auf der Erde vorherrschen] überleben. Der Mensch oder das Gehirn wird dann lediglich ein Abschnitt im Konflikt zwischen Differenzierung und Entropie gewesen sein. Die Weiterentwicklung der Komplexität benötigt keine weitere Perfektionierung des Menschen, sondern seine Mutation oder seinen Untergang zum Wohle eines besseren Systems. Die Menschen sehen sich zu unrecht als Motor der Entwicklung an, die sie mit dem Fortschritt des Bewusstseins und der Zivilisation verwechseln. Sie sind stattdessen ihr Vehikel und ihr Beobachter. (92)
Als solche ist diese Fabel weder auslegerisch-erklärend, noch moralischkritisch gedacht, sondern stellt die reine postmoderne (und posthumanistische) Melancholie dar, nach dem Ende des modern-humanistischen Hoffnungsprinzips. Sie ist rein „poetisch-ästhetisch“ zu denken, als postmodern-posthumanistischer „Affekt“ und als Ausdruck der ultimativen Kränkung des Anthropozentrismus (nach Galilei, Darwin und Freud). Sie ist nicht einmal pessimistisch, denn dies würde immer noch einen anthropomorphen Angelpunkt voraussetzen, von dem aus Gut und Böse klar erkennbar wären (94).
Was diese Fortführung der nietzscheanischen Fabel durch Lyotard zeigt, ist, dass es einerseits keinen Sinn macht, die fortschreitende Technologisierung der Spezies Mensch zu leugnen, und dass andererseits eine rein technologisch gedachte Posthumanisierung nicht ausreicht, um aus dem humanistsischen Paradigma auszubrechen. Während populäre Vorstellungen von posthumaner technologisch-verbesserter Menschlichkeit oft ideologisch-naiv humanistische Grundwerte unhinterfragt fortsetzen, sind traditionelle geistes- und kulturwissenschaftliche Ansätze oft selbst zu anthropozentrisch in ihrer Verteidigung eines mangelhaft historisierten Menschheitsbegriffs oder einer quasi-mystischen menschlichen „Natur“ angelegt. Infrage kommt daher nur ein Ansatz, der sowohl die technologische Herausforderung als auch die radikale Kritik des Anthropozentrismus ernstnimmt. Ein Posthumanismus also, der die Spezies Mensch als geschichtlichen „Effekt“ und Humanismus als ideologischen „Affekt“ versteht und beiden kritisch gegenübersteht – ein „kritischer Posthumanismus“, der sich nicht von vornherein „nach“ einem zu definierenden Humanismus positioniert (von einem technologisch erhöhten Wissensstand her zum Beispiel), sondern diesem dekonstruktiv-kritisch innewohnt, und für den Technik und das „Inhumane“ nur Mittel und nicht Selbstzweck sind. Ein Posthumanismus der eben nicht post-human sondern posthuman(istisch) ist.
Dies ist auch Lyotards Anliegen in seiner Aufsatzsammlung L’Inhumain (1988a), die mit ihrem Untertitel „Causeries sur le temps“ auf ihren zeitanalytischen Charakter aufmerksam macht. In ihr zielt Lyotard auf die Arroganz des Humanismus ab, der zu glauben scheint, er müsse und könne „uns“ immer noch Lektionen erteilen. Aber seine Autorität, die es im Grunde verbietet, den Begriff „Mensch“ zu hinterfragen, ist im Schwinden begriffen. Nach der Blosstellung des humanistischen „Vorurteils“ stellt sich für Lyotard die Frage, „und wenn der Mensch, im humanistischen Sinne verstanden, zum einen im Begriff, oder sogar dazu gezwungen wäre, inhuman zu werden? Und wenn zum anderen das dem Menschen ‚Eigene’ genau die Tatsache wäre, dass ihm das Inhumane nämlich bereits innewohnt?“ (1988a: 10). Dieses Inhumane im Humanen nimmt zweierlei Formen an, einerseits die der Unmenschlichkeit des „Systems“, welches sich des Humanismus nur als Ideologie bedient, und zweitens die des Nichtmenschlichen, das dem Menschen im Kern als „Geheimnis“ innewohnt, und „das seine Seele zur Geisel nimmt“ (10). Dies steht einer Auffassung von einer essentiellen Menschlichkeit entgegen, auf die sich der Humanismus traditionell beruft, zum Beispiel immer dann, wenn es um „humanitäre Aktionen“ geht. Wo genau liegt jedoch diese essentielle Menschlichkeit eines jeden Menschen? In seiner „Kreatürlichkeit“ („der ursprünglichen Armseligkeit der Kindheit“)? Oder in seiner Sprach- und Kulturfähigkeit und seinem Gesellschaftstrieb („seiner Fähigkeit, sich eine ‚zweite Natur’ dank seines Sprachvermögens zu schaffen, die es ihm erlaubt, am gemeinsamen Leben, am Bewusstsein und am Verstand teilzuhaben“)? Ist der Mensch also Mensch aufgrund seiner „Natur“ oder seiner „Kultur“? Selbstverständlich geht es nicht um einen simplen Gegensatz zwischen Natur und Kultur – die Interdependenz von Natur und Kultur wird von niemandem ernsthaft bestritten. Lyotard und einem kritischen „Nicht-mehr-ganz-Humanismus“ geht es vielmehr um das, was die Dialektik aus Natur und Kultur aussschliesst, um den Rest, das „Andere“, eben das Inhumane, das den Menschen immer in seiner Eigenheit voraussetzt und ihn zugleich als Ziel versteht, als unerreichbares Ideal, als Original und Kopie usw. Das „Wesen“ des Menschen ist genau seine „Ab-wesen-heit“: „Es reicht im Grunde, unsere Zeitgenossen daran zu erinnern, dass das Wesen [le propre] des Menschen die Abwesenheit seines Wesens ist, sein Nichts oder seine Transzendenz, um sozusagen das ‚Besetztzeichen’ hinauszuhängen“ (Lyotard, 1988a: 14).
Es scheint nun, dass heute diese Unmenschlichkeit des Systems sich genau die „Ab-wesen-heit“ und endlose Plastizität des Menschen und seines verborgenen inhumanen Kerns auf die Fahne geheftet hat. Lyotard nennt dies zwar nicht „Plastizität“ (welches eher ein Modewort der zeitgenössischen Kognitionswissenschaften ist, vgl. Malabou, 2004), sondern „Entwicklung“, was jedoch gemeint ist, bleibt klar: Es geht um die beschleunigte Liberalisierung, Flexibilisierung, Virtualisierung usw. der Moderne, deren interne Dynamik und Metaphysik diese „idéologie du développement“ ist. Die verselbständigte Entwicklungs- und (Selbst)-Transformationsideologie braucht keine großen Erzählungen mehr, die traditionell auf die Emanzipation der Menschheit abzielen. Sie droht stattdessen zur Verkörperung des Inhumanen oder sogar Posthumanen zu werden, denn für sie ist der Mensch nur ein Mittel zum Zweck: „Das Interesse der Menschen wird dem des Überlebens der Komplexität untergeordnet“ (Lyotard, 1988a: 15), als Bestandteil der andauernden kosmischen Auseinandersetzung zwischen Entropie und Komplexität um die Verteilung von „Energie“. Gegen diese inhumane Logik des (kosmischen) Systems gilt es das andere Inhumane (den geheimen „Rest“ des Humanen, der sich nicht vollkommen aus der Unterscheidung von Natur und Kultur oder aus dem Schema der kosmischen Evolution erklären lässt) als Ausgangspunkt für einen kritischen Posthumanismus zu nutzen:
Was bleibt an Politischem ausserhalb des Widerstandes gegen dieses Inhumane übrig? Und was bleibt für einen Widerstand anderes übrig als die Schuld, die die Seele durch die Unbestimmtheit aus Elend und Wunder – das heisst also durch das andere Inhumane – immer schon auf sich gezogen hat und aus der sie, immer wieder neu, geboren wird? (15)
Es wird klar, dass diese doppelte Inhumanität eine parallele Analyse verlangt: einerseits eine rigoros historisch-materialistische, andererseits eine eher metaphysisch-dekonstruktivistische. Erstere macht sich die Methodik des Marxismus zu eigen, ohne jedoch einer typischen anthropozentrischen Sichtweise zu verfallen. Mensch und Humanität sind historisch-kulturelle Konstrukte, nicht ideologiefreie transzendentale Begriffe, und müssen daher in größere Zusammenhänge wie Ökosystem oder Technik oder Evolution eingefügt werden. Posthumanistisch (oder auch postmarxistisch) wird dieser Ansatz genau dadurch, dass der Mensch nicht mehr der Held einer Emanzipationsgeschichte ist, sondern ein (recht unwahrscheinliches aber kurioses) Stadium in der Evolution komplexer Lebensformen darstellt. Dem anderen Ansatz, geht es um das andere Inhumane, sozusagen um das dem Menschen innewohnende „Andere“, das sowohl seine Einzigartigkeit als auch seine „Unbestimmtheit“ ausmacht. Im Grunde handelt es sich um eine Psychoanalyse der Menschlichkeit, eine Art Anamnese, die das Verdrängte durcharbeiten will, das notwendigerweise auf dem Weg zur Humanität auf der Strecke geblieben ist. Posthuman und posthumanistisch heisst eben auch dies: Sich all den Geistern stellen, die beim Prozess der Menschwerdung verdrängt worden sind, all die „Anderen“ des Menschen – Tiere, Götter, Dämonen, Ungeheuer aller Art (vgl. Graham, 2002). Beiden Ansätzen gemeinsam ist die Überzeugung, dass ein traditionelles humanistisches Welt- und Menschenbild unhaltbar, wenn nicht sogar überflüssig geworden ist, entweder durch äußere, zumeist technische, öknomische oder ökologische Einflüsse, oder durch interne metaphysisch-ethische Gründe. Die äußeren Zwänge können entweder als befreiend oder bedrohlich, oder als beides gleichzeitig aufgefasst werden. Die inneren Zwänge könnten am besten als wohlwollende Misanthropie angesehen werden (vgl. Cottom, 2006), die sich aus eigentlicher Liebe zur Spezies Mensch gegen dessen hybris stellt und eine Art selbstkritische aber nicht selbstbemitleidende humilitas einfordert.
„Seit Menschengedenken“, dieser wunderbar romantische, nostalgische Ausdruck, der die tragische Größe alles Menschlichen als Unterton im Humanismus immer mitschwingen lässt, erhält also in der Kulturtheorie des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts eine ganz neue Bedeutung. Er deutet einerseits daraufhin, dass es eine Zeit vor dem Menschen gab, also eine Geschichte ohne den Menschen, andererseits besagt er, dass es eine Zeit nach dem Menschen geben kann. Dass dies nicht eine reine evolutionstheoretische Platitüde zu sein braucht, zeigt ein Ansatz wie der Michel Foucaults (vgl. Les Mots et les choses, 1966). Hier nimmt die Kritik der „Repräsentation“ oder Darstellung, die in der Kulturtheorie der letzten Jahrzehnte so einflussreich geworden ist, ihren Ausgangspunkt. Beim anthropozentrischen Humanismus handelt es sich natürlich zuallererst um eine Selbstdarstellung des Menschen (vgl. Kants „Was ist der Mensch?“ als Ausgangspunkt einer neuhumanistischen philosophischen Anthropologie). Das den Aufschwung des humanistischen Paradigmas (oder „épistème“, nach Foucault) in der Moderne begleitende Wissensregime ist der „Realismus“. Dieser beruht auf den Grundpfeilern der Ähnlichkeit, der Transparenz des Mediums und der sinnstiftenden Identität. Das heisst ein Sachverhalt, der entweder einmal präsent war oder noch ist, kann ohne großen Verlust endlos und „realistisch“ d.h. wirklichkeits- und originalgetreu abgebildet und somit wieder präsent gemacht (re-präsent-iert) werden und dies gleichermassen für ein beliebiges „Subjekt“, das sich jeweils individuell angesprochen fühlt und durch Identifikation mit dem dargestellten Sachverhalt sowohl seine eigene volle Bedeutung erzielt – sie sich also „zu-Eigen-macht“ – als auch den Wahrheitsgehalt der Repräsentation gegenzeichnet. Somit ist also die gegenwärtige Krise des Realismus vor allem auch eine Krise seines Subjekts. Indem das Subjekt als „dezentriert“ entlarvt wird – es ist einerseits beliebig austauschbar, andererseits soll es eine einzigartige und individuell angelegte (Selbst)-Identität garantieren – verliert auch die Transparenz, auf der die Idee der Repräsentation beruht, ihre Legitimation. Stattdessen entwickelt das Medium der Darstellung, im Normalfall die symbolisch rekursive Sprache, seine Eigendynamik. Dies, in extrem verkürzter Form, ist der Ausgangspunkt für den sogenannten Poststrukturalismus – einerseits die unmögliche Identität des Subjekts mit sich selbst, andererseits, die derrideanische „différance“ der symbolischen Repräsentation, die Wahrheit verspricht, aber ständig aufschiebt („différer“, aufschieben) und damit permanent von sich sich selbst verschieden bleibt („différer“, unterscheiden). Das Resultat ist eine ständig versprochene aber strukturell unerreichbare Selbstidentität, die permanent ihre eigene Differenz zu verheimlichen oder zu unterdrücken sucht. Mit der Entlarvung seines Trägers – nämlich dem freien, universellen und jedoch gleichzeitig angeblich einzigartigen menschlichen Individuum – wird auch der „liberale Humanismus“ unglaubwürdig und entweder als „große Erzählung“ (nach Lyotard), als Ideologie (nach Althusser), Mythos (nach Barthes) oder als historisch-machtpolitisch konstruierter Diskurs (nach Foucault) erklärt.
Der wichtigste Hebel bei der poststrukturalistischen Humanismuskritik ist dabei das Primat der Sprache vor jeglicher Subjektivität und damit auch vor jeglicher Identität. Hier ist Catherine Belseys einflussreiches Manifest, Critical Practice (1980) zum Thema „liberal humanism“:
Der gesunde Menschenverstand [common sense] vertritt einen Humanismus, der auf einer empirisch-idealistischen Interpretation der Welt beruht. Anders gesagt, behauptet dieser common sense, dass der Mensch [„man“] Ursprung und Quelle für die Bedeutung von Handlung und Geschichte ist (Humanismus). Unsere Begriffe und Wissen sind angeblich das Produkt von Erfahrung (Empirie), und diese Erfahrung wird vom Geist, Verstand oder vom Denken interpretiert, einer Eigenschaft der transzendenten menschlichen Natur, deren Wesen das Attribut jedes Individuums ist (Idealismus). (Belsey, 1980: 7)
Dieser Humanismus des gesunden Menschenverstandes, übertragen auf die Kunst, Literatur, Ästhetik und letztendlich auf kulturelle Produktion generell, formt dann die Basis für die hegemonische Lesart nach den Regeln des Realismus:
[Die Theorie des expressiven Realismus] ist die Idee, dass Literatur die Wirklichkeit von Erfahrung widerspiegelt, wie sie von einem einzelnen (besonders begabten) Individuum wahrgenommen wird, und das sie in der Form eines Diskurses ausdrückt, welche es anderen Individuen ermöglicht, sie als wahr zu erkennen. (7)
Humanismus ist also die Idee, dass durch ständiges Identifizieren mit einer quasi-mystischen universellen menschlichen „Natur“ große kulturelle Errungenschaften hervorgebracht werden, die den Zusammenhalt der Menschheit als Ganzes darstellen, und genau diese Idee wird von allen Seiten durch die Postmoderne im allgemeinen und von den poststrukturalistischen Humanismuskritikern insbesondere angegriffen. Ideologisch-politisch gesehen ist dieser Humanismus „liberal“ in dem Sinne, dass er ein bürgerlich-kapitalistisches Subjekt voraussetzt, das über die Toleranz oberflächlicher Differenzen hinweg (z.B. geschlechtliche, ethnische, kulturelle, lokale, historische Unterschiede) im Namen einer universellen „Humanität“ eine Art Beschwichtigungspolitik betreibt und jeglichen Angriff auf diese als allgemeingültig deklarierten Werte als politischen Extremismus, Intoleranz oder einfach als „regressiv“ im Keim erstickt. Die „Kulturpolitik“ dieser humanistischen Ideologie und bleibt die Zielscheibe der postmodernen, poststrukturalistisch angehauchten posthumanistische Kritik, die stattdessen die unterdrückte Partikularität, die Vielfalt, die Multiplizität wie auch die Singularität von Kultur(en) und menschlichen wie auch nichtmenschlichen Formen hervorhebt. Sie betont die radikale zeitlich-räumliche Kontextgebundenheit, negiert die Im-manenz von Bedeutung und betont stattdessen die politisch-konfliktuelle Konstruktion jeglicher Sinnstiftung. Sie kritisiert die angebliche Transparenz der Medialität (Realismus in der Sprache, den Bildern, Medien und abbildenden Technologien generell) und hebt stattdessen die Eigendynamik dieser Medien mitsamt ihrer identitätsstiftenden Funktion und ihrer „Positionierung“ von Subjekten hervor. Sie betont die Wandelbarkeit und Relativität der menschlichen Natur und Individualität gemeinsam mit der Relativität von Werten. Sie wendet sich jedoch auch gegen jede idealistische Transzendenz, betont die Untrennbarkeit von Form und Inhalt, die Kontextbezogenheit und den Prozesscharakter von Wahrheit und insistiert auf einer „Materialität des Denkens“ und dessen „körperlicher“ Bedingtheit.
Wie bei Belsey gesehen, werden sowohl Freiheit, Universalität und das Prinzip der Individualität des humanistischen Subjekts angezweifelt, als auch dessen Wahrheitsprinzip, das auf der wirklichkeitsgetreuen Darstellung beruht. Ein kritischer Posthumanismus ist daher die einzige philosophisch-theoretische Konsequenz, denn es ist weder denkbar, dass der Mensch ohne Repräsentation, noch ohne irgendein Identitätsprinzip, auskommen könnte. Die gesamten Anstrengungen der posthumanistischen Kulturtheorie laufen also darauf hinaus, eine postrealistische und postphänomenologische Hermeneutik und eine postsubjektive Form der Handlungsfähigkeit [agency] herauszuarbeiten.
In diesem Sinne sollte also Foucaults oft zitiertes Diktum vom „Ende des Menschen“ in einem historischen, diskursiv-kritischen und nicht einem frohlockend-apokalyptischen Zusammenhang gesehen werden:
Eines ist jedenfalls sicher, nämlich dass der Mensch weder das älteste noch das konstanteste Problem ist, das sich dem menschlichen Wissen gestellt hat... Der Mensch ist eine Erfindung der jüngeren Vergangenheit, wie die Archäologie unseres Denken leicht aufzeigen kann. Wie auch vielleicht sein nahes Ende. Sollten diese Anlagen so schnell verschwinden wie sie aufgetaucht sind, sollten sie durch irgendein Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit wir wohl spüren, dessen Form und Versprechen uns derzeit jedoch noch nicht bekannt sind, einstürzen, wie dies am Anfang des 18. Jahrhunderts mit den Grundfesten der Klassik geschah, dann kann man durchaus darauf setzen, dass der Mensch wie ein Gesicht im Sand am Meeresstrand verschwindet. (Foucault, 1966: 571-572)
Zwei unmittelbare Schlussfolgerungen ergeben sich aus dieser Ernüchterung: Die Historisierung des Untersuchungsgegenstandes „Mensch“ sprengt den Rahmen der traditionellen philosophischen Anthropologie und der Geisteswissenschaften oder der sogenannten „humanities“. Zweitens ist, zumindest nach der Meinung einer nicht geringen Minderheit von Kulturtheoretikern als auch Naturwissenschaftlern, das von Foucault verkündete Ereignis in gewisser Weise bereits eingetreten, z.B. in der Form eines evolutionsbedingten Übergangs in eine „Posthumanität“ (eine bevorstehende Ablösung der Spezies homo sapiens durch entweder eine höher entwickelte Zwischenstufe – z.B. den „robo sapiens“, oder den Cyborg – oder eine From von völliger „Transhumanität“ bzw. „künstlicher Intelligenz“).
Über die Art und Weise, inwieweit sich die gegenwärtigen Institutionen ändern müssen, oder schon in einer Veränderung begriffen sind, die sich dem menschlichen Wissen und dem Wissen vom Menschen und seiner Umgebung verschrieben haben, wird noch zu sprechen sein. Es scheint jedenfalls wahrscheinlich, dass sich die sogenannten humanities (Geistes- und Kultur-, aber auch zum Teil Sozial- und Humanwissenschaften) im Sinne der beschriebenen Posthumanisierungstendenzen in „Posthumanwissenschaften“ verwandeln werden, um der Frage nach dem Menschen weiterhin gerecht werden zu können. Lyotards doppelte Form des Inhumanen, Foucaults „Doppelgänger“ des Menschen (1966: 452–509), oder auch die gesamte Palette der interdisziplinären Herausforderungen in Derridas „Universität der Zukunft“ (Derrida, 2001b), sowie die Forderung z.B. Cary Wolfes nach einer postanthropozentrischen oder auch „postspeziezistischen“ Sichtweise (vgl. Wolfe, 2003), fordern die posthumanistische Transformation der wohl humanistischsten aller Institutionen, der Universität.
Ist die „Zeit des Menschen“ (Zons, 2001) also definitiv vorbei? Und wie könnte dieses „menschenmöglich“ sein, d.h. vom Menschen an sich überhaupt erkennbar? Es ist schade, dass im Deutschen eine Unterscheidung, wie im Englischen oder Französischen, zwischen „l’homme“ und „l’humain“, oder „man“ und „human“, nicht so einfach nachvollzogen werden kann – „Mensch“ muss sowohl „homme/man“ als auch „humain/ human“ abdecken. Bedauerlich ist dies, weil diese Unterscheidung sichtbar macht, dass das Ende des „homme/man“ auf keinen Fall zu verwechseln ist mit dem Ende des „humain/human“. Dies wird sofort klar, wenn man sich an einen Höhepunkt der poststrukturalistischen Humanismuskritik erinnert, das von Nancy und Lacoue-Labarthe organisierte Colloque de Cerisy, „Les Fins de l’homme: à partir du travail de Jacques Derrida“, das vom 23. Juli bis zum 2. August 1980 stattfand. Ausgangspunkt hierfür war Derridas gleichnamiger Aufsatz (in Marges de la philosophie (1972), „Les Fins de l’homme“; ursprünglich als Vortrag bereits 1968), in dem Derrida im Laufe einer Lektüre von Sartre und Heidegger mit der Doppelbedeutung von „fin“ im Sinne von sowohl Zweck als auch Endpunkt spielt. Derrida dekonstruiert hier die „phänomenologische Ontologie“ des Existenzialismus, der bei Sartre auf der „menschlichen Wirklichkeit“ und bei Heidegger auf dem Begriff des „Daseins“ beruht. Heidegger ging es seinerseits, in seinem „Über den Humanismus“ (1949), bereits um die Destruktion des metaphysischen Grundes, auf dem jeglicher Humanismus mit seiner Frage nach dem Wesen des Menschen, beruht. Dementsprechend versucht Derrida, die Herausforderung, das „Ende des Menschen“, ausserhalb einer Hegelianischen Aufhebung und metaphysischen Teleologie zu denken folgendermaßen zu formulieren:
Was heutzutage dem Denken schwerfällt, ist ein Ende des Menschen, das nicht mittels einer Dialektik aus Wahrheit und Negativität strukturiert ist, ein Ende des Menschen, das keine Teleologie in der ersten Person plural darstellt. (Derrida, in Nancy and Lacoue-Labarthe, 1981: 144)
Im Grunde geht es also auch bei Derrida um einen Posthumanismus, der weder „Ich“ noch „Wir“ sagt, der weder in der Finalität des einzelnen Menschen (z.B. in der Idee des „Seins-zum-Tode“, oder im Existenzialismus) noch in der Teleologie eines Menschheitsbegriffs (Idealismus) den Menschen sozusagen „anthropozentriert“, sondern den Menschen als radikale Öffnung auf das „Unmenschliche“ der Zukunft, jenseits des metaphysischen Horizonts und jeglicher Bestimmung oder Bestimmtheit versteht. Weder Aufhebung, Vollendung, Überwindung, Erneuerung, noch Verschwinden und auch nicht mehr die essentielle Frage nach dem „Wesen“ des Menschen, sondern der Wechsel von der Frage „Was ist der Mensch?“ zu „Wer ist der Mensch?“ ist der neue Schwerpunkt:
Genau diese Frage hat die Epoche vergessen. Die Epoche der totalen Dominanz... der Anthropologie, welche in blinder und geschäftiger Manier die Ausbeutung der Frage „Was ist der Mensch?“ verfolgt, und deren extremer Vorstoß, wie wir allmählich begreifen, das Zeitalter der Technik ist. (Nancy, in Nancy and Lacoue-Labarthe, 1981: 13)
Es wird klar, dass weder die von einigen Vertretern des Posthumanismus enthusiastisch begrüßte, noch die von anderen verteufelte Intensivierung der technologischen Entwicklung als Triebfeder der Posthumanisierung dem metaphysischen Humanismus oder der Anthropozentrik nicht entkommen kann. Zumindest trifft dies zu, solange das Technikvesrtändnis die Frage nach dem Menschen metaphysisch-ontologisch stellt, was selbst noch in der Verneinung dieser Frage, also auch in der Form einer Überwindung der Fall ist. Dies vermag nur eine Dekonstruktion von „Mensch“ und „Technik“ über das vermeintliche „Verschwinden des Menschen“ hinweg zu ändern. Ein kritischer Posthumanismus stellt selbst die zur simplen Reaktion gewordene Kritik des Humanismus in Frage, wie Lacoue-Labarthe und Nancy dies bereits im Motto zu „Les Fins de l’homme“ angekündigt hatten:
Zwischen einem „Verschwinden des Menschen“, das heutzutage so bekannt ist, das es wiederum verkannt zu werden droht, und einer allgemeinen Kritik des Humanismus, die so enthusiastisch angenommen worden ist, dass sie ihrerseits fraglich erscheint, und den schändlichen, naiven und reaktionären Formen des Humanismus, auf die sich so viele Diskurse mangels Alternativen oder auch aus Trotz stürzen, könnte es durchaus sein, dass die Frage nach dem „Menschen“ heute unter ganz neuen philosophischen, literarischen, sowie ethischen als auch politischen Vorzeichen neu gestellt werden muss, und zwar in der Form einer Frage nach dem Ende. (1981: 20)
Nach dem Menschen, ist also vor dem Menschen, doch zwischen Endlichkeit und Erneuerung besteht die Möglichkeit des ganz „anderen“ Menschen. Dies ist die Ambiguität, die jedem Präfix „Post-“ innewohnt.
Die Behauptung also, etwas sei oder gehe zu Ende, ist natürlich keine Behauptung wie jede andere, schon gar nicht, wenn es um eine so alte und ehrwürdige Tradition wie den Humanismus geht, und mit ihm um das, was angeblich den Kern unserer Gattung ausmacht, nämlich „unsere“ Humanität. Es steht jedoch außer Frage, dass Humanität als solche eine konkrete Vorgeschichte hat und im Grunde eine Kombination aus Humanismus als ideologischem Diskurs und Moderne als sozialhistorischer Formation darstellt. Vor die philosophische Fragestellung „Was ist der Mensch?“ tritt daher die vom Posthumanismus radikalisierte Kritik am Humanismus und seiner Tradition (mindestens seit der Renaissance, inklusive ihrer Rezeption der griechisch-römischen Antike und der neoplatonisch-christlichen Neuzeit). Sich „nach“ dieser Tradition zu „postieren“ – Posthumanismus – bedeutet wie auch schon beim Postmodernismus und der Postmoderne, je nach Akzentsetzung, eine bewusste Doppeldeutigkeit in Kauf zu nehmen: Die Erfahrung, dass ein gewisser Humanismus eindeutig an sein Ende gelangt ist (daher Post-humanismus); andererseits, beschreibt sie das Bewusstsein, dass dieser Humanismus auf Grund seiner eigenen Pluralität und Ungreifbarkeit nicht einfach ohne Überreste oder Wiederkehr ad acta gelegt werden kann, sondern kritisch-dekonstruktiv „durchgearbeitet“ werden muss (daher auch Post-humanismus).
Allerdings kann man sich noch eine andere, deskriptivere Akzentuierung vorstellen: Posthumanismus ist all dies und mehr, nämlich der gesamte Diskurs, kritisch oder weniger kritisch, enthusiastisch, sensationslustig, ironisch oder alarmistisch, der sich mit allem „Posthumanen“ beschäftigt und dieses zuallererst als sein diskursives Objekt selbst ins Leben ruft: also Posthuman-ismus. Dieser Aspekt ist nun der, der eindeutig technologiegetrieben ist. Er entspricht auch sozusagen der öffentlichen Ansicht eines „populären“ Posthumanismus, eine mehr oder weniger sensationslustige Mischung aus Feuilleton, Wissenschaftsmagazinen, selbsternannten Futurologen, Teilen der Intelligentzia, der Marketingbranche, Lobbyisten usw., alles in allem eine Art „dritte Kultur“, wie sie Slavoj Žižek in Anlehnung an C. P. Snows „two cultures“ (Wissenschaft versus Literatur, oder auch Geistes- versus Naturwissenschaften) darstellt, nämlich als das Produkt der „kognitivistischen Popularisierer der exakten [hard] Wissenschaften“:
Die Dritte Kultur umfasst das geräumige Feld, das von den Debatten der Evolutionstheorie (Dawkins und Daniel Dennett gegen Gould), der Quantenphysik und Kosmologie (Stephen Hawking, Steven Weinberg, Fritjof Capra), der Kognitionswissenschaft (nochmals Dennett, Marvin Minsky), Neurologie (Oliver Sacks), und der Chaostheorie (Benoit Mandelbrot, Ian Stewart) – also anhand von Autoren, die den kognitiven und allgemeingesellschaftlichen Einfluss der Digitalisierung auf unser tägliches Leben diskutieren – bis zu den Theoretikern autopoietischer Systeme, die versuchen, einen universellen formalen Begriff selbst-organisierender und emergenter Systeme zu entwickeln, der auf „natürliche“ lebendige Organismen, Spezies und soziale „Organismen“ (z.B. Marktentwicklung und andere große Gruppen interagierender sozialer Akteure) anwendbar sind. (2002: 19-20)
Auch wenn Žižeks Namensliste etwas einseitig und vielleicht auch nicht mehr ganz aktuell ist, so erklärt sie dennoch, dass in der Öffentlichkeit, oder im sogenannten kulturellen „Imaginären“ die Folgen des technischen Eingriffs in das Humane und die menschliche Natur heutzutage allgegenwärtig sind. Žižek möchte weiterhin zeigen, dass selbst viele Kulturtheoretiker und Vertreter der „cultural studies“ so fasziniert von diesem „technokulturellen“ Phänomen sind, dass sie vergessen, die Autorität der szientistischen Ideologie und ihrer Metaphern zu hinterfragen und sie auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Während der szientistisch-kognitive Ansatz oft auf naiv-metaphysische Art nach „den letzten Dingen“, der „wahren Natur“ und dergleichen sucht, hält der vorherrschende und institutionalisierte Werte-, Kultur- und Geschichtsrelativismus in den cultural studies diese davon ab, einen überzeugenden Gegenentwurf zu liefern, was die Beziehung zwischen Mensch, Kultur, Natur und Technik angeht. Für das Projekt eines kritischen Posthumanismus bedeutet dies, die techno-kulturellen Bedingungen durchaus ernst zu nehmen, sie aber keineswegs als unabdingbar hinzunehmen. Während Žižeks Gegenmittel die provokante Analyse aus einer üblichen Mischung von Psychoanalyse und Marxismus ist, setzt der in der vorliegenden Studie vertretene Ansatz eher auf Dekonstruktion.
Erste Zielscheibe ist in beiden Fällen der grassierende „technologische Determinismus“ in diversen Darstellungen posthumaner Szenarien. Wie Raymond Williams (1989) erklärt, ist technologischer Determinismus die Grundannahme, dass eine neue Technologie mehr oder weniger plötzlich aufgrund von technologischer Entwicklung und Experimentation einfach „auftaucht“ [emergence]. Anschließend wird die neue Technologie in die Gesellschaft „eingeführt“ und ändert diese dementsprechend. Was normalerweise „vergessen“ wird ist, dass eine konkrete Technologie immer schon in ein sozial-kulturelles Umfeld eingebettet ist, d.h. eine kultur-geschichtliche Vorgeschichte hat und deshalb nicht in einem wertfreien Raum einfach „auftauchen“ kann. Im Gegenteil, welche technologische Lösung im Endeffekt für ein jeweiliges Problem „gefunden“ wird, hängt natürlich stark von den Prämissen ab, und diese sind normalerweise nicht nur systembedingt, sondern sozial und kulturell, oftmals sogar personal abhängig. Technologien gehen immer schon mit ihrem sozialen Gebrauch einher, sei dieser militärisch oder kommerziell, eventuell sogar „humanistisch-idealistisch“ weltverbessernd. In diesem „transformationellen“ Sinne ist Technologie eminent politisch und politisierend. Die Ideologie einer „Unausweichlichkeit“ technologischer Entwicklung ist im Normalfall kombiniert mit einem gewissen Kulturpessimismus. Die Polarisierung in ein technophobes und technophiles Lager ist dementsprechend endemisch in der technologischen Entwicklung, denn sie entspricht der zutiefst menschlichen Sehnsucht nach Erneuerung einerseits und Sicherheit oder Wiederholung andererseits. Sowohl technologisch induzierte Utopie als auch Nostalgie oder Dystopie neigen dazu, die gegenwärtigen materiellen Bedingungen zu vernachlässigen und die eigentlichen wirtschaftlichen und politischen Interessen und dadurch entstehende soziale Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu übersehen. Ausserdem ist technologische Neuerung im Normalfall stark unterdeterminiert, d.h. radikal mehrdeutig. Der Augenblick der Einführung einer neuen Technologie ist potentiell zumindest ein Moment der Auswahl. Alternative Nutzungsmöglichkeiten sind immer vorhanden. Ein klassischer Fall ist das Internet, welches sich, von seinem ursprünglich rein militärischen Zweck entfremdet, nun zum bedeutendsten gesellschaftsverändernden Medium einer „hyperkapitalistischen“ Informationsgesellschaft gewandelt hat. Wie bei jeder Einführung von technologischen Erneuerungen bringt eine Systemveränderung immer auch einen möglichen Wandel kultureller Beziehungen. Im Falle des Internet sind dies sowohl neue interpersonale Beziehungen, Identitäten und Gemeinschaften basierend auf Virtualität und sogenannten „Avataren“ (d.h. graphisch-virtuelle Stellvertreterfiguren), und vor allem neue Konsummöglichkeiten, aber auch teilweise politischen Wandel durch elektronische Wahlverfahren und Interaktivität, neue Überwachungsmöglichkeiten wie auch sofortige globale Kommunikation, neue Formen der Ausbildung durch e-learning und vieles mehr.
Es gilt also, diesen technologischen Wandel in seiner Vielschichtigkeit und Ambivalenz im Hinblick auf einen kulturellen Wandel und, in diesem spezifischen Fall, auf die „Ablösung“ eines humanistischen Wertesystems durch ein (noch genauer zu definierendes) posthumanistisches, kritisch zu begleiten. Dass der technologische Wandel sich im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert intensiviert und beschleunigt hat – zumindest in weiten Teilen der westlichen und westlich beeinflussten Welt – wird von niemandem geleugnet werden können. Die Grenzen zwischen Wissenschaft, Kultur und Technologie sind derart aufgeweicht, dass es Sinn macht, von „Technokultur“ einerseits und „Technowissenschaft“ andererseits zu sprechen. Aronowitz und Menser (1996) beschreiben die neue Aufgabe der „cultural studies of science“ (mittlerweile vielerorts unter dem Namen „critical science studies [CSS]“ institutionalisiert) als das Studium der Praktiken und Wirkungen von Wissenschaften mitsamt ihrer Systeme und Objekte; als eine kritische Untersuchung des soziokulturellen Kontextes, in dem sich Wissenschaften bewegen, wie z.B. die Globalisierung, Militari-sierung, Medikalisierung und deren Auswirkung auf weite Teile der Lebenswelt; und schliesslich eine Analyse der diskursiv-ideologischen Rolle der „Big-Science“ in der Öffentlichkeit als eine besondere Form der kulturellen Praxis (7–8). In einer technologisch-wissenschaftlichen Kultur ist Wissenschaft nicht mehr eine (kultur)politische Komponente unter vielen, sondern wird zur dominierenden institutionellen, ökonomischen und ideologischen Macht, die sowohl das Zusammenleben, die Identitätsbildung und die Körperlichkeit der einzelnen Menschen grundlegend beeinflusst, selbstverständlich ohne sie vollkommen zu determinieren. Das Beiwort „kritisch“ will genau dies besagen, nämlich die Aufgabe, den Posthumanismus konsequent zu analysieren, ausgehend von einer radikalen Interdependenz oder gegenseitigen Durchdringung des Humanen, Posthumanen und Inhumanen. Dabei handelt es sich um eine Durchdringung sowohl auf politischer, ökonomischer, philosophischer, technologisch-wissenschaftlicher und kultureller Ebene. Auch die cultural studies [CS] vermögen es natürlich nicht, irgendein menschliches „Wesen“ vollständig zu definieren. Eine intensivierte und ernsthafte Interdisziplinarität zwischen Human-, Geistes-, Sozial-, Natur-, Kognitions- und Lebenswissenschaften ist daher das größte Desiderat der zukünftigen Posthumanwissenschaften, oder wie auch immer der institutionelle Rahmen sich nennen wird, der die neue Wissensproduktion vom posthumanen, anthropodezentrierten Menschen und seinem Umfeld garantieren und kritisch begleiten soll.
Zweifelsohne haben also derzeitige Durchbrüche in der Bio-, Nano-, Kogno- und Info-Technologie den Einfluss der Technik auf die Technokultur, unter den politisch-ökonomischen Bedingungen des technowissenschaftlichen Kapitalismus, auf ein nie zuvor dagewesenes Niveau geschraubt. Die Rede ist von einer vollkommen neuen, digitalen, im Gegensatz zur analog-materiellen, Kultur oder cyberculture, von der fortschreitenden Prothetisierung des Menschen, von der „emergenten“ Autonomie künstlicher Intelligenz, welche in Kürze vom Menschen nicht nur nicht mehr kontrollierbar, sondern gar nicht mehr verstehbar sein wird. Willkommen demnach in der radikalisierten, von „Komplexität“ regierten, autopoietischen Informationsgesellschaft. Aronowitz und Menser schlagen daher eine dreifältige analytische Einrahmung von technokulturellen Fragestellungen vor: Ontologisch – was „ist“ Technologie? Pragmatisch – was „macht“ Technologie? Phänomenologisch – was „bewirkt“ Technologie? (1996: 15). Ontologisch gesehen wird unter den Vorzeichen der Posthumanisierung immer klarer, dass menschliches Sein immer schon durch und durch „technologisch“ war. Vom ersten Werkzeuggebrauch, über die „Rekursivität“ der symbolischen Sprache als ultimatives und vor allem „ontologisierendes“ Werkzeug (Sprache als unhintergehbare menschliche „Prothese“), bis zur gegenwärtigen physischen Verschmelzung von technischem Objekt und menschlichem Subjekt (Cyborgisierung), gibt es keine Humanität ohne Technik. Dies bewegt Bruno Latour dazu, das Gesellschaftliche nicht im Gegensatz, sondern im Zusammenhang mit der Objektwelt und „nicht-menschlichen“ Akteuren zu denken, also in einer Kombination von Gesellschaftstheorie und Technikgeschichte. Es ist die Interaktion zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren, die demnach „Sozialität“ ausmachen. Technologie spielt hierbei die Rolle eines „Stabilisators“, der Akteure und Beobachter in soziale „Zusammenfügungen [assemblages]“ einbindet. In diesem Sinne ist Technologie, nach Latour, „dauerhaft gemachte Gesellschaft“ – soziale Organisation „überdauert“ dank „ihrer“ Technologien (Latour, 1991). Pragmatisch gesehen ist Technologie immer auch Teil einer materiell-körperlichen Adaptation, eine Art „Biomacht“ im Sinne Foucaults und dies nicht erst seit der Moderne. Zudem war Technologie schon immer eine Brücke und Grenzverwischung zwischen „Natur“ und „Kultur“. Im Zeitalter der vollkommenen gegenseitigen Durchdringung gibt es aber strenggenommen die Natur und die Kultur nicht mehr (falls es sie denn je gegeben hat), sondern nur noch eine Vielzahl von „nature(s)culture(s)“, Naturkultur(en), so dass „Subjekt, natürlich-kulturell-technologisch, und ein soziales Tier, techno-sozial sein heißt“ (Aronowitz and Menser, 1996: 21). Phänomenologisch bewirkt Technologie eine „Mediation“ zwischen Mensch und Umwelt. In dem Maß wie Technologie als „Werkzeug“ Wirklichkeiten transformiert und schafft, macht sie diese auch allgemein zugänglich. Gleichermaßen bewirkt sie durch Rückmeldungsvorgänge auch Transformationen im Selbstverständnis des Nutzers. Wie aber bei allen Medien, ob sozial, technisch, kommunikativ, bildlich usw. (wobei diese Unterscheidung sowieso schwierig aufrechtzuerhalten ist), greift hier wiederum die poststrukturalistische Realismuskritik. Einerseits ist, nach McLuhan „das Medium seine eigene Botschaft“ – d.h. es liegt eine automatische „Selbstlegitimation“ des jeweiligen Mediums vor (ein Medium ist immer zuerst einmal darauf erpicht, sich selbst als einerseits unumgänglich, andererseits als transparent und daher wertneutral darzustellen), andererseits schafft es genau die Wirklichkeit, die es im Nachhinein wahrheitsgetreu vorgibt „nur“ abzubilden. Genauso verhält es sich mit Technologien – sie machen sich unentbehrlich und unsichtbar in gleichem Maße. Was Technologien also phänomenologisch bewirken ist im marxistischem Sinne eine (Selbst-) Entfremdung, in dekonstruktiv-postmarxistischem Sinne jedoch, eine Entfremdung von einem Selbst, das immer schon eine Illusion, also immer schon von sich selbst entfremded war. Eine Entfremdung der Entfremdung – différance, oder ein paradoxerweise absolut notwendiger Anhang [supplément] – in diesem Sinne stellt Technologie eine privilegierte Form des „Inhumanen“ dar, die immer schon im Kern des Humanen sitzt.
Ein weiterer theoretischer Rahmen spielt für einen kritisch-dekonstruktivistischen Posthumanismus eine wichtige Rolle. Weite Teile der Technikphilosophie, Kulturtheorie, Soziologie und vor allem der erwähnten CSS sehen den Posthumanismus, entweder im Einklang mit oder auch im Anschluss an die Postmoderne, als die nächste große Herausforderung und dementsprechend auch als die nächste Modewelle, die es zu reiten gilt. Es gibt zweifelsohne einen modischen oder populären Posthumanismus, aber auch einen philosophisch oder kulturtheoretisch seriösen. In Anlehnung an die Postmoderne-Diskussion beabsichtigt diese kritische Einführung, beide Diskursarten unter die Lupe zu nehmen. In Analogie zu Wolfgang Welschs Unsere postmoderne Moderne (1991), könnte man mit Bezug auf den Posthumanismus mit der aktuellen Frage nach „unserer posthumanen Humanität“ beginnen. Bei diesem Vergleich zwischen Postmoderne und Posthumanismus fallen sowohl Gemein-samkeiten als auch Unterschiede auf. Geimeinsam sind beiden ihre intellektuellen Wurzeln in der Kritik der Moderne und Aufklärung. Beide profitieren von einer gewissen Freisetzung des Denkens durch die Vernunftkritik, einem wiederentdeckten Hang zum spekulativen Theo-retisieren und der Relativisierung, Lokalisierung und Kontextualisierung eines Standpunktes, der sich seiner Arbitrarität und Kontingenz bewusst ist. Beide gehen von einer radikalen Offenheit und Pluralität von Bedeutung aus, in der erst das Einzelne (z.B. das Ereignis, das Subjekt) als „Singuläres“ seine volle Bedeutung erhalten kann. Ebenfalls in Analogie zur Postmoderne gibt es einen „feuilletonistischen“ oder „diffusen“ und einen konzeptuell ernstzunehmenden Posthumanismus. Andererseits baut der Posthumanismus zwar teilweise auf der Postmoderne auf, nimmt aber auch einige radikale Aspekte der Postmoderne zurück. Zeitlich gibt es dabei eine partielle Überschneidung und eine Parallelität. Daher auch das An-liegen dieser Studie, diese beiden verwandten und doch verschiedenen Denkformen sich quasi „gegenseitig“ lesen zu lassen. Ein Schema, wobei der Posthumanismus die Postmoderne oder zumindest den Postmodern-ismus einfach ablösen oder „beerben“ könnte, wäre zu einfach. Selbst-verständlich gibt es seit einiger Zeit Anzeichen für eine Abkehr von der Idee der Postmoderne. Aber gerade deshalb, um einen „backlash“ und eine simple politische Regression zu vermeiden, sollte bei einer Gewichtsverlagerung auf den Posthumanismus besondere Wachsamkeit ausgeübt werden. So besteht zum Beispiel die Gefahr, dass nach dem vermeintlichen Ende der großen Erzählungen (vgl. Lyotard, 1979), welches im Grunde die postmoderne Befindlichkeit ausmacht, die Diskussion um die menschliche Natur und die zukünftige Rolle der Technik sich derzeit zu einer neuen hegemonischen Erzählung herausbildet, die ihre eigene Unausweichlichkeit und Unabdingbarkeit immer glaubhafter darzustellen vermag. Dies richtet sich natürlich gegen den postmodernen Ethos, der auf radikale Pluralität und Demokratie zwischen heterogenen Visionen oder „Sprachspielen“ beruht. Während der Posthumanismus vielleicht als Akzentuierung und Beschleunigung einzelner Aspekte der Moderne angesehen werden kann, liegen diese jedoch eher auf der Seite einer aus der Aufklärung hergeleiteten „Rationalisierung“, die mit der zunehmenden und sich beschleunigenden Kapitalisierung einhergeht. Hiergegen könnte ein Rückgriff auf postmoderne Lektüren eine „Entschleunigung“, eine Demystifikation (vgl. Barthes) und eine Vervielfältigung innerhalb des posthumanistischen Denkens bewirken. Welschs Desiderat einer „transversalen Vernunft“, die der Pluralität der Rationalitätsformen gerecht werden soll (oder auch Lyotards „Paralogie“), käme hier die Aufgabe zu, sich gegen die (wiedererstarkte) Dominanz einer wissenschaftlich-technischen Vernunft zu wehren. Ein kritischer Posthumanismus muss sich die Lektion der radiaklen Pluralität und Heterogenität angesichts einer drohenden Wiederkehr der Utopie erneut verdeutlichen. Man könnte sogar soweit gehen, zu sagen, dass die Postmodernisierung (im Sinne von einer Hyperkapitalisierierung, Neoliberalisierung, Postindustrialisierung, usw.) der ökonomischen Basis, angetrieben von der sich intensivierenden Globalisierung, Virtualisierung, Technologisierung, voranschreitet, scheint der ideologische Überbau das Szenario der „Posthumanität“ zu benutzen, um von den Konsequenzen dieser immer intensiveren Konzentration von Macht und Kapital abzulenken. Das heisst nicht, dass eine Posthumanisierung nicht stattfindet, sondern dass es die Aufgabe eines kritischen posthumanistischen Denkens ist, alternative und demokratischere Formen posthumanistischer Gesellschaften als Gegenmodell zu entwickeln.
Man könnte, wie Pauline Marie Rosenau (1992) für das Denken der Postmoderne, auch beim Posthumanismus zwischen „affirmativen“ und „skeptischen“ Positionen unterscheiden. Während innerhalb der affirmativen Posthumanismen oder Posthumanisten das Spektrum von unreflektierter Euphorie bis zu einem gewissen technokulturellen Pragmatismus reicht, gibt es bei den posthumanistischen Skeptikern eine gleichartige Vielfalt von Katastrophisten bis eben zu einem dekonstruktiv-kritischen Posthumanismus, der hier vertreten wird. Schon Welsch erklärte das Spannungsverhältnis zwischen Postmoderne und dem, wie er es nannte, „Technologischen Zeitalter“ als „konkurrierende Gegenwartsdiagnose“ (1991: 215ff.). Der Zusammenhang zwischen Postmoderne und Technologischem Zeitalter wird „negativ, positiv und kritisch behauptet“. Negativ wird dieser Zusammenhang hauptsächlich in der deutschen Postmodernismusdebatte gesehen, insbesondere in der Nachfolge von Habermas, welcher Postmoderne mit „uneingeschränkter Affirmation technologischer Entwicklung“ und daher mit einem, vom Standpunkt einer sozialen und kulturell radikalen transformationellen „Projekt-Moderne“ gesehen, „Neokonservatismus“ gleichsetzt. Positiv wird die Beziehung Postmoderne/ Technologisches Zeitalter von weiten Teilen der anglo-amerikanischen Theorie gesehen, insbesondere dort, wo sie von Lyotard beein-flusst wurde. Eine Ausnahme bildet hierbei Fredric Jameson, der dem Phänomen Postmoderne ambivalent gegenübersteht und daher auch die Beziehung zwischen Postmoderne und Technologie als nicht eindeutig ansieht. Welsch weist zurecht darauf hin, dass die Grunderfahrungen der Postmoderne selbst technologisch induziert sind (vgl. Postindustrialismus, Virtualität und Baudrillards „Simulakrum“ und „Teleontologie“, sowie McLuhans Idee von der Vorherrschaft der Medien, sowie Lyotards Informationsgesellschaft). Andererseits kritisiert bereits Lyotard die potentiell uniformierende Wirkung der neuen Informationsmedien auf die Produktion von und den Zugang zu Wissen. Wir verbuchen also sowohl Lyotard als auch Welsch als Verbündete bei dem Unterfangen, einen kritischen Posthumanismus zu vertreten, der zwar technologische Veränderung sowohl vom ontologischen als auch epistemologischen Standpunkt aus ernst nimmt, aber gleichzeitig den „Ausschließlichkeitsanspruch“, der hieraus resultieren soll, anzweifelt und sich gegen eine gewisse „Automatisierung der Technologik“ (Welsch, 1991: 224) stellt.
Was sich seit der nunmehr „klassischen“ Postmodernediskussion, also seit den „postapokalyptischen“ 1980ern und 1990ern, verändert hat, ist dass seitdem ein neues Endzeit-Gespenst in populären und intellektuellen Kreisen umgeht, nämlich die Figur des Posthumanen in seiner Formenvielfalt. Diesmal geht es also um das „Ende aller Enden“, nicht die Selbstauslöschung irgendeiner mehr oder weniger abstrakten „Menschheit“ (wie z.B. zu Zeiten des Kalten Krieges) sondern das Ende des Menschen als biologischer Spezies und die Auflösung der „menschlichen Natur“ sozusagen „von innen“ heraus. Symptome dieser Auflösungserscheinung und Speziesangst sind allgegenwärtig und Beispiele, die die Technologien der Virtualisierung und Digitalisierung wie das Internet, die sogenannten „neuen Medien“, oder die generelle Umwandlung von Daten in elektronisch-digital speicherbare „Information“ betreffen, lassen sich mühelos anführen. Ob es sich um die Frage handelt, wieviele „bytes“ ein menschliches Gehirn speichern und verarbeiten kann, wie genau das Verhältnis zwischen virtueller und „aktueller“ oder tatsächlicher Realität zum Beispiel im Falle des sogenannten „virtual rape“ aussieht, inwieweit die „digitale Revolution“ einen gesellschaftlichen Fortschritt oder nur ein neues Instrument globaler Überwachung ist – es gibt kaum einen Aspekt der tagtäglichen Lebenspraxis, der nicht von diesem technologischen Wandel betroffen wäre. So betitelt beispielsweise Der Spiegel sein „Special“ (Nr. 3/2007): „Leben 2.0 – Wir sind das Netz: Wie das neue Internet die Gesellschaft verändert“. Was alle diese techno-kulturellen Praktiken, mit ihren neuen Möglichkeiten der Interaktivität und Selbstdarstellung, Kommunikation und „Identitätsarbeit“, gemeinsam haben ist, dass sie neue Subjektivitäten erzeugen, die teilweise zumindest von einer materiellen Körperlichkeit entkoppelt sind. Es ist nicht nur eine zusätzliche Lebensdimension, die sich hier auftut, sondern die neue, digitale Virtualität hat konkrete Auswirkungen auf und transformiert die sogenannte „tatsächliche“ Realität – ein Umstand, der wie in den nachfolgenden Kapiteln zu zeigen sein wird, den Begriff der Materialität und die Ontologie des humanistischen Weltbildes selbst infrage stellt.
Das neue Menschenbild der Neuro- und Kognitionswissenschaft, zusammenfassbar in der provokanten Herausforderung „The Mind as Machine?“, verändert ebenfalls allmählich das Selbstverständnis des Menschen, auch wenn dies nicht immer automatisch einen plötzlichen Wandel in der Alltagspraxis nachsichzieht. Populärwissenschaftliche Magazine sind jedoch eifrig damit beschäftigt, die neue Ideologie von der „Plastizität“ des Gehirns und des Selbsts zu verbreiten und mit der neuen Plastizität der „global capital flows“ in Einklang zu bringen. Der globale virtuelle Hyperkapitalismus braucht eben einen ebenso virtuellen und plastisch-flexiblen Träger. So betitelt zum Beispiel The Economist (23. Dezember 2006) einen Sonderanhang des Hefts mit „Who do you think you are? A survey of the brain”, und liefert seinen Lesern die neusten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über das menschliche Gehirn und seine extreme „Lernfähigkeit“. Der New Scientist vom 7. Oktober 2006 interessiret sich für das Thema „Mind fiction: your brain just can’t help telling tall tales“. Die französische Tageszeitung Le Monde führt eine wöchentliche ganzseitige Rubrik „Futurs“, in der sie jeden Sonntag/Montag neue technologisch induzierte, soziale Veränderungen analysiert und namhafte Wissenschaftler, Kulturkritiker, Künstler und technopraxisorientierte Experten dabei zu Wort kommen lässt. In der Ausgabe vom 11. und 12. November 2006 heißt es zum Beispiel „Entraîner son cerveau à volonté?“, wie die Implantation von Elektroden aber auch der Gebrauch von neuartigen Neuromedikamenten das sogenannte „brainbuilding“ fördert und die Intelligenz steigert. Auch Die Zeit veröffentlichte 2007 eine Serie „Die Suche nach dem Ich“, in der dieses neue Menschenbild vorgestellt wurde. So zum Beispiel am 16. August 2007 (S. 29) fragt Ulrich Bahnsen: „Bauteile für die Seele: Mit Chips und Sonden reparieren Mediziner Psycholeiden direkt im Hirn. Ist der Geist nur Biologie?“
Aber nicht nur das Gehirn als vermeintlicher Sitz des menschlichen „Geistes“ verformt sich unter dem Mikroskop der neuen Medizin, sondern auch die anderen Garanten einer menschlichen Natur geraten ins Wanken. Teile der Biowissenschaften oder der „Life Sciences“ arbeiten mittels der Schaffung anorganischer, künstlicher Lebensformen mit einem neuen, „postbiologischen“ Lebensbegriff. Dies stellt eine Cyborgisierung ganz anderer Art dar als die populistische Filmversion Arnold Schwarzeneggers als hypermaskuline Menschmaschine in Terminator. Nicht nur stellen diese neuen Wissensformen den Mensch als Endpunkt der darwinistischen Evolution in Frage, sondern sie öffnen auch in Zusammenhang mit der Gentechnik ganz neue Formen der „Hybridisierung“ (und damit De-essentialisierung) der sakrosankten menschlichen Natur. Nicht nur geklonte Menschen sind die neue Schreckensvision, sondern ganz andere Möglichkeiten tun sich in der neuen Gentechnologie auf: Chimären, „Nanovisionen“ von künstlichen Lebensformen (sogenannte „nanobots“), die entweder konstruktiv lebenserhaltend innerhalb eines Organismus Reparaturarbeiten vornehmen, oder auch destruktiv, sollten sie außer Kontrolle geraten, die ganze Welt in eine chaotische „graue Masse [grey goo]“ verwandeln könnten. Aber auch künstlich geschaffene Viren sind denkbar, die sowohl zu medizinischen als auch terroristischen Zwecken dienen könnten. Diese Ambivalenz wurde vom Times Higher Education Supplement (17. Mai 2002) provokativ so formuliert: „Bio-Luddites square up to friends of Frankenstein“ (16-17). Diskutiert wurde darin die sogenannte “designer babies”-Frage und die biotechnologisch induzierte Zukunft, wie sie z.B. von Francis Fukuyamas einflussreichem Buch Our Posthuman Future (2002) an die Wand gemalt wird, oder auch von Jürgen Habermas in Die Zukunft der menschlichen Natur: Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? (2002) befürchtet wird. Andererseits stellt die Schaffung eines Mikroorganismus, der bei der Herstellung von „Biosprit“ helfen könnte, die Lösung vieler Energieprobleme in Aussicht. Wie groß das Unbehagen in der Öffentlichkeit über diese neue „Eugenik“ ist kommt, bei der andauernden Diskussion um genmanipuliertes Saatgut zum Ausdruck: Einerseits als „Frankenstein food“ charakterisiert, andererseits als Heilmittel für die „Welthungerhilfe“ propagiert, symbolisiert die Gentechnologie die Krise des Humanismus und die radikale posthumane Undeterminiertheit des „neuen Menschen“. Wie Craig Venter (2007), einer der Gen-Gurus der Szene, es in der renommierten jährlichen „Richard Dimbleby Vorlesung“ der BBC 2007 ausdrückte:
Ich habe diese Vorlesung „Eine DNS-gelenkte Welt“ genannt, da ich glaube, dass die Zukunft unserer Gesellschaft zumindest teilweise in unserem Verständnis von Biologie und der molekularen Bausteine des Lebens, der DNS, liegt. Jede Ära wird durch ihre jeweiligen Technologien bestimmt. Das letzte Jahrhundert war das der Atomkraft, und ich behaupte, dass das vor uns liegende Jahrhundert grundlegend von den Vorstößen in der Biologie und meinem Arbeitsbereicht der Genomik, die den gesamten genetischen Aufbau einer Spezies untersucht, geformt werden wird.
Das Jahrhundert der Genetik also einerseits, anderseits proklamieren Neuro- und Kognitionswissenschaftler ebenfalls das Jahrhundert des Gehirns. Die spezifisch wissenschaftliche Herausforderung wird sein, die verschiedenen Stränge der Innovationstechnologien zu verbinden, also digitale Technologien, Nanotechnologie, neurokognitive Medizin, Robotik und digitale Mechanik mit der Genetik zu integrieren und vor allem der Öffentlichkeit als neues Menschenbild schmackhaft und für die Politik und Wirtschaft finanzierbar zu machen. Initiativen gibt es wie gesehen bereits in Vielzahl.
Bionische Hände, Implantate für Epileptiker, „smart drugs“ – die Prothetisierung und Cyborgisierung des Menschen intensiviert sich. Sie geht einher mit der Digitalisierung und Virtualisierung des kulturellen Umfelds und der Lebenspraxis von immer mehr Menschen. Die angstvolle Frage ist, ob dieser nächste Schritt in der menschlichen Evolution – auf dem Weg zur vermeintlichen „Posthumanität“ – einerseits neue Ungleichheiten schafft, neue Formen der Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung, oder andererseits, ob diese Entwicklung für die Spezies Mensch nur eine Zwischenstufe der Evolution ist, das Anfang vom Ende sozusagen. Haben wir uns mit Gedeih und Verderb der Technik und der posthumanen Technologiesierung verschrieben und damit unseren evolutionären „Nachfolger“ bereits geschaffen? Wartet „die Maschine“ nur auf unser endgültiges Abdanken? Ist der Cyborg nur ein erster aber irreversibler Schritt auf dem Weg der Machtübergabe? Dies wiederum wirft die Frage nach Formen der „Koexistenz“ auf. Nimmt man den Begriff „künstliche“ Intelligenz wörtlich, wird klar, dass eine KI weder notwendigerweise nach humanistischen Prinzipien, noch nach humanen, funktionieren muss. Wie also sich einer künstlichen Intelligenz gegenüber verhalten, wenn sie dann einmal tatsächlich auftritt und „autopoietisch“ wird? Ethische ebenso wie politische Fragen tun sich auf: Muss es Rechte (und Pflichten) für „die Maschine“ geben? Haben Maschinen Identität, Kultur, oder eine eigene Ästhetik? Diese Diskussion ist deswegen schwer abzutun, da „die Maschine“ nur eine Form der traditionellen Abgrenzung des Menschlichen gegenüber seinem „Anderen“ oder eher seinen „Anderen“ ist. Die neuen Technologien werfen nicht nur die Frage nach dem Menschen erneut und in dringlicher Form auf, sie stellen sein gesamtes humanistisches Kategorisierungs- und Ausgrenzungssystem in Frage. In dem Augenblick, wo der Mensch „verschwindet“ tauchen alle seine verdrängten Identitätsstifter wieder auf, und die gesamte Geschichte der Anthropozentrik wird aufgerollt: Die „Objektwelt“, die „Tierwelt“, der „Kosmos“ (vgl. z.B. den Ansatz eines Richard Dawkins, oder auch den des eminenten Astronomen Martin Rees, der sich und uns eindringlich die Frage stellt, ob das 21. Jahrhundert „unser letztes“ sein wird; Rees, 2003). Die gesamte gespenstische Ontologie (oder „hantologie“, vgl. Derrida, 1993) macht auf einmal (wieder) klar, wie „Teratologien“, die Schaffung von Monstern, die Darstellung von Unmenschlichkeit, Animalisierung, Objektivierung, Fetischismus aber auch Spiritualisierung und Religion genutzt werden können, um unter dem Deckmantel einer mystischen menschlichen „Natur“ ihres einzigartigen Wesens Unterschiede und Hierarchien festzuschreiben, Inklusion und Exklusion zu betreiben, alte Tabus zu verteidigen und neue zu schaffen. Allein deshalb darf ein kritischer Posthumanismus den technologischen Wandel nicht ablehnen, auch wenn er ihn freilich auch nicht idealisieren sollte. Die Pluralisierung und Fragmentierung des Humanitätsprinzips (insbesondere durch die Auflösung der traditionellen Kategorisierungsgrenzen zwischen Mensch und Tier, „Übermensch“, „Untermensch“, „Unmensch“ usw.) setzt eine Kritik an der Geschichte des Humanismus frei. Darüberhinaus stellt sie eine neue Herausforderung für die ästhetische Verarbeitung der conditio humana oder vielmehr der neuen conditio posthumana dar, die der simplen Ideologisierung aus Angst vor oder Euphorie über eine kommende Transhumanität (hier im Gegensatz zur Posthumanität gebraucht), wie sie in der öffentlichen Debatte um die Eugenik entgegensteht.