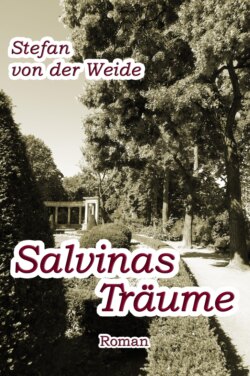Читать книгу Salvinas Träume - Stefan von der Weide - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zarina
ОглавлениеDie Turmuhr der nahe gelegenen Kirche schlug dreimal. Ihre Schläge hallten lange nach. Wie sanfte Meereswellen, hob und senkte sich ihr Klang, mal lauter, mal leiser, mal höher, mal tiefer. Schließlich ebbten die Wellen ab, der Ton wurde schwächer und schwächer. Dann verstummten die Schläge und gaben der Nacht ihre Stille zurück.
Um diese Zeit fuhr kein Wagen mehr durch die kleine Nebenstraße, die unter dem Schlafzimmerfenster vorbeiführte. Auch dem Verkehrslärm der Hauptstraßen der Großstadt gelang es nicht, durch die umliegenden hohen Häuserfluchten hindurch in das Schlafzimmer zu dringen. Das Haus lag in einer Oase der Ruhe inmitten des Stadtzentrums.
Im Schlafzimmer war es dunkel. Lediglich ein schwacher Lichtschein drang von der Straßenlaterne durchs Fenster herein in den ersten Stock und strahlte von der weißen Zimmerdecke zurück. Bevor er sich in der Dunkelheit der Nacht verlor, zeichnete er die Konturen der Einrichtung nach. Ein Kleiderschrank, eine Kommode, ein Nachttisch und ein Bett drängten sich dicht aneinander und füllten den Raum. Das Zimmer war mehr hoch als breit, so hoch hatte man in Europa zu Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts gebaut.
Das Bett stand mit dem Kopfende neben dem Fenster in der Ecke des Schlafzimmers. Die Bettdecke hob und senkte sich im gleichmäßigen Rhythmus des Atems der jungen Frau. Das schwache Licht verlieh ihrem Gesicht einen gelassenen und entspannten Ausdruck. Sie wirkte zufrieden, beinahe glücklich. Sie schlief.
Neben ihrem Bett kniete ein älterer Mann. Still und abwartend kniete er, beinahe stoisch. Seine Hände ruhten in seinem Schoß, seine Schultern hingen leicht herab. Dann richtete er sich langsam auf. Er stützte sich vorsichtig auf die Bettkante und blickte auf die geschlossenen Lider der jungen Frau. Zögernd, fast unentschlossen streckte er seine Hand nach ihr aus.
Jetzt begannen die Augen der jungen Frau, sich schnell hin und her zu bewegen. Ihre Augenlider zitterten. Ihr Atem wurde kürzer. Eine heftige Bewegung ihres Armes wehrte seine Berührung ab. Kaum sichtbar öffnete sie die Lippen und stöhnte Unverständliches. Im Schlaf sprach sie zu ihm. Im Schlaf spürte sie seine Nähe. Noch einmal stöhnte sie. »Hau ab!«, sagte sie, diesmal deutlicher, und schlief weiter. Unruhig jetzt, aber noch schlief sie.
Hastig legte er seine Hände zurück in den Schoß und nahm wieder seine wachende Stellung ein. Die Worte der jungen Frau galten ihm, daran gab es keinen Zweifel. Dennoch blieb er. Dennoch wartete er, als hoffte er auf ihre Milde.
Nach kurzer Zeit stieß sie einen tiefen Seufzer aus und drehte ihren Kopf zur Wand. Danach atmete sie wieder ruhiger. Ihre Augen bewegte sie nun nicht mehr. Noch einmal sank sie zurück in ihren tiefen Schlaf.
Der ältere Mann fasste neuen Mut. Nochmals richtete er sich auf. Er beugte sich über sie und nahm vorsichtig ihre Hand. Zweimal küsste er ihre Hand, dann legte er sie behutsam zurück auf die Bettdecke. Danach rutschte er langsam auf den Knien entlang der Bettkante. Wieder beugte er sich vor. Mit seinem Mund an ihrem Ohr verweilte er einen Moment. Schließlich flüsterte er:
»Tu es nicht, Salvina! Bitte, tu es nicht!«
Salvinas Augen begannen, sich wieder heftiger zu bewegen. Bald wurde auch ihr Atem wieder schneller und gepresster. Sie bewegte die Arme und drehte ihren Kopf dem Mann zu. Nach ein paar heftigen Atemzügen öffnete sie langsam die Augen. Zuerst lächelte sie, als sie ihren Vater erkannte, doch in ihrer Schlaftrunkenheit wusste sie nicht, was seine Anwesenheit bedeutete. Erst als sie mehr und mehr erwachte, begann sie, die Situation zu begreifen.
Vor Entsetzen riss sie die Augen noch weiter auf. Sie wollte zurückweichen, versuchte sich aufzurichten. Mit beiden Füßen drückte sie sich von der Matratze weg, verlor den Halt, setzte ihre Füße erneut an und verlor abermals den Halt. Nur Stück für Stück gelang es ihr, vor ihrem Vater zurückzuweichen. Doch schon bald versperrte ihr die Wand den Weg zurück. Sie presste ihren Rücken in die Ecke und versuchte, sich so klein wie möglich zu machen und möglichst viel Abstand zu ihrem Vater zu gewinnen. Schließlich begann sie, am ganzen Körper zu zittern.
Für einen kurzen Moment kribbelte es in ihren Beinen. Dann erschlafften ihre Schenkel und Waden und wurden taub. Plötzlich konnte sie ihre Beine nicht mehr bewegen. Als wären sie von ihrem Körper abgetrennt, so lagen sie nun ausgestreckt vor ihr. Verzweifelt versuchte sie, ihre Beine anzuwinkeln, um sich mit ihren Füßen weiterhin von der Matratze wegdrücken zu können, aber sie gehorchten ihr nicht mehr. Salvina verlor den Halt und sank mit ihrem Oberkörper zurück auf die Matratze.
Bebend öffnete sich ihr Mund. Sie wollte schreien, laut ihre Angst in die Dunkelheit der Nacht hinausschreien. Doch sie brachte keinen Ton heraus. Wie gelähmt lag sie in ihrem Bett und konnte sich nicht wehren. Hilflos und verletzbar.
Ihr Vater rührte sich nicht. Er sah sie nur an. Die Verzweiflung seiner Tochter nahm er ohne Regung hin. Er nahm sie hin, als wäre es die Verzweiflung einer geistig Verwirrten. So, als wartete er auf den Pfleger mit der Spritze oder der täglichen Dosis eines Neuroleptikums. Dann wiederholte er seine Worte:
»Tu es nicht, Salvina! Bitte, tu es nicht!«
Jetzt löste sich in Salvinas Brust der erste Ton. Zuerst leise und verhalten, doch von Atemzug zu Atemzug wurde er lauter und tiefer. Bald dröhnte eine alles erschütternde Stimme aus ihrer Brust, einer Brust, die viel zu schmal und viel zu zart schien, um solch eine tiefe und kräftige Stimme zu erzeugen.
Es konnte nicht sein. Es durfte nicht sein. Trotzdem kniete ihr Vater neben ihr. Als wäre nichts geschehen, als wäre das Leben weiter verlaufen wie zuvor. Aber das war es nicht.
Vor drei Jahren hatte sie ihn gefunden, am Abend seines Todes. Sie hatte seinen viel zu kalten Körper berührt, vergeblich versucht, seinen offenen Kiefer zu schließen. Dennoch hatte sie in ihrer Verzweiflung gehofft, sie könnte ihn ins Leben zurückholen. Sie hatte sein Herz massiert, ihn beatmet und gleichzeitig gewusst, dass es zu spät war. Sie kannte die sicheren Zeichen des Todes, die Starre, die Flecken. Trotzdem hatte sie auf ein Wunder gehofft, als sie den Notarzt verständigte. Erst als dieser den Tod bestätigte und den Totenschein ausstellte, gab sie ihr Hoffen auf eine Wiederbelebung auf. Es gibt kein Zurück, hatte der Arzt gesagt, ihr Vater war schon seit Stunden tot, wahrscheinlich seit dem frühen Vormittag, vielleicht sogar schon seit dem Morgengrauen.
Dann ging er, der Arzt. Er ließ Salvina mit dem Körper ihres Vaters allein, und plötzlich war es still. Wie grauer Nebel machte sich die Stille im Raum breit und verdrängte alles Lebendige. Die Anwesenheit des Todes lässt alles Leben verstummen. Salvina saß noch lange neben dem leblosen Körper, der noch vor wenigen Stunden ihr Vater gewesen war. Sie spürte einen tiefen Schmerz in ihrem Leib, ihr Bauch schnürte sich zusammen, ihre Atmung wurde flach, ihr Geist leer, ihr Gemüt taub. Erst jetzt hatten sich die ersten Tränen gelöst. Es war der Schock, der sie – wie eine Wand aus dickem, milchigem Glas – von der Realität getrennt hatte. Es war auch der Schock, der sie die vergangenen ein, zwei Stunden wie in Trance hatte handeln lassen. Doch jetzt löste sich der Schmerz und überflutete ihre Seele mit einem Sturzbach aus Trauer, Verzweiflung und auch Wut. Lange saß sie am Bett ihres toten Vaters, halb auf ihm liegend, ihr Leib bebte, ihre Haut im Gesicht und am Hals weichte auf von der Flut ihrer Tränen und wurde rot und wund. Salvina konnte die Tränen nicht stoppen. Gegen diesen Schmerz und diese Trauer war sie machtlos.
Später rief sie ein Bestattungsinstitut an, und nach wenigen Stunden musste sie zusehen, wie zwei Männer den Körper ihres Vaters in einen Sarg legten, den Sarg verschlossen, und ihren Vater darin wie eine Ware abtransportierten. Plötzlich war sein Leben nicht mehr. Seine Wohnung war leer und stumm, zu einer Kulisse erstarrt.
Doch jetzt kniete er neben ihr, in ihrem Schlafzimmer, das damals das seine gewesen war. Hier hatte er gelegen, in seinem Bett, als sie ihn gefunden hatte. Salvina hatte sein Bett nach seinem Tod verkauft. Damals lag er im Bett und bewegte sich nicht mehr, und Salvina kniete neben ihm und versuchte, ihn ins Leben zurückzuholen, zurück zu ihr, sie hatte nur ihn. Jetzt lag sie in ihrem neuen Bett, und er kniete neben ihr.
Salvina schrie aus voller Brust. Sie hatte Angst. Der Mann an ihrem Bett konnte unmöglich ihr Vater sein. Ihr Vater war tot, sie selbst hatte doch seinen Tod festgestellt, sie selbst hatte ihn begraben. Und trotzdem war er es, der neben ihr kniete. Entgegen jeglicher Vernunft wusste sie, spürte sie, dass er es war.
Wie oft hatte sie in den vergangenen Jahren glauben wollen, er hätte lediglich eine Reise unternommen. Wie oft hatte sie glauben wollen, er stünde plötzlich vor der Tür, zurückgekehrt von dieser Reise. Immer wieder versuchte sie zu begreifen, dass seine Reise eine Reise ohne Wiederkehr war. Aber sie konnte es nicht begreifen. Sie konnte sich nicht vorstellen, wohin ihr Vater so plötzlich verschwunden war. Sie wollte es nicht glauben, dass sich das Leben auflöst und nichts davon übrig bleibt.
Plötzlich wurde sie von einem lauten Donnerschlag aufgeschreckt. Der Donner befreite sie aus der Umklammerung ihrer lähmenden Angst. Noch im Aufwachen schrie sie mit ihrer tiefen Stimme. Doch ihr Schrei war nicht so kräftig und frei, wie sie ihn geträumt hatte, er war verhalten, mehr ein tiefes Stöhnen. Sie saß aufrecht in ihrem Bett, nur ihre Füße steckten unter der Bettdecke. Wieder durchzuckte ein gleißend heller Blitz die dunkle Nacht. Sofort zischte und polterte der Donner, als wollte er die ganze Stadt in Schutt und Asche legen. Dann prasselte der Regen.
Im Schein des Blitzes konnte Salvina sehen, dass sie alleine war. Wo war ihr Vater? Noch eben hatte er seine Bitte ausgesprochen, er konnte nicht plötzlich verschwunden sein. Panisch griff sie nach dem Schalter der Nachttischlampe. Mehrmals musste sie nachfassen, bis ihre Finger den Kippschalter greifen konnten. Als sie ihn drückte, und die kleine Lampe ihr Schlafzimmer in ein mildes Licht tauchte, erkannte sie die Wirklichkeit. Sie hatte geträumt. Sie hatte die Rückkehr ihres Vaters nur geträumt.
Allmählich schlug ihr Herz ruhiger, und ihre Anspannung legte sich. Erschöpft sank sie zurück in ihr Bett. Sie zog die Decke bis unters Kinn und atmete tief durch. Manchmal durchlebte sie ihre Träume so realistisch, dass sie nicht mehr zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden konnte. Es waren die Details, die es ihr schwer machten, ihre Erlebnisse einzuordnen.
Sie starrte auf die Zimmerdecke und klammerte sich mit beiden Händen an die Bettdecke, so, als wollte sie sich darunter verstecken. Sie fragte sich, weshalb sie im Traum diese panische Angst vor ihrem Vater hatte. Niemals zuvor hatte sie Angst vor ihm gehabt. Weder zu seinen Lebzeiten noch in ihren Träumen nach seinem Tod. Es konnte also nicht sein, dass sie vor ihm Angst hatte. Ihr Vater musste in diesem Traum für etwas stehen; in Form eines Gleichnisses etwas repräsentieren. Doch was?
Sie wusste, dass Träume mit Symbolen arbeiten. Schon oft hatte sie versucht, die Symbolsprache ihrer Träume zu entschlüsseln. Schon oft war sie daran gescheitert. Und diesmal drohte sie wieder zu scheitern, denn das Einzige, was ihr zu ihrem Vater einfiel, war, dass er tot war.
Das ist es, dachte sie augenblicklich. Mein Vater symbolisiert in diesem Traum den Tod!
Und davor hatte sie Angst. Sie hatte Angst vor der Unabänderlichkeit des Todes. Sie hatte Angst, sterben zu müssen.
Aber es gab keinen Grund, keinen aktuellen Anlass. Sie war jung, sie war gesund. Sie hatte ihr Leben noch vor sich. Aber das Leben raste an ihr vorbei. Sie lief Gefahr, ihr Leben zu versäumen. Sie lief Gefahr, sich im Alltag zu verlieren.
Als Kind hatte sie davon geträumt, in Weiß zu heiraten. Sie hatte davon geträumt, nicht mehr allein zu sein. Gemeinsam mit ihrem Mann wollte sie ihre Einsamkeit überwinden. Und Kinder wollte sie haben, mindestens einen Jungen und ein Mädchen. Damals hatte sie sich oft Geschwister gewünscht; ihre eigenen Kinder sollten es besser haben als sie. Doch Kinder ahnen nichts davon, dass viele ihrer Träume Stück für Stück zerbröckeln, sobald sie erwachsen werden. Das mit der Hochzeit hatte bis jetzt nicht geklappt. Das mit den eigenen Kindern auch nicht. Jetzt war sie achtundzwanzig und hatte immer noch keinen Mann gefunden, mit dem sie Kinder haben wollte. Es gibt keine Männer mehr, die Verantwortung übernehmen wollen, dachte sie. Zumindest lernte sie solche Männer nicht kennen. Aber das war kein Wunder, denn die Männer, die sie kennenlernte, waren ausschließlich Kunden ihres Ladens, und die waren meist wesentlich älter als sie, etabliert und uninteressant. Sie sehnte sich sehr nach Liebe, nach Zweisamkeit, nach Vertrauen und nach einer eigenen Familie.
Salvina löschte das Licht und schlief weiter.
Am Morgen stand sie mit weißen Socken in ihren weißen Sandalen am offenen Fenster ihrer Küche. Kühle Morgenluft umwehte ihr Gesicht. Sie liebte das befreiende Gefühl der frischen Luft an Hals und Nacken. Meist flocht sie ihr Haar zu einem dicken Zopf, mit dem sie auch die Stirn- und Schläfenhaare bändigte, damit kein Haar ihren Hals bedeckte.
Sie schloss die Augen und atmete dreimal tief durch. Danach beugte sie sich weit nach vorne, stützte sich auf die Ellbogen und sah an der Außenmauer des Hauses hinab auf die Straße.
Der heiße Sommer war nun endgültig vorbei. Die Luft war klar und rein an diesem Montagmorgen. Die Gewitterfront der Nacht hatte alles abgekühlt und die Schwüle vertrieben. Das Grün der Bäume in dem kleinen, nahe gelegenen Park war schon seit vielen Tagen mit braunen Flecken durchsetzt. Viele Blätter waren während der nun vergangenen Hundstage vertrocknet und schrumpelig geworden, für eine herbstliche Färbung war es noch viel zu früh. Aber der nächtliche Regen würde den Bäumen das Grün nicht wieder zurückgeben können. In zwei Monaten würde sich die Natur dann ihrem Winterschlaf mit einem letzten Feuerwerk ergeben.
Die Natur und auch wir Menschen streben gerne auf Höhepunkte zu. Im Höhepunkt liegt die Fülle des Lebens. Die Quellen der Freuden und des Glücks scheinen unversiegbar zu sein, solange es – dem Höhepunkt entgegen – bergauf geht. Doch jeder Höhepunkt ist auch der Beginn des Abstiegs. Der Höhepunkt ist gleichzeitig der Wendepunkt in der Natur, im Leben – und auch bei uns Menschen. Dort, wo das Leben am üppigsten ist, zeigt sich schon dessen Ende. Am Höhepunkt des Sommers sind die ersten Früchte gereift, und es fallen die ersten Blätter von den Bäumen. Am Höhepunkt des Sommers wird die Erde trocken und das Gras braun. Was dann noch kommt, trägt nicht mehr die Hoffnung auf eine Steigerung in sich. Was dann noch kommt, sind letzte Feuerwerke, sind die Funken des erlöschenden Feuers. Was dann noch kommt, ist die Erinnerung an die Blütezeit des Lebens. Es ist der Abstieg, der schneller geht als der Aufstieg. Die Knochen schmerzen, die Muskeln sind müde, die Kraft lässt nach. Im Abstieg freuen wir uns auf die Ruhe. Doch im Abstieg lauert eine große Gefahr, denn nicht selten kommt mit dem Abstieg auch der Fall.
Salvina kannte diese Gefahr sehr gut. Sie hatte sie schon bei sich selbst gespürt, bei anderen erlebt. Und nun sah sie am Ende der schmalen Straße einen alten Mann um die Ecke kommen. Wie eine schwere Bürde lastete sein knielanger, verschlissener Mantel auf seinem Körper. An den hängenden Schultern und der gebückten Haltung konnte sie ihn sofort erkennen. Dicht an die Mauern der alten Stadthäuser gedrängt, humpelte er in kleinen, langsamen Schritten seinen mühevollen, vom Fall gekennzeichneten Weg.
Nach ein paar Schritten blieb er stehen und beugte sich noch tiefer. Nur mit Anstrengung konnte er den Boden erreichen. Dort hob er etwas auf, betrachtete es von allen Seiten und steckte es schließlich zwischen seine Lippen. Aus seiner Manteltasche holte er ein Feuerzeug und zündete den Zigarettenstummel an. Mehrmals zog er an dem Stummel, er nahm ihn nur vom Mund, um den inhalierten Rauch wieder auszuatmen.
Plötzlich bekam er einen Hustenanfall. Der wenige Tabak war verbrannt, und die feinen Kunststofffäden des Filters begannen zu schmoren. Der ätzende Rauch raubte ihm den Atem. Nach mehreren Hustenattacken drehte er seine starre Hand, um die Glut der Zigarettenkippe sehen zu können, die er zwischen Zeigefinger und Daumen hielt. Schließlich warf er sie zu Boden und zwang seine schwachen Beine, den Weg fortzuführen.
Salvinas Augen folgten ihm auf seinen letzten Metern. Noch einmal atmete sie kräftig durch. Sie wollte die Entschlossenheit der frischen, reinen Luft in ihren Tag hinüberretten. Dabei schaute sie dem alten Mann zu, wie er vor dem Eingang des Antiquitätenladens unterhalb ihrer Wohnung stehen blieb und sich wie jeden Tag dicht an die Tür drängte.
Salvina schloss leise das Fenster, nahm den Schlüsselbund vom Tisch und verließ ihre Küche. Kurz inspizierte sie noch die Wohnung, ob alle Fenster geschlossen und alle Lichter gelöscht waren, dann trat sie von ihrem durch Spiegel und weiße Wände erhellten Flur ins düstere, stickige Treppenhaus. Schon als Kind hatte sie von einer Fensterfront geträumt, die sich über alle vier Etagen des Hauses erstrecken sollte, damit Licht und Leben das alte Treppenhaus durchfluten könnten.
Die Deckenbeleuchtung stammte aus den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine einzige Lampe je Stockwerk, mehr wäre damals Luxus gewesen. Zu dieser Zeit war ihr Vater noch ein Kind. Für Luxus hatte seine Familie kein Geld. Das sah Salvina ein. Aber später hätte er eine weitere Lampe über der Wohnungstür anbringen und statt der schwachen Glühbirne eine mit hoher Leistung einsetzen können. Wie hatte er nur in dieser Dunkelheit das Schlüsselloch finden können?
Einen Stock tiefer betrat Salvina den Laden. Sie schaltete das Licht im Verkaufsraum und in der kleinen Küche des Ladens ein, denn auch hier war es düster. Dann ging sie zur Eingangstür. Der alte Mann richtete sich bei ihrem Anblick auf, und seine Augen begannen zu leuchten. Lächelnd öffnete ihm Salvina die Tür und bat ihn herein. Ein morgendlicher Ritus.
»Salvina, meine Kleine. Du wirst von Tag zu Tag noch hübscher. Aber was ist mit dir? Du lächelst und siehst trotzdem aus, als würdest du einen Trauerzug anführen.«
»Findest du mich wirklich hübsch?«, fragte Salvina.
»Also hör mal. Wenn ich jung wäre, dann …« Er stockte. Mit einer heftigen Armbewegung wischte er den Gedanken beiseite und trat an Salvina vorbei in den Laden.
Paule kannte den Weg in die kleine Küche. Wie jeden Tag eilte er voraus, ohne die dicht gedrängten Möbelstücke, Vasen, Gläser etc. zu streifen. Schon oft war Salvina aufgefallen, dass er in ihrer Nähe nicht humpelte. Sie schloss die Tür und folgte ihm.
In der Küche blieb Paule wie jeden Tag neben dem Tisch stehen. Als würde er sich erst dort bewusst werden, dass der Laden nicht sein Zuhause war, wartete er, bis Salvina ihm seinen angestammten Platz anbot. Aber Salvina trat an die Arbeitsplatte und bereitete den täglichen Kaffee. Sie vergaß es, Paule Platz anzubieten. Während die Kaffeemaschine lief, fragte sie: »Was wäre dann, wenn du noch jung wärst?«
Aus dem Augenwinkel sah sie, dass er sich noch immer unsicher an der Stuhllehne festklammerte und sich nicht zu setzen traute. Und sie beobachtete, wie bei ihrer Frage sein Gesicht sofort errötete. Zögernd antwortete er: »Dann würde ich dich fragen, ob du mich heiratest.«
Salvina machte einen Schritt zur Seite. Einen Schritt weg von Paule und hin zum Fenster. Einen unnötigen Schritt, denn sie war zuvor schon außer Griffweite von ihm gewesen. Jetzt stand sie seitlich zur Kaffeemaschine und musste ihren Arm fast verrenken, um sie ausschalten und die Kanne entnehmen zu können. Auf ihrem Weg zum Tisch erwiderte sie: »Warum solltest du ausgerechnet mich heiraten wollen? Deine Frau war nicht nur hübscher als ich, sie war ausgesprochen schön. Und ihr habt euch geliebt. Du brauchst mir nicht zu schmeicheln. Ich weiß, wie ich aussehe. Und heiraten werde ich sowieso niemals.«
»Red keinen Unsinn! Wer unglücklich sein will, findet immer einen Grund dafür. Wenn du ehrlich bist, dann musst du zugeben, dass es die Natur gut mit dir meint.«
»Setz dich erst einmal hin«, sagte Salvina und rückte ihm den Stuhl etwas nach hinten, damit er mit seinem schwerfälligen Körper Platz nehmen konnte. Dann schenkte sie ihm seinen täglichen Kaffee ein und setzte sich zu ihm.
Sie schaute auf sein langes, struppiges Haar. Klebrige, verfilzte Strähnen hingen herab. Entlang seines Haaransatzes zog sich ein fast schwarzer Schmutzrand. Wie gebannt blickte Salvina Paule an. Als er ihren Blick erwiderte, schaute sie hastig zur Seite und sprach weiter:
»Weißt du, Paule, als ich noch ein Kind war, hat mich mein Vater oft mein hässliches Entlein genannt, wenn er nett zu mir sein wollte. Das prägt.«
Paule nickte nachdenklich und sagte in seiner ruhigen Stimme: »Ja, all das prägt uns, von dem wir wollen, dass es uns prägt. Aber sag mal, das hässliche Entlein, war das nicht der von allen verkannte Schwan? Schwäne sind majestätisch. Dein Vater wollte damit bestimmt nur deine nicht sofort ins Auge stechende Schönheit andeuten.«
»Siehst du, jetzt sagst du es selbst, dass ich nicht schön bin.«
»Nein, das sage ich nicht. Deine Schönheit ist nur nicht so augenfällig. Auf den ersten Blick wirkst du eher unscheinbar, aber je länger man dich ansieht, desto mehr erkennt man, wie schön du bist. Menschen, die ihre Schönheit offen zur Schau stellen, verblassen dagegen bei genauerer Betrachtung.«
Salvina schüttelte den Kopf. Mit zusammengekniffenen Augen entgegnete sie: »Das ist lieb von dir, aber ich weiß, dass mich mein Vater wegen meiner langen und krummen Nase so genannt hat. So lang und krumm wie der Hals eines Schwans.« Nach einer Pause fügte sie hinzu: »Außerdem schauen mir alle fremden Leute immer zuerst auf die Nase, wenn ich mit ihnen spreche.«
»Und deshalb meinst du, dass du hässlich bist.«
»Nein«, antwortete Salvina. »Hässlich bin ich nicht, aber meine Nase entstellt mein Gesicht. Ich weiß, dass ich nicht hübsch bin.«
Paule lachte. Dabei hob sich sein Oberkörper stoßweise, sodass Salvina den Eindruck hatte, er würde kollabieren. Nach ein paar Stößen beruhigte er sich wieder und sagte: »Deine Nase ist ungewöhnlich, und die Leute schauen immer auf das, was nicht ihrer Vorstellung von Norm entspricht. Ich finde sie interessant.«
»Das behaupten alle, dass sie das Ungewöhnliche interessant finden. Aber wenn sie die Wahl haben, entscheiden sie sich für das Gewöhnliche, weil ihnen nur das wirklich gefällt.«
Diesmal wiegte Paule nachdenklich den Kopf. Nach einer Weile sagte er: »Das glaube ich nicht, dass sich die Menschen für das Gewöhnliche entscheiden, weil es ihnen besser gefällt. Ich glaube, sie entscheiden sich dafür, weil es ihnen bekannter ist. Das Bekannte lässt sie vertrauen, und Vertrauen gibt ihnen Sicherheit. Die Menschen brauchen Sicherheit, damit sie an ihre Zukunft glauben können, deshalb wählen sie das Gewöhnliche.«
Salvina verschränkte die Arme und lehnte sich zurück. Dabei sah sie zur Zimmerdecke und entgegnete: »Warum sich die Menschen für das Gewöhnliche entscheiden, ist mir egal. Ausschlaggebend ist für mich, dass ich nicht hübsch bin. Und das hat mir mein Vater schon gezeigt, als ich noch ein Kind war. Er hatte kein Gefühl für die Verletzbarkeit der Seele eines Kindes.«
»Du willst sagen, dein Vater hatte kein Gefühl für deine Verletzbarkeit«, fiel ihr Paule ins Wort. Er fixierte Salvinas Augen, beobachtete ihre Reaktion. Da sie aber noch immer zur Decke sah, sprach er weiter: »Er wollte dich nicht verletzen. Er wollte dir zeigen, dass er dich so liebt, wie du bist.«
»Mein Vater?«, rief Salvina mit erhobener Stimme und wandte sich Paule zu. »Der hat nur sein Geschäft geliebt. Und das Geld.«
Paule sah sie grimmig an und sagte: »Du darfst nicht schlecht über deinen Vater reden, er war mein bester Freund.«
»Ja, weil er dein einziger war. Aber wie war das nach dem Tod deiner Frau, als du krank geworden bist und alles verloren hast? Hat dir mein Vater da geholfen?«
Paule sah erschrocken auf. Der obere Teil seiner Wangen wurde kreidebleich. Es waren neben Augen und Stirn die einzigen Stellen seines Gesichts, die Salvina zwischen seinem üppigen Haar- und Bartwuchs hindurch sehen konnte. Hastig sagte er: »Darüber will ich nicht reden. Dein Vater hatte seine Gründe.«
»Gründe! Mein Vater hatte immer seine Gründe«, erwiderte Salvina energisch. »Wie kannst du ihn nur verteidigen, wo er dir das Leben hätte retten können, wenn er wenigstens dieses eine Mal nicht auf seinen Prinzipien beharrt hätte!«
Mit verschränkten Armen lehnte sich Paule zurück und schüttelte leicht den Kopf. Kraftlos entgegnete er: »Das konnte dein Vater damals noch nicht wissen.«
Salvina richtete sich auf und beugte sich Paule entgegen. Mit angespitztem Mund sprach sie deutlich artikuliert: »Du hast ihn darum gebeten, bei ihm wohnen zu dürfen. Er wusste, dass du ohne seine Hilfe auf der Straße landen würdest.«
Paule senkte das Gesicht und fixierte mit seinen müden Augen den Tisch. Er atmete laut und schwer. Beinahe flehend flüsterte er: »Ich will darüber nicht mehr reden.«
Salvina beugte sich noch weiter vor und stützte sich mit den Unterarmen auf den Tisch. Mit leicht gerötetem Gesicht insistierte sie: »Du hattest gehofft, wieder eine Arbeit zu finden, wenn dir mein Vater wenigstens ein Zimmer gegeben hätte.«
»Ja«, fuhr Paule, sich plötzlich aufbäumend, mit zittriger Stimme fort. Seine blassen Augen glänzten hilflos. »Wie du weißt, hatte er keinen Platz für mich.«
Salvina wusste, dass nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu dreißig Menschen in den drei Wohnungen des Hauses gelebt hatten. In der zerstörten Stadt war Wohnraum knapp. Die Aufnahme fremder Menschen und ganzer Familien wurde von amtlicher Seite angeordnet. Das wusste sie von ihren längst verstorbenen Großeltern. Als Paule ihren Vater um eine Wohngelegenheit gebeten hatte, beherbergte das Haus gerade mal fünf Menschen.
»Mein Vater hatte für niemanden Platz«, sagte sie. »Auch mir wollte er ein paar Jahre zuvor die Dachgeschosswohnung nicht geben, als sie frei wurde. Er hatte Angst, ich würde ihm die Miete nicht zahlen können, weil ich noch in der Ausbildung war. Verzichtet hätte er auf das Geld nie, selbst wenn er reich gewesen wäre.«
Kaum sichtbar öffnete Paule seinen Mund und nuschelte: »Ich wäre ihm die Miete auch nicht schuldig geblieben. Aber dein altes Kinderzimmer wollte er nicht hergeben.«
Salvina erinnerte sich, wie sich damals ihr Vater über Paules Anmaßung beschwert hatte. Ja, sie war sich sicher, ihr Vater hatte von Anmaßung gesprochen. Er wollte das Zimmer so lassen, wie es war, nichts darin verändern, was die Erinnerung an die vergangenen Jahre hätte abschwächen können. Aber die Wohnung im Dachgeschoss, in der sie zu dieser Zeit gewohnt hatte, war eine neutrale Wohnung, eine Wohnung, an die keine Erinnerungen geknüpft waren. Für sie wäre es leichter gewesen, Paule ihre Dachgeschosswohnung zu überlassen und zurück in ihr Kinderzimmer zu ziehen. Nein, sie traf keine Schuld. Wenn es für ihren Vater schon anmaßend war, dann erst recht für sie.
»Wie lange ist das jetzt her?«, fragte sie. »Fünf, sechs Jahre? Januar war es, daran kann ich mich noch erinnern.«
Paule nickte.
»Nach diesem kalten Januar bekam mein Vater Schuldgefühle. Plötzlich hielt er mir vor, dass auch ich dir ein Zimmer oder die ganze Wohnung hätte geben können. Wenn es darum ging, seine Verantwortung abzuwälzen, kam mein Vater auf die abstrusesten Ideen.«
Wieder nickte Paule.
»Soll ich jetzt daran schuld sein?, habe ich ihm geantwortet. Paule war dein Freund, nicht meiner.«
»Ich hätte dir nichts getan«, erwiderte Paule kurz.
Salvina sprang auf, hetzte ziellos ein paar Schritte in der kleinen Küche umher und schleuderte ihm ein energisches »Nein!« entgegen. Dann schnaubte sie aufgebracht: »So einfach ist das nicht. Wir kannten uns kaum. Das konntest du nicht von mir erwarten. Es hätte auch andere Lösungen gegeben.«
Als sie sich wieder umdrehte, sah sie Paule wortlos in kleinen, langsamen Schritten seinen mühevollen Weg humpeln und geknickt ihren Laden verlassen.
Die oftmals ruhigen Vormittage nutzte Salvina, um die vielen kleinen Gegenstände des Ladens sauber zu halten. Mit Pinsel und Tuch entfernte sie die feinen Staubteilchen, die sich täglich bildeten. Antiquitäten müssen sauber, staub- und fettfrei sein, hatte ihr Vater sie als Kind ermahnt, wenn sie etwas berühren wollte. Daran musste sie jedes Mal denken, wenn sie den alten Pinsel in die Hand nahm. Als ihr Vater noch den Laden betrieb, hatten der Pinsel und das Staubtuch ihren festen Platz im Schrank unter der Registrierkasse. Mit der arbeitete Salvina noch immer, sie wusste aber nie, wohin sie Pinsel und Staubtuch am Vortag geräumt hatte. Meist fand sie beides schließlich dort, wo sie es zuletzt benutzt hatte.
Nachdem sie eine Gruppe alter Porzellanfiguren abgestaubt hatte, begann es zu regnen. Sie legte Pinsel und Staubtuch neben den Porzellanfiguren ab und ging ans Fenster. Langsam fielen die feinen Tropfen auf die Straße. Allmählich wurde der Straßenbelag dunkler, dann begann er zu glänzen, schließlich überzog ihn ein dünner Wasserfilm, in dem die nun dicker und schwerer gewordenen Tropfen aufspritzten. Zwei Passanten eilten an Salvinas Laden vorbei und durchquerten ihr Blickfeld. Ihre Jacken zogen sie eng an sich. Danach regte sich auf der Straße nichts mehr. Salvina sah weiterhin auf den nassen Asphalt. Sie konnte stundenlang stehen und nichts tun. Im Nichtstun blieb ihre Zeit stehen, die Welt jedoch bewegte sich weiter. Je weniger sie dabei dachte, desto weniger spürte sie ihre Einsamkeit.
Diese Fähigkeit hatte ihr in ihrer Kindheit geholfen, die Einsamkeit zu ertragen. Selbst im Kindergarten starrte sie scheinbar teilnahmslos vor sich hin. Wenn die Erzieherinnen sie fragten, weshalb sie nicht mit den anderen Kindern spielte, sagte sie nur, sie würde lieber beobachten. Irgendwann war sie für die anderen nicht mehr vorhanden. Selbst die Erzieherinnen schienen sie eines Tages nicht mehr zu bemerken. Wenn es regnete, stand Salvina vom Stuhlkreis auf und ging in den Hof, dem Regen zuzuschaun. Niemand hinderte sie daran. Doofer Stuhlkreis, hatte sie sich stets gedacht, und ihre Meinung darüber hat sie bis heute nicht grundlegend geändert. Sie fühlte sich schon als Kind nicht wohl, wenn Menschen im Kollektiv – wie gleichgeschaltet – alle dasselbe machen. Im Stuhlkreis war kein Platz für ihre Individualität. Mit viereinhalb hatte sie sich schließlich erfolgreich geweigert, auch nur einen Tag länger in den albernen Kindergarten zu gehen.
In den noch verbliebenen zwei Jahren vor ihrer Einschulung hatte sie niemanden. Ihr Vater hatte keine Zeit, er kümmerte sich um den Laden. Ihre Großeltern hatten damals noch gelebt, aber weit außerhalb der Stadt. Nur selten war sie bei ihnen zu Besuch gewesen. Und im Block gab es außer ihr keine Kinder. In diesen Jahren stand Salvina oft den ganzen Tag in Gummistiefeln, Regenhose und Regenjacke mit Kapuze im Innenhof im Regen. Sie liebte ihre bunte Regenbekleidung aus Gummi. Und sie liebte den Regen. Mit ihrem Blick erfasste sie den gesamten Innenhof und schaute dem Regen zu, wie er alles mit seinem Glanz überzog.
Sie schaute den Blättern der Bäume und Büsche zu, wie sie sich unter dem Gewicht des Regens immer weiter krümmten, wie sich an den Blattspitzen Tropfen bildeten, wie diese Tropfen stetig wuchsen und die Blätter schließlich wieder nach oben wippten und ihre natürliche Form annahmen, sobald die Tropfen schwer genug waren, um sich von den Blattspitzen zu lösen. Sie schaute dem Regen zu, wie er sich allmählich um Zweige und Äste schmiegte und diese mit seinem zarten und feuchten, silbrig glänzenden Film umschloss. Sie schaute den Tropfen des Regens zu, wie sie auf die großen Steine am Rand des Weges aufschlugen, dabei platt gedrückt wurden und in viele feine Tröpfchen zerstäubten. Und sie schaute und hörte dem Regen zu, wie er in unzähligen, scheinbar ungeordneten Tropfen zu Boden fiel, und doch in seiner harmonischen Vielfalt – gleich einer Symphonie – ein musikalisch anmutendes Rauschen erklingen ließ.
Und sie beobachtete die Pfützen, wie die Regentropfen darin eindrangen, um gleich danach wieder emporzusteigen und schließlich doch darin verschwanden. Die von den Tropfen erzeugten Wellen, wie sie sich kreisförmig ausdehnten, sich mit anderen Wellen überlagerten und so ein regelmäßiges Muster auf den Oberflächen der Pfützen zeichneten. Und sie beobachtete die Pfützen dabei, wie sie größer und größer wurden. Und manchmal wünschte sie sich, das Wasser sollte so hoch steigen, dass alle Menschen schwimmen müssten. Dann, hoffte sie, würden sie die Welt mit anderen Augen betrachten und aus ihrem Trott aufwachen. Sie hoffte, die Angst, in den Fluten zu ertrinken, würde die Menschen einander wieder näher bringen, sie versöhnen, mit sich, ihren Mitmenschen, dem Leben, der Liebe.
Wenn wenigstens Leute in den Laden kämen. Sie müssten ja nicht unbedingt etwas kaufen, nur damit ich nicht die ganze Zeit allein bin, dachte sie. Von einer netten Unterhaltung traute sie sich erst gar nicht zu träumen. Um ihre aufkeimende Einsamkeit zu unterdrücken, gähnte sie. Aus Erfahrung wusste sie, dass bei Regen ihre wenige Kundschaft ausblieb und ihr somit ein trister Tag in ihren tristen Räumen mit ihren tristen Antiquitäten bevorstand.
Tu es nicht, Salvina! Bitte, tu es nicht! An diese Worte musste sie denken, als sie anfing, sich am Hals zu kratzen. Nur selten kam es noch vor, dass sie die Kontrolle über sich verlor. Als Kind hatte sie sich oftmals blutig gekratzt. Dann achtete ihr Vater darauf, dass sie ihre Fingernägel täglich bis zum Ansatz zurückfeilte. Und er mahnte sie, auch wirklich die Feile und nur die Feile zu benutzen, damit ihre Nägel schön rund wurden und keine scharfen Kanten und Ecken entstanden. Ihre Wunden konnte er eindämmen, das Kratzen behielt Salvina bei. Erst als sie erwachsen wurde, hörte sie damit auf. Auch jetzt milderte sie ihr Kratzen in ein sanftes Streicheln mit den Fingerkuppen.
Was sollte sie nicht tun? Welche Botschaft steckte in ihrem Traum? Salvina glaubte an die Fähigkeit der Träume, Botschaften zu übermitteln. Sie glaubte daran, dass ihr Vater diese Bitte ausgesprochen hätte, wenn er noch gelebt hätte. Dann hätte sie ihn fragen können. Doch jetzt musste sie selbst herausfinden, was sie nicht tun sollte. Aber ihr fiel nichts ein. Nichts, das sie vorhatte, zu tun. Das Einzige, was sie sich schon vor Wochen vorgenommen hatte, war, das Lager im Keller durchzusehen. Sie wollte bis Jahresende den Bestand ihrer Waren erfassen. Nach dem Tod ihres Vaters hatte sie seine Bücher weitergeführt, ohne sie zu überprüfen und ohne eine Inventur zu tätigen. Das Lager war für sie der Bereich, in dem sie ihren Vater noch am stärksten spüren konnte. Sie wollte ihm dieses Reich so lange wie möglich überlassen, um sein endgültiges und vollständiges Verschwinden hinauszuzögern.
Salvina schüttelte den Kopf. Der Gedanke war absurd. Es konnte keinen Grund geben, weshalb ihr Vater es nicht gewollt hätte, dass sie den Lagerbestand erfasste. Sie wollte es nicht wahrhaben, dass ihr Vater Geheimnisse vor ihr gehabt haben könnte. Denn wer Geheimnisse hat, der ist zu schwach für die Wahrheit. Und wenn ihr Vater zu schwach für die Wahrheit war, dann hatte er sie belogen.
Aber auch das war absurd. Ihr Vater war ein ehrlicher Mann gewesen. Bieder und rechtschaffen. Ein Händler zwar, aber kein Halsabschneider. Und schon gar kein Betrüger. Niemals hätte er seine Tochter belogen. Darüber gab es für Salvina keinen Zweifel. Zumindest nicht bis jetzt.
Und wenn ihre Gedanken nicht absurd waren? Wenn die Bitte ihres Vaters im Traum wirklich bedeutete, dass sie den Lagerbestand nicht erfassen sollte? – Irgendwann musste sie es tun, und ihre Neugierde hatte sie jetzt geweckt. Sofort eilte sie zwischen ihren Waren hindurch zum Schreibtisch ihres Vaters, nahm den Schlüsselbund aus einer der vielen Schubladen und verließ den Laden über den Hinterausgang in Richtung Treppenhaus.
Stufe für Stufe tastete sie sich die enge Kellertreppe hinab und schob mit den Füßen den Putz beiseite, der von den Wänden in großen Platten abbröckelte. Jeden ihrer Schritte setzte sie sehr vorsichtig, denn die Stufen aus Beton waren abgegriffen und glatt und an vielen Stellen brüchig. Um nicht an die Kellerdecke zu stoßen, die vor allem im Treppenbereich sehr niedrig war, musste sie sich etwas bücken. In dem trüben Licht erkannte sie kaum die Spinnweben, die in dicken Knäueln schwarz und schwer von der Decke herabhingen. Immer wieder wich sie mit ihrem Kopf aus, damit sie ihr nicht ins Gesicht gerieten.
Am Ende der Treppe kam sie an kleinen Verschlägen vorbei, die mit erster bis dritter Stock nummeriert waren. Die kleinen metallenen Schilder mit den eingravierten Nummern hatte einst ihr Vater angebracht. Er brauchte auch im Keller seine Ordnung. Im ersten Verschlag standen in Regalen Konserven, Porzellangeschirr, Kartons und Kisten; auch leere Blumentöpfe waren zu sehen. Der Verschlag des zweiten Stocks war brechend voll mit Gerümpel. Hier schien alles wahllos hineingestellt worden zu sein, was nur selten oder nie mehr benötigt wurde. Typisch Klara, dachte Salvina. Auf dem Boden, gleich neben dem Gatter, stand ein blauer Werkzeugkoffer aus Metall. Der gehörte Klaras Mann. Den hatte er damals mitgebracht, als Salvina ihn um handwerkliche Unterstützung gebeten hatte. Sie hatte sich eine neue Mischbatterie für die Spüle der Küche im Laden gekauft und war dann schon am Ausbau der alten Batterie gescheitert. Aber das war nun auch schon über ein Jahr her. Der Verschlag für den dritten Stock war sauber und akkurat aufgeräumt. Der gehörte der älteren Dame im Dachgeschoss, von der Salvina nur den Namen und deren Bankverbindung kannte.
Gegenüber den Verschlägen befand sich in der gemauerten Wand eine geschlossene Tür aus massivem Eisen. Salvina blieb davor stehen, nahm den längsten Schlüssel vom Bund und sperrte sie auf. Dann stemmte sie sich mit ihrem gesamten Körpergewicht dagegen. Nur langsam konnte sie die Tür öffnen.
Kühle, etwas muffige Luft schwappte ihr entgegen. Sie schaltete das Licht an. Die verstaubte Kellerleuchte in der Mitte der Decke spendete aber nur ein diffuses Licht. Um den Lagerraum auszuleuchten, reichte ihr Licht nicht aus. Der Raum war so groß wie eine Zweizimmerwohnung und angefüllt mit Mobiliar und Einrichtungsgegenständen. Salvina bückte sich, nahm den Stecker eines Verlängerungskabels, das neben der Tür lag, und steckte ihn in die Steckdose unterhalb des Lichtschalters. Daraufhin erstrahlten einige Stehlampen in hellem Licht.
Unsicher schaute Salvina sich um. Dann schritt sie das Lager ab. Sie zwängte sich durch die engen Wege zwischen dem Mobiliar. Bei den meisten Stücken hatte sie den Eindruck, sie von früher zu kennen. In den drei Jahren hatte sie wenig aus dem Lager verkauft, und auch ihr Vater hatte nur selten Stücke aus dem Lager über den Lastenaufzug im Innenhof zur Rückseite des Ladens gebracht. Der Lastenaufzug bot die einzige Möglichkeit, größere Möbel vom Lager in den Laden zu bekommen. Auch ihrem Vater war dieser Weg ohne Hilfe zu beschwerlich gewesen.
In der am weitesten von der Tür entfernten Ecke blieb Salvina vor einer Reihe Holzstühle stehen, die auf zwei Truhen gestapelt waren. Sie nahm einen der Stühle herunter, setzte sich auf das Lederpolster und betrachtete argwöhnisch das Arrangement, das drei Standuhren und einen Kleiderschrank verdeckte. Zwischen den Stuhlbeinen hindurch schaute sie auf die fast bis an die Decke reichenden Standuhren, die wie eine Mauer an der Seite des Kleiderschranks dicht aneinander standen. Dabei fiel ihr auf, dass zwischen der Rückseite des Kleiderschranks und der Wand noch Platz sein musste. Zuerst dachte sie sich nichts dabei, doch plötzlich sprang sie auf, hob alle Stühle von den Truhen und verteilte sie im Lager. Danach versuchte sie, die Truhe vor den Uhren wegzuschieben.
Aber die war zu schwer. Salvina öffnete den Deckel und stieß einen tiefen Seufzer aus. Die Truhe war voll mit unterschiedlich großen Päckchen aus Zeitungspapier. Sie nahm eines dieser Päckchen heraus und entfaltete die vielen einzelnen Blätter. Naserümpfend betrachtete sie den bunt verzierten Porzellanteller, der zum Vorschein kam, und dachte augenblicklich an eine Kaffeerunde alter Damen in einem Wiener Kaffeehaus. Auf der Unterseite fand sie ein Zeichen, das zwei gebogenen Schwertern glich, die sich kreuzten. Sie kannte das Zeichen nicht. Achtlos wickelte sie den Teller aus Meißner Porzellan wieder ein und legte ihn zurück in die Truhe.
Auch in der zweiten Truhe lagen Päckchen aus Zeitungspapier. Diese waren größer und noch schwerer. Die meisten glichen in ihrer Form Vasen oder Figuren. Salvina kratzte sich kurz an der Stirn, dann schritt sie erneut das Lager ab. Sie suchte nach einem freien Platz für die beiden Truhen.
Schon bald hatte sie zwei freie Flächen entdeckt, die ihr groß genug erschienen. Päckchen für Päckchen trug sie dorthin und verstreute sie rund um die Flächen, auf denen sie die Truhen abstellen wollte. Nachdem sie die Truhen leer geräumt hatte, glaubte sie, mehrere Kilometer gelaufen zu sein, so schwer waren ihre Beine. Dennoch zog sie mit hochrotem Kopf ruckartig die leeren Truhen zur Seite, nur so weit, dass sie an den Kleiderschrank und an die Standuhren herankam.
Der Kleiderschrank war leer, aber zwischen der Wand und den Uhren eingeklemmt, sodass sie ihn nicht greifen konnte. Und die Standuhren waren für sie allein zu schwer. Sie hatte keine Kraft mehr. Eine Weile stand sie noch unschlüssig und schaute sich um, ob irgendetwas herumlag, das sie als Hebel hätte benutzen können. Dann beschloss sie, am späten Nachmittag Klara – ihre Mieterin aus dem zweiten Stock – um Hilfe zu bitten.
Es war schon Mittag geworden, als sie durch den Hintereingang wieder den Laden betrat. Etwas schien ihr verändert. Sie spürte eine Spannung, die sie zuvor nicht empfunden hatte. Dies beunruhigte sie. Obwohl sie wusste, dass es nicht sein konnte, glaubte sie, die Anwesenheit eines Menschen zu spüren. Hätte in ihrer Abwesenheit ein Kunde den Laden betreten, so wäre im Lager eine laute Klingel ertönt; es konnte also niemand hier sein. Trotzdem fühlte sie sich beobachtet. Vorsichtig und leise setzte sie ihre Schritte und ging in die Mitte des Verkaufsraumes. Dort drehte sie sich einmal um sich selbst. Aufmerksam blickte sie in jeden Winkel, auf jeden Gegenstand. Sie achtete auf das leiseste Geräusch, auf ungewohnte Gerüche. Aber außer der Spannung nahm sie nichts Fremdes wahr. Alles war wie immer. Alles stand an seinem Platz und wartete darauf, endlich das dunkle Loch verlassen zu dürfen. Auch Salvina stand wieder an ihrem Platz und wartete.
Ihr wurde kalt. Zuerst spürte sie die Kälte an den Füßen. Ihre Fußsohlen fühlten sich an, als würde sie an einem nebligen Novembertag barfuß über glitschige Flusskiesel wandern. Die Kälte der Kiesel stieg langsam über ihre Beine in den Unterleib. Bald hatte sie ihren ganzen Körper ergriffen. Salvinas Haut zog sich zusammen und stellte ihr die feinsten Härchen auf. Schließlich ging sie zurück. Jeden Schritt setzte sie behutsam auf das Parkett und mied die knarrenden Stellen. Sie ging vorbei am Schreibtisch ihres Vaters. Dort spähte sie in die kleine Küche. Als sie sich absolut sicher war, dass sich dort niemand versteckt hielt, eilte sie zum Küchenschrank und holte das längste Messer aus der obersten Schublade. Sie wusste, dass sie niemals zustechen könnte. Sie wusste, dass der Anblick des Messers die Aggression eines Angreifers verstärken würde. Dennoch stand sie am Herd, das Messer fest im Griff und sah zur Tür.
Salvina wartete und horchte, doch nichts geschah. Erinnerungen wurden in ihr wach. Erinnerungen an einen Vorfall, an den sie jetzt nicht denken wollte, denn er machte ihr nur noch mehr Angst. Aber die Bilder stiegen unweigerlich wieder in ihr hoch. Sie durchlebte diese endlos langen Minuten jener Nacht, in der sie Klara und deren Mann aus dem Schlaf gerissen hatte. Das Frösteln, als sie zu dritt am offenen Küchenfenster in Klaras Wohnung standen und auf das Eintreffen der Polizei warteten. Nein, so etwas passiert nur einmal, es musste sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass bei ihr nichts zu holen war. Salvina verdrängte die Bilder, verdrängte die Erinnerung. Sie begann zu pfeifen. Wie ein Kind, das sich in der Dunkelheit fürchtet, verscheuchte sie die Stille und mit ihr die Einsamkeit, um die Angst nicht mehr zu spüren.
Aber die Angst und die Einsamkeit blieben. Salvinas Gedanken kreisten um die letzten Tage. Sie hoffte, sich an etwas erinnern zu können, das sie ablenkte. Doch sie fand weiter nichts als pure Ereignislosigkeit und Ödnis. Noch vor wenigen Jahren hatte sie sich danach gesehnt, endlich wieder einen eigenen Gedanken fassen zu können. Sie hatte sich danach gesehnt, wieder am Fenster zu stehen und nichts tun zu müssen. Nur den Regen beobachten, schauen, wie seine schweren Tropfen auf dem Asphalt zerplatzen.
Als ihr Vater noch gelebt hatte und den Antiquitätenladen führte, ließ ihr der Alltag in der Klinik keine Zeit zum Nachdenken; er ließ ihr keine Zeit, der Welt bei ihrem Treiben zuzuschauen, sie mit ihren Augen zu sehen. Nun hatte sie diese Zeit wieder im Überfluss, wie früher, als sie noch ein Kind war. Aber sie hatte sich in den Jahren, in denen sie als Krankenschwester gearbeitet hatte, verändert. Sie hatte verlernt, die Welt mit kindlichen Augen zu sehen, und sie hatte verlernt, die Einsamkeit zu ertragen. Sie ist erwachsen geworden und hatte doch nie so werden wollen, wie die meisten Erwachsenen auf sie wirkten, die ihr während ihrer Kindheit begegnet waren.
Salvina legte das Messer zurück in die Schublade und trat ans Fenster. Durch das feine Netz der vergilbten Gardine schaute sie auf die Fahrbahn der Straße, obgleich ihr Blick in die Ferne gerichtet war, so, als könnte sie durch den Asphalt hindurchblicken und sehen, was sich jenseits des Straßenbelags im Innern der Erde verbarg. Für sie selbst war es, als öffnete sich ein Schleier, wenn sie durch die Dinge hindurchsah. Ein Schleier, der ihr im Alltagsleben den Blick in ihr Inneres versperrte. So blickte sie scheinbar durch die Straße, doch in Wirklichkeit schaute sie dabei tief in sich selbst hinein.
Dort sah sie den Trauerzug, den Paule angedeutet hatte, und sie selbst führte ihn an. Sie versuchte, die Gefolgschaft zu sehen, aber ihr fehlte der Mut, sich umzudrehen. Sie hatte Angst davor, das bestätigt zu sehen, was sie zu wissen glaubte. Mit gesenktem Haupt schritt sie als Erste hinter dem schlichten Sarg und wusste, dass die Gefolgschaft aus unendlich vielen kleinen und großen, kindlichen und erwachsenen Salvinas bestand. Und sie wusste, dass sie sich selbst zu Grabe trug. Unentwegt, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Mit jedem Augenblick, der verrann, trug sie ein Stück ihrer selbst zu Grabe. Mit jedem Augenblick, den sie nicht für sich nutzte, verschwendete sie ein wertvolles Stück ihres Lebens.
Sie wusste nicht weiter. Sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Bevor sie einen Schritt setzte, wollte sie immer wissen, was sie nach diesem Schritt erwartete. Deshalb hätte sie gerne einen Plan für ihr Leben gehabt, einen Plan, an dessen Anfang sie schon erkennen konnte, was am Ende herauskommen würde. Alle Lebewesen folgen dem Plan der Natur. Sie folgen dem Plan des Wechsels zwischen den Jahreszeiten, zwischen Tag und Nacht, zwischen tätig sein und ruhen, zwischen Nahrung aufnehmen und fasten. Sie folgen den in ihm enthaltenen Vorgaben, den Regeln, den Hilfestellungen, und wissen dabei wahrscheinlich nicht, dass ihr Handeln einem Plan folgt. Nur der Mensch weiß von diesem Plan und verwirft ihn, um nicht weiter von den Vorgaben der Natur abhängig zu sein. Der Mensch möchte frei und unabhängig sein, möchte selbst entscheiden, selbst gestalten. Auch Salvina hätte gern selbst gestaltet, aber sie konnte es nicht. Sie wusste nicht, wie sie es schaffen sollte, wusste nicht, was sie machen, was sie tun musste, um mit ihrem Alltag, ihrem Leben zufrieden zu sein. Sie wusste nicht, wie sie glücklich werden könnte.
Über ihren Gedanken verblasste das Bild des Trauerzugs mehr und mehr. Dann löste es sich auf. Salvina schloss die Augen und wünschte sich an einen warmen, sonnigen Ort, an dem sie frei von Verpflichtungen wäre. An einen Ort, an dem sich ihr Wert nicht am Maß ihrer Leistung orientierte. An einen Ort, an dem sie nicht warten müsste, bis Menschen zu ihr kämen, die ihr alte Gegenstände abkaufen wollten. Doch was sollte sie an einem solchen Ort? Wäre sie dort glücklicher gewesen? Salvina wusste, dass ihr Glück nicht ausschließlich von äußeren Umständen abhing. Vor allem wusste sie von ihrer Fähigkeit, auch an einem paradiesischen Ort und unter besten Bedingungen unglücklich sein zu können.
Sie kannte diese Art Gedanken. Zuerst glaubte sie immer, an einen neuen Punkt gestoßen zu sein, der sie weiterbringen, ihr neue Sichtweisen eröffnen könnte. Doch dann gelangte sie jedes Mal an ihre Unzufriedenheit, an ihr Unglücklichsein, womit sich der Kreis ihrer Gedankenkette schloss. Wenn sie noch weiter ihren Gedanken nachhing, dann drehte sie sich erneut in diesem Kreis, würde vielleicht von dem einen oder anderen Gedanken überrascht, doch am Ende lief sie immer wieder in die Falle ihres Unglücklichseins. Je öfter sie in diese Falle trat, desto mehr Zeit brauchte sie, um sich aus ihr befreien zu können. Deshalb wollte sie den Kreislauf ihrer Gedanken durchbrechen. Sie öffnete ihre Augen und blickte wieder durch den Asphalt der Straße hindurch in die Ferne.
Plötzlich schreckte sie auf. Sie fühlte sich wieder beobachtet. Aus dem Augenwinkel glaubte sie, kurz eine Gestalt auf dem Gehsteig gesehen zu haben. Sie schob die Gardine zur Seite, stützte sich mit durchgestreckten Armen auf dem Fensterbrett ab, beugte sich vor und drückte ihre Nase gegen die kalte Scheibe dicht neben dem Fensterrahmen. Da sie niemanden sah, beugte sie sich noch weiter vor, bis ihre breite, dunkle Augenbraue den Fensterrahmen berührte und ihre Nase auf der Scheibe platt gedrückt wurde. Sie konnte nun mit dem freien Auge den Gehweg bis fast zur Einmündung in die nächste Querstraße überblicken. Aber sie sah niemanden. Straße und Gehsteig waren leer. Trotzdem gab es für sie keinen Zweifel, dass jemand unweit ihres Fensters gestanden und sie beobachtet hatte.
Sie hatte eine Frau gesehen, eine ältere, untersetzte Frau. Auf dem Gehweg, nur wenige Meter von ihr entfernt und nur durch das Glas des Fensters getrennt, dessen war sich Salvina sicher. Sie konnte sogar ihren kräftigen Hals sehen, so nah war sie gewesen. Ihr dunkelgraues Haar fiel ihr schwer und glatt auf die Schultern. Salvina kannte ihr rundes Gesicht, sie kannte ihren strengen und drohenden Blick. Aber sie kannte auch den feinen, kaum sichtbaren weichen Zug um ihre Augen, der hinter der Fassade der Strenge eine tief verborgene Güte vermuten ließ. Trotzdem fürchtete sich Salvina vor diesem Blick, wie damals, als sie der Frau zum ersten Mal begegnet war.
Langsam trat sie zurück. Sie spürte wieder die fleischige und harte Hand der Frau, die ihr damals zärtlich übers Haar gestrichen hatte. Um die Berührung aus ihrer Erinnerung zu tilgen, legte sie ihre eigenen Hände auf den Kopf und presste mit aller Kraft, aber das Gefühl, die Empfindung der fleischigen Hand, vermochte sie dadurch nicht zu vergessen. Schließlich rannte sie aus der kleinen Küche in den Verkaufsraum zur Eingangstür. Dort drehte sie das Schild an der Tür um, so, dass der Aufdruck »geschlossen« von außen lesbar war, und verriegelte die Tür. Danach ging sie durch den Laden zum Hinterausgang, schaltete das Licht ab und sperrte auch noch die hintere Tür vom Treppenhaus aus zu. Sie lief die Treppe in den ersten Stock. Dort schloss sie ihre Wohnungstür hinter sich zweimal ab. Im Schlafzimmer schleuderte sie ihre weißen Sandalen von den Füßen. Dann warf sie sich aufs Bett, ohne sich auszuziehen, verkroch sich unter der Bettdecke und schloss die Augen.
Sie wollte schlafen. Sie hoffte, das Bild der Frau und die Erinnerung an ihre Hand im Schlaf vergessen zu können. Aber der drohende Blick und die Last der schweren Hand gingen Salvina nicht mehr aus dem Kopf. Wieder und wieder sah sie die starren und verbitterten Augen vor sich. Noch immer spürte sie die grobe Zärtlichkeit, mit der diese Frau ihr damals über den Kopf gestrichen und sie dabei mit ihrer rauen Hand an den Haaren gezogen hatte. Salvina konnte nicht schlafen, nicht zu dieser Tageszeit. Nicht, solange sie an diese rauen Hände, an diese Frau denken musste.
Sie versuchte, an etwas anderes zu denken. Aber woran sollte sie denken? An schöne Erlebnisse? Spontan fiel ihr keines ein. Deshalb begab sie sich auf die Suche nach einem schönen Erlebnis in ihrem Gedächtnis. Sie dachte an gestern, an vorgestern. Sie dachte an die vergangene Woche, an die vergangenen Monate. In ihren Gedanken lief sie Jahr für Jahr zurück, ihrer Pubertät entgegen. Es gab Zeiten schöner Erlebnisse, Momente des Glücks, die sie in den vergangenen drei Jahren vergessen hatte. Plötzlich tauchten sie wieder vor ihrem geistigen Auge auf. Plötzlich fiel es ihr wieder ein, dass auch sie lachen konnte. Aber bei keinem dieser Ereignisse verweilte sie, immer weiter ging sie in ihrer Erinnerung zurück, ohne zu wissen, wohin sie wollte. Doch plötzlich beendete sie ihre Fahrt in die Vergangenheit.
Sie war gerade fünfzehn und verliebt. Er hatte schwarzes, längeres Haar, ein Moped, eine sportliche Figur, war groß und vom ersten Tag an der Schwarm aller Mädchen in der Schule. In den Sommerferien war er mit seinen Eltern in Salvinas Stadtteil gezogen. Sein nettes und weiches Gesicht gefiel ihr vom ersten Augenblick an. In den Pausen stand sie von nun an unbeteiligt bei ihren Freundinnen und wartete nur noch darauf, ihn zu sehen.
»Salvina! Hallo! Lebst du noch? Oder hat er dir schon den Verstand geraubt?« Als Iris dies sagte, begannen all ihre Freundinnen zu lachen. Doch wenn Valerian in ihre Richtung sah, dann lächelten sie ihm alle zu.
Iris war Salvinas beste Freundin, mit ihr ging sie täglich zur Schule und mittags wieder nach Hause. Sie trafen und trennten sich unweit von Salvinas Haus.
»Hast du gesehen, wie er mich heute angeschaut hat? Ich glaube, ich gefalle ihm«, sagte Salvina an diesem Tag auf ihrem gemeinsamen Nachhauseweg.
»Ich glaube, dem gefallen alle Mädchen. Und zurzeit gefällt ihm Sandra am besten«, erwiderte Iris mitfühlend.
»Du lügst!«
»Nein, Salvina, die ganze Schule weiß es schon. Nur du hast es noch nicht bemerkt. Vergiss ihn!«
Salvina sprach den restlichen Weg kein Wort mehr. Auch Iris verstummte. Erst als sich ihre Wege trennten, durchbrach Iris das Schweigen:
»Wenn es dir recht ist, komme ich so gegen drei zu dir.« Da Salvina nicht antwortete, sprach sie weiter: »Ich musste es dir sagen. Ich finde, es ist besser, du vergisst ihn jetzt, bevor du dich wirklich in ihn verliebst. Ich weiß, wie schwer es für dich ist. Er ist ein sehr netter Junge, aber er war noch mit keiner länger als eine Woche zusammen. Stell dir vor, er würde dir nach einer Woche den Laufpass geben und mit einer anderen gehen. Denkst du, du würdest damit klarkommen, so empfindlich, wie du bist?«
Zu Hause legte sich Salvina aufs Bett und heulte. Als Iris sie am Nachmittag besuchte, hatte sie den ersten großen Schmerz überwunden. Die darauf folgenden Tage erlitt sie noch viele schwere Attacken von Liebeskummer, doch als sie Valerian und Sandra nach wenigen Tagen das erste Mal Arm in Arm gesehen hatte, mischte sich unter ihren Liebeskummer Wut auf Sandra. Zwei Wochen später übertrug sie diese Wut auf Agnes. Als er nach kurzer Zeit auch Agnes wegen einer anderen verlassen hatte, und sie bemerkte, dass er in all den vergangenen Wochen keinen Blick auf sie geworfen hatte, konnte sie sich allmählich von seiner Anziehung befreien. Sie hätte es nie überwunden, nach wenigen Wochen wegen einer anderen verlassen zu werden. Sie brauchte Beständigkeit und echte Liebe. Schon damals.
»Weißt du, was ich bei Liebeskummer mache?«, fragte Iris am Nachmittag in Salvinas Zimmer. »Ich höre mir ganz laut Orgelmusik an. Die ist so schön schwermütig. Darauf kann ich wunderbar heulen. Mein Vater hat viele Aufnahmen von Orgelkonzerten. Die leihe ich mir dann heimlich aus. – Du hast keine Orgelmusik? Schade. Dein Vater auch nicht?«
»Mein Vater hört keine Klassik. Der ist doch den ganzen Tag nur mit seinen blöden Antiquitäten beschäftigt. Da lässt er sich vom Schlagerradio einlullen. Das passt zu ihm und dem alten Trödel.«
»Meine Mama sagt, dein Vater wäre früher anders gewesen, fröhlicher und netter.«
»Du meinst, als meine Mama noch gelebt hat. – Danke, Iris. Du bist wirklich eine gute Freundin. Glaubst du, es macht mir nichts aus, dass meine Mama tot ist?«
»Es tut mir leid, Salvina. Ich weiß, dass du dir Vorwürfe machst. Aber du kannst doch nichts dafür.«
»Wenn ich nicht wäre, dann würde meine Mama noch leben.«
»Woher willst du das wissen? Vielleicht wäre sie an einer Krankheit, etwa an Krebs gestorben.«
»Sie ist wegen mir gestorben. Nicht an Krebs und auch nicht an einer anderen Krankheit, sondern weil sie mich bekommen hat. Begreifst du das denn nicht?«
»Aber dich trifft keine Schuld.«
»Das weiß ich auch selbst. Aber es nützt mir nichts. Sie ist trotzdem nach meiner Geburt gestorben. Daran kann niemand mehr etwas ändern. Meine Mama ist gestorben, weil sie mir das Leben geschenkt hat.«
Iris hatte keine Geschwister. Sie liebte Salvina wie ihre eigene Schwester. Sie nahm Salvina in die Arme und drückte sie fest an sich. Sie wusste, dass sie ihr den Schmerz nicht nehmen konnte. Aber ihr beistehen, sie begleiten, ihr Wärme und Geborgenheit geben, das konnte sie. Das hatte sie Salvinas Vater voraus.
Arm in Arm weinten beide Mädchen, und keine wusste mehr, dass Salvina wegen Valerian weinte. Auch Valerian hatte es nie erfahren. Er hatte auch Salvinas Interesse an ihm nie bemerkt.
Plötzlich ließ Iris ihre beste Freundin los, horchte auf und fragte erstaunt: »Hörst du das?«
Salvina wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und erwiderte: »Was soll ich hören?«
»Die Musik.«
»Ich höre keine Musik. Ich höre nur die alte Uhr meines Vaters im Wohnzimmer.«
»Das ist Musik. Ich liebe die Stundenschläge von Standuhren. Die sind genauso schwermütig wie Orgelkonzerte. Darf ich die Uhr sehen und eine Stunde vorstellen?«
»Bist du verrückt? Mein Vater bringt mich um, wenn ich dich an seine Uhr lasse.«
»Und im Lager? Hat er da auch welche?«
»Ich glaube schon. – Nein Iris, das kann ich nicht machen.«
»Ach komm schon Salvina. Wenn er mehrere hat, dann gibt das ein tolles Konzert, das verspreche ich dir.«
Salvina schüttelte verzweifelt den Kopf. Dann holte sie vom Schlüsselbrett den Ersatzschlüssel für das Lager, und gemeinsam schlichen sie durchs Treppenhaus in den Keller. Dort stemmten sie sich zu zweit gegen die dicke Eisentür. Nur allmählich gab diese nach und ließ sich öffnen. Hinter sich machte Salvina die Tür wieder zu, damit der tiefe, dumpfe Ton der Stundenschläge sich nicht über den Kellergang ins Treppenhaus ausbreiten konnte. Sie glaubte fest, dass ihr Vater sie und ihre Freundin beim Gang in den Keller nicht bemerkt hatte, und sie glaubte auch, dass er durch die geschlossenen Türen hindurch den Klang der Uhren nicht hören konnte. Trotzdem sah sie immer wieder ängstlich zur Tür.
All die vielen Jahre, die seitdem vergangen waren, hatte Salvina nicht mehr an diesen Tag gedacht. Doch jetzt – da sie auf ihrem Bett lag und versuchte, sich schöner Erlebnisse zu besinnen – konnte sie wieder jedes Detail dieses Tages vor sich sehen. Sie konnte sich dabei beobachten, wie sie in dem düsteren Licht gemeinsam mit Iris in die entlegenste Ecke zu den drei hohen Standuhren ging und eine nach der anderen in Gang setzte. Bei allen Uhren stellten sie die Zeiger auf eine Minute vor zwölf, zogen sie auf und warteten gespannt auf das Konzert gegen Liebeskummer. Zeitgleich gaben alle Uhren ihre Komposition zum Besten. Das Lager erschallte in einem ohrenbetäubenden Wunder aus tiefen, durchdringenden Klängen. Salvina hatte den Eindruck, als würde das ganze Inventar mitschwingen und selbst diese warmen Töne entstehen lassen. Auch ihr eigener Körper wurde erfüllt von der Musik und schwang in dem berauschenden Rhythmus des Klangzaubers mit, der sie gleichzeitig auf eine gewisse Art beruhigte. Sogar als der letzte Ton geschlagen wurde, schwang die Melodie eine Zeit lang noch weiter im Raum, wurde leiser und leiser, bis sie allmählich doch verstummte.
Salvina war so begeistert, dass sie die Uhren gleich nochmals stellen wollte, doch dann sah sie am Boden des Gehäuses einer der Standuhren einen Schlüssel liegen. Es war ein einfacher, dunkel angelaufener Schlüssel mit einem ringförmigen Griff. Sie bückte sich, nahm ihn und drehte ihn achselzuckend zwischen den Fingern. Dann öffnete sich die Tür, und ihr Vater stürmte herein.
»Bist du denn von allen guten Geistern verlassen?«, brüllte er. »Der Lärm dröhnt durchs ganze Haus! Was machst du überhaupt hier unten! Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du hier unten nichts verloren hast!«
Mit offenem Mund standen die beiden Mädchen wie angewurzelt und sahen Salvinas Vater mit großen Augen an. Er eilte zu ihnen und schloss von allen drei Standuhren die Glastüren. Dann bemerkte er, dass Salvina etwas in ihrer Hand hielt.
»Was hast du da?«, schrie er sie an. Als sie ihm den Schlüssel zeigte, schrie er noch lauter: »Verdammt noch mal! Fass diesen Schlüssel ja nicht mehr an! Geh sofort in dein Zimmer und lass dich hier nie mehr blicken!«
Er riss ihr den Schlüssel aus der Hand, und Salvina und Iris verschwanden geknickt in Salvinas Zimmer.
Anhaltende schrille Töne verdrängten die Stille im Raum, als hätte ein plötzlicher Stimmbruch die Stimmlage der Stundenschläge ins Unerträgliche erhöht. Salvina schreckte auf. Zuerst fand sie sich nicht zurecht, sie vermisste Iris und die langen, schwingenden Perpendikel der drei Standuhren. Nach dem ersten Schock sank sie zurück auf das weiche Bett und kam fast wieder zur Ruhe. Doch dann ließ ein weiteres schrilles Läuten sie noch einmal zusammenfahren. Plötzlich wusste sie wieder, wo sie war. Mit zittrigen Knien sprang sie aus dem Bett, hastete durch den Gang und öffnete die Wohnungstür. Klara stand draußen und hob gerade die Hand, um ein weiteres Mal den Klingelknopf zu drücken.
»Hallo Salvina, ich fand deinen Laden verschlossen, deshalb wollte ich nachsehen, ob du krank bist und etwas brauchst.«
»Danke, das ist lieb von dir, aber ich bin in Ordnung«, antwortete Salvina mit belegter Stimme und senkte den Blick zum Boden.
Eine abwartende Stille trat zwischen die beiden. Klara musterte sie. Schließlich fügte Salvina ihren Worten noch hinzu: »Doch, doch, es geht mir gut.«
»Hast du geschlafen?«, fragte Klara.
»Ich weiß es nicht. Zumindest habe ich von meiner Jugend geträumt. Ob ich dabei geschlafen habe, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall war ich weit weg.«
Klara packte Salvina am Arm und drückte sie zurück in die Wohnung. Sie schob sie durch den Gang und quer durch das Wohnzimmer auf das Sofa. Als beide saßen, sagte sie:
»So, ich bleibe hier, bis du mir erzählt hast, warum du am Montagnachmittag deinen Laden zusperrst und statt dich um deinen Lebensunterhalt zu kümmern, im Bett liegst.«
Salvina sah sie mit großen Augen an. Selbst wenn sie es gewollt hätte, sie hätte sich in diesem Moment nicht aus Klaras Umklammerung befreien können. Klara war die Autorität in Person. Ihr strenger Blick, ihre aufrechte Sitzhaltung, und Salvina sank immer tiefer in das Sofa, wurde kleiner und kleiner, bis sie sich wie ein Kind fühlte, das vor der Mutter Rechenschaft ablegen musste. Also erzählte sie ihr von ihrer Vision, die sie am Morgen hatte. Und sie erzählte ihr von der Bitte ihres Vaters, sie solle etwas nicht tun.
»Das war keine Vision«, fuhr Klara dazwischen, »das war ein harmloser Traum. Du darfst die Bedeutung deiner Träume nicht überbewerten, das habe ich dir schon oft gesagt. Es kommt mir immer mehr so vor, als wolltest du die Langeweile deines Leben damit kompensieren, dass du alles dramatisierst. Außerdem ist dies kein Grund für deine Abwesenheit im Laden.«
Dann erzählte Salvina von ihrer Jugenderinnerung und der Reaktion ihres Vaters wegen des alten Schlüssels.
»Mein Vater war ansonsten ein sehr ruhiger und geduldiger Mensch«, fuhr sie fort. »Sein Aufbrausen kann nur bedeuten, dass der Schlüssel von besonderer Bedeutung für ihn war. Und es kann auch kein Zufall sein, dass ich ausgerechnet heute diese Erlebnisse und Erinnerungen habe. Ich wollte damit beginnen, den Lagerbestand meines Vaters zu erfassen.«
»Und deshalb vergräbst du dich in deinem Bett? – Komm, wir gehen jetzt nach unten und sperren deinen Laden wieder auf. Du kannst es dir nicht leisten, deine Kundschaft im Regen stehen zu lassen und dein Leben mit sinnlosen Grübeleien zu vergeuden, nur weil du von deinem toten Vater geträumt hast.«
»Ich kann mich jetzt nicht um den Laden kümmern.«
»Solange du dir diese Frage stellst, wirst du deine finanzielle Situation nicht verbessern. Du musst dich um das Geschäft kümmern, oder du arbeitest wieder in deinem alten Beruf. Hast du schon vergessen, wie oft du früher mit deinen Nerven am Ende warst? Im Vergleich dazu geht es dir heute gut.«
»Du verstehst mich nicht: Damals, als ich mit Iris im Lager war, waren sowohl die Standuhren als auch der Kleiderschrank frei zugänglich. Mein Vater hatte also erst später die Truhen und Stühle davor gestapelt. Außerdem steht der Schrank nicht an der Wand. Deshalb bin ich mir sicher, dass hinter dem Schrank noch etwas ist. Wie es aussieht, wollte mein Vater etwas vor mir verbergen.«
»Das ist über zehn Jahre her! Ich glaube nicht, dass sich dein Vater so wenig um die Dinge im Lager gekümmert hat, wie du. Es ist also normal, dass sich das Gesicht eines Lagers über die Jahre verändert. Manches wird verkauft, anderes kommt hinzu.«
»Das Lager hat sich auch verändert, aber nicht diese Ecke.«
»Du glaubst also, dein Vater hätte vor dir ein großes Geheimnis gehütet, und dieses ominöse Geheimnis lagert in deinem stickigen Keller hinter einem alten Kleiderschrank.«
»Ja, das glaube ich.«
»Wahrscheinlich hast du recht. Ich denke auch, dass dein Vater Anrüchiges im Lager vor dir versteckt hat: Staubmäuse. Vielleicht auch Kellerasseln. Oder Silberfische.«
»Klara!«
»Nein Salvina, dafür habe ich kein Verständnis. Du verrennst dich in eine Wahnidee.«
Salvina stöhnte und sah ihre Freundin von unten herauf an. Sie war enttäuscht. Dann sagte sie: »Da ist noch etwas.«
»Was meinst du damit?«
»Heute sah ich eine ältere Frau vor meinem Küchenfenster, die mich einmal auf der Straße vor dem Laden angesprochen hatte, als ich noch ein Kind war.« Salvina stockte.
»Eine ältere Frau. Und weiter?«, drängte Klara.
»Na ja, wie soll ich sagen? – Damals hat sie mir von einem Mädchen erzählt, dem ich angeblich sehr ähnlich gesehen habe.« Wieder stockte Salvina.
Klara rückte noch näher an sie heran. Ungeduldig sagte sie: »Salvina! Was ist daran? Es gibt eine Menge Mädchen, denen du als Kind ähnlich gesehen hast.«
»Aber diese Frau hat mir nicht einfach nur von dem Mädchen erzählt. Sie behandelte mich, als wäre ich dieses Mädchen. Immer wieder strich sie mir über den Kopf und sagte: Meine kleine ... An den Namen kann ich mich leider nicht mehr erinnern.«
Klara studierte lange Salvinas Gesichtsausdruck, bevor sie sagte: »Ich sehe weder einen Zusammenhang mit dem Lager deines Vaters noch erkenne ich in der Geschichte mit der Frau etwas Besonderes. Du hast sie eben an dieses Mädchen erinnert. Na und?«
Zögernd sagte Salvina: »Es war ihre Enkeltochter.«
»Dann war es eben ihre Enkeltochter. Auch das hat nichts mit deinem Vater und dir zu tun.«
»Doch Klara, eben schon. Als mein Vater mitbekommen hatte, dass die Frau mit mir sprach, stürmte er sofort aus dem Laden und ging auf sie los. Dabei schrie er, sie solle mich in Ruhe lassen und nie wieder bei uns vorbeikommen. Ich habe meinen Vater niemals zuvor so aggressiv erlebt, wie in diesem Moment. Er war so wütend. Ich glaube, er wäre ihr am liebsten an die Gurgel gegangen. Und dann ...« Wieder stockte Salvina.
Klara nahm die Hände vors Gesicht und schüttelte den Kopf. Keine der beiden sprach jetzt ein Wort. Salvina hatte die alte Standuhr ihres Vaters als Erinnerung an ihn nach seinem Tod im Wohnzimmer stehen lassen. Im gleichmäßigen Rhythmus erfüllte das Klackern des mechanischen Werks das kleine Wohnzimmer. Nach einer Weile stand Salvina auf und ging in die Küche. Als sie zurückkam, brachte sie zwei Gläser und eine Flasche Orangensaft mit und stellte alles auf den Tisch.
»Vielleicht wollte dein Vater nicht, dass dich fremde Menschen berühren«, begann Klara mit gerunzelter Stirn. »Vielleicht war ihm die Frau auch nur unsympathisch.«
»Nein, das glaube ich nicht. Als mein Vater sie so angeschrien hatte, lächelte sie nur und sagte zu mir: Es sind deine Sachen. Dann griff sie in ihre Tasche, holte einen Schlüssel heraus und streckte ihn mir entgegen. Sofort riss ihn mein Vater ihr aus der Hand und schrie sie noch einmal an. Sie solle verschwinden, schrie er. Bevor sie ging, sagte sie noch: Vergessen Sie das ja nicht! Das sind ihre Sachen. Eines Tages müssen Sie ihr das alles geben! Mein Vater hat den Schlüssel gleich in seine Hosentasche gesteckt.«
»Na und?«
»Ich weiß nicht mehr, was mir mein Vater damals über diese Frau erzählte, und wie er seine Reaktion begründete. Er schaffte es jedenfalls, dass ich bis heute nicht mehr an sie gedacht habe. Auch als ich viele Jahre später mit Iris den Schlüssel in der Standuhr im Lager gefunden habe, erinnerte ich mich nicht mehr an diese Frau. Aber jetzt weiß ich, der Schlüssel aus der Standuhr, das war der Schlüssel, den sie mir geben wollte.«
»Salvina, ich bitte dich. Wie kannst du dir so sicher sein? Diese Schlüssel sehen doch alle gleich aus.«
»Es war derselbe Schlüssel, glaube mir. Das war so ein alter Schlüssel mit einem Ring als Griff und vorne einem Bart. Mein Vater hat mir damals den Schlüssel nicht mehr zurückgegeben. Und die Sachen, von der die Frau gesprochen hatte, habe ich nie gesehen. Er muss sie vor mir versteckt haben.«
»Wach auf aus deinen Phantasien, Salvina! Dein Vater war damals gereizt, weil er nicht wollte, dass du dich in seinem Lager aufhältst, das ist verständlich. Und heute hast du von ihm geträumt. Aber er hat nichts vor dir versteckt, nicht dein Vater.«
»Doch. Ich spüre es.«
Klara sagte nichts mehr. Sie zuckte nur kurz mit den Achseln, dann blickte sie zur klackernden Standuhr. Sie wollte es nicht glauben, wollte es nicht wahrhaben, trotzdem wusste sie, dass sie sich auf Salvinas Gespür verlassen konnte. Schon oft hatte Salvina sie mit ihren Eingebungen und Vorahnungen überrascht.
Am Todestag ihres Vaters litt Salvina unter starken depressiven Stimmungen. Damals kannten sich Klara und Salvina noch nicht. Salvina wohnte zu der Zeit in der kleinen Dachgeschosswohnung über Klaras jetziger Wohnung. Als Salvina an diesem Morgen aufstand und zur Arbeit ging, wollte sie vorher unbedingt noch ihren Vater sehen. Gegen fünf Uhr blieb sie vor seiner Wohnungstür stehen, klingelte aber nicht. Sie wusste, dass er noch mindestens zwei Stunden schlafen würde. Aber sie wollte unbedingt seine Stimme hören, ihn umarmen, denn sie spürte, dass etwas nicht stimmte, anders war als sonst. Trotzdem weckte sie ihn nicht auf. Sie wollte ihn nicht beunruhigen. Ohne ihn noch einmal lebend zu sehen, wandte sie sich damals ab und verließ das Haus.
Den ganzen Tag über quälte sie die Sorge um ihren Vater. Später rief sie bei ihm an, im Geschäft, in der Wohnung. Sie konnte nicht wissen, dass ihr Vater bereits tot in seiner Wohnung lag. Da er nicht mehr ans Telefon ging, machte sie sich noch mehr Sorgen. Als sie später Klara davon erzählte, konnte sie nicht mehr sagen, wann ihre Sorge in eine depressive Stimmung überschlug. Aber sie konnte sich an den Nebel erinnern, der sich in ihrem Bewusstsein ausbreitete und sie jeglicher Denk- und Entscheidungsfähigkeit beraubte. In diesem Zustand der geistigen Leere fuhr sie damals nach ihrer Arbeit nach Hause und fand ihren Vater. Weißt du Klara, sagte sie später, jedes Mal, wenn ein geliebter Mensch stirbt, raubt dir sein Tod ein Stück deines Lebens. Zurück bleibt ein mit Nebel gefüllter Raum. Diesen Nebel spürte ich schon, bevor ich es wissen konnte.
An diese Worte erinnerte sich Klara.
Ein andermal läutete Salvina gegen Mitternacht an ihrer Wohnungstür. Klara war schon im Bett und hatte fest geschlafen. Hektisch stammelte Salvina unverständliche Worte. Sie war völlig aufgelöst, so, als ginge es um Leben und Tod. Bitte Klara, du musst mir helfen. Das war der erste verständliche Satz, an den sich Klara erinnern konnte. Wobei helfen, und hat das nicht bis morgen Zeit? Sie kann nicht allein in den Laden gehen, um nachzusehen. Klara und ihr Mann müssten sie begleiten. Was sie nachsehen wolle? Im Laden sei jemand. Ob sie sich sicher sei? Ja, ganz sicher, sie spüre es. Ob sie es nur spüre, oder ob sie etwas gehört habe. Sie spüre es.
Klara wollte nicht die Heldin spielen, sie wollte auch nicht, dass ihr Mann für Salvina den Helden spielt, deshalb griff sie zum Telefon. Wenn du dir sicher bist, dann rufe ich jetzt die Polizei. In diesem Moment hatte Klara den Eindruck, Salvina erwache aus einem Traum. Sie wollte es nicht.
Klara sah die ganze Szene wieder deutlich vor sich. Sie sah ihren Mann schlaftrunken in der Schlafzimmertür stehen und nach Salvinas Problem fragen. Ja, so war es gewesen: Ihr Mann wurde um Mitternacht von Salvina wegen eines Traumes – oder was immer es war – aus dem Schlaf gerissen, trotzdem hatte er sofort Verständnis für sie und ihre Probleme. Er war es auch, der augenblicklich seinen Mantel anzog und ohne Licht zu machen lautlos die Treppe hinunterging. Klara folgte ihm. Salvina schlich zögerlich hinter ihnen her.
Vorsichtig versuchte ihr Mann, die hintere Ladentür vom Treppenhaus aus zu öffnen. Die Tür war verschlossen. Er beruhigte Salvina, sagte ihr, dass vom Innenhof aus niemand in den Laden gedrungen sein könne. Er bat sie um den Schlüssel. Dann schloss er wie ein Profi völlig geräuschlos die Tür auf. Vorsichtig betrat er den Laden, horchte und spähte. Im Laden war niemand. Sie machten kein Licht, ihre Augen hatten sich im finsteren Treppenhaus an die Dunkelheit gewöhnt. Der Verkaufsraum wurde von der Straßenlaterne etwas beleuchtet. Dieses fahle Licht reichte für alle drei aus, um sicher zu sein, dass alles in Ordnung war.
Damals hatte Klara schon im Voraus geahnt, dass niemand im Laden sein würde, und sie fühlte sich in ihrer nüchternen Lebenseinstellung bestätigt. Ihr Mann und Salvina hingegen waren beide erleichtert, keinen Einbrecher vorgefunden zu haben. Trotzdem verließen sie den Laden leise und umsichtig wieder durch den Hinterausgang.
Klaras Mann wollte gerade die Tür schließen, als er plötzlich innehielt. In Klaras Erinnerung spiegelte sich in Salvinas Gesicht Entsetzen, als auch sie selbst den Grund dafür wahrnahm, weshalb ihr Mann die Tür nicht schloss. Salvina und Klaras Mann hatten das metallene Geräusch schon Sekunden vor ihr gehört. Nun hörte auch sie, was die anderen bereits wussten. Das metallene Geräusch kam direkt von der Eingangstür. Es hörte sich so an, als machte sich jemand am Schloss zu schaffen.
Als Klaras Mann eine dunkle Gestalt den Laden betreten sah, schloss er leise die Tür. Sie ließen den Einbrecher gewähren und eilten so leise wie möglich nach oben. Als Salvina ihre Wohnung aufschließen wollte, warf Klara ein, dass der Einbrecher ihre Schritte in ihrer Wohnung hören könnte, da diese direkt über dem Laden lag. Deshalb riefen sie von Klaras Wohnung aus die Polizei und warteten am Fenster auf das Eintreffen des Streifenwagens. Wenige Minuten später wurde der Einbrecher gestellt.
Auch an diese Eingebung musste Klara denken. Deshalb widersprach sie Salvina nicht weiter. Trotzdem glaubte sie nicht, dass Salvinas Vater etwas vor ihr versteckt hatte. Sie wollte es nicht glauben. Als Salvina sie ansah, wiegte sie leicht den Kopf hin und her. Daraufhin sagte Salvina:
»Komm bitte mit mir ins Lager und hilf mir, die Ecke frei zu räumen. Ich habe keine Ruhe, solange ich nicht weiß, was hinter dem Kleiderschrank ist. Und alleine schaffe ich es nicht.«
Gemeinsam verließen sie Salvinas Wohnung. Klara folgte ihr durch das düstere Treppenhaus in den dunklen Kellergang, von dessen Wänden ihr Kühle und Feuchtigkeit entgegenstrahlten. Im Lager eilte Salvina sofort zu den beiden Truhen, die sie am Vormittag leer geräumt hatte, und blieb davor stehen.
»Die Truhen müssen weg«, ergriff Klara gleich das Wort, rieb sich die Hände und krempelte die Ärmel ihrer Jacke hoch. »Hinter der Tür ist noch Platz, da tragen wir sie hin.«
»So weit weg willst du die Truhen bringen? Das schaffen wir nie! Weißt du, wie schwer die sind?«
»Wir werden beide Truhen dort hinter der Tür verstauen, oder wir lassen es. Auf keinen Fall will ich später über sie stolpern. Und einen anderen Platz sehe ich nicht.«
»Komm mit«, sagte Salvina und zeigte Klara die beiden Stellen, die sie für die Truhen ausgesucht hatte.
»Du und dein Augenmaß«, erwiderte Klara kopfschüttelnd, als sie vor den Päckchen aus Zeitungspapier standen. »Der Platz reicht gerade mal für einen Klappstuhl, aber nicht für diese mächtigen Truhen. Wir tragen sie hinter die Tür, und damit basta. Die Päckchen kannst du später allein einräumen.«
Somit schleppten sie die Truhen quer durch das Lager. Klara immer voran. Danach eilte Klara als Erste zurück zu den Standuhren, kippte und drehte die vorderste Uhr, um sie stückchenweise von der Seitenwand des Kleiderschranks wegrücken zu können. Als Salvina endlich mit anpackte, versuchten sie gemeinsam, die Uhr hochzuheben und zu tragen, aber sie war zu schwer.
»Das schaffen wir nie!«, klagte Salvina.
»Jetzt hör bloß auf zu jammern, das hier war deine Idee«, maulte Klara und rückte die Uhr unbeirrt Zentimeter um Zentimeter aus der Ecke heraus in den Raum hinein.
Als sie die erste Uhr so weit fortgeschafft hatten, dass sie ihnen nicht mehr im Weg stand, hatten sie dadurch lediglich einen Teil der Seitenwand des Kleiderschranks freibekommen. So konnten sie noch immer nicht den Raum hinter dem Schrank einsehen.
»Interessant ist es schon«, begann Klara.
»Was meinst du?«
»Ja das«, antwortete sie und deutete auf die Seitenwand des Kleiderschranks. »Zwischen dem Schrank und der Mauer ist anscheinend wirklich noch genügend Platz für ein Versteck.«
Daraufhin kippten und drehten sie auch die zweite Standuhr. Wieder mussten sie ihre Finger zwischen die Seitenwände der Uhren quetschen, um sie kippen zu können. Da die Uhren so dicht aneinander standen, hätte Salvina es alleine nie geschafft. Sogar mit Klaras Hilfe stieß sie an die Grenzen ihrer Kraft, und sie brauchten lange, bis sie auch die zweite Uhr in ausreichendem Abstand verstaut hatten.
Zwischen dem Schrank und der dritten Standuhr war nun ein etwa handbreiter Spalt entstanden. Prüfend sah Salvina durch den Spalt hindurch, konnte jedoch noch nichts erkennen. Ohne auf Klara zu warten, griff sie in den Spalt und zog die dritte Standuhr etwas hervor. Klara kam ihr zu Hilfe und fasste an die andere Seite der Uhr, doch Salvina spähte gleich wieder durch den vergrößerten Spalt und rief augenblicklich:
»Ich habe es doch gesagt!«
Klara stellte sich hinter sie auf Zehenspitzen und lugte ebenfalls durch den Spalt. Auch sie erkannte nun, dass zwischen dem Kleiderschrank und der Mauer eine weitere Truhe stand.
Schließlich packten sie die dritte Uhr und schoben sie ruckweise zu den beiden anderen. Auch den Kleiderschrank rückten sie von der Stelle. Nun konnten sie die Truhe aus nächster Nähe betrachten. In diesem Moment atmete Klara erleichtert auf, Salvina jedoch bekam weiche Knie.
»Seltsam ist das ja schon«, sagte Klara. »Es sieht wirklich so aus, als hätte dein Vater die Truhe versteckt.«
»Klara, ich habe Angst, die Truhe zu öffnen. Vielleicht wäre es besser für mich, ich bewahre meinen Vater so im Gedächtnis, wie ich ihn gekannt habe. Stell dir vor, in dieser Truhe wären schreckliche Dinge versteckt, die ich ihm nie verzeihen könnte. Wie sollte ich damit umgehen? – Warum bin ich nur immer so neugierig? – Manchmal ist es vielleicht doch besser, wenn Geheimnisse geheim bleiben. Mein Vater wird schon seine Gründe gehabt haben.«
»Salvina, du bist verrückt. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich all das schwere Zeug hier mit dir von einem Ort zum anderen schleppe, damit wir am Ende die Truhe so stehen lassen, wie sie ist! Freu dich, wir sind am Ziel!«
Ohne Salvina weiter zu beachten, versuchte sie den flachen Deckel zu öffnen. Die Truhe war aus einfachen und unverzierten, jedoch massiven Brettern genagelt. Ursprünglich musste sie von schlichter Schönheit gewesen sein, doch über die vielen Jahre hinweg war das Fichtenholz dunkel und rau geworden. Klara rüttelte am Deckel, aber er ließ sich nicht öffnen. Dann sah sie an der Frontseite der Truhe ein im Holz versenktes Schloss.
»Wir brauchen den Schlüssel«, sagte Salvina eintönig.
»Du bist ein kluges Mädchen. Stell dir vor, das habe ich eben auch bemerkt.«
»Ich spreche nicht von irgendeinem Schlüssel. Ich meine den Schlüssel mit dem ringförmigen Griff. Den Schlüssel, den mir diese Frau vor zwanzig Jahren geben wollte, und den ich dann später mit Iris in einer der Uhren gefunden habe.«
»Vielleicht hast du ja recht«, erwiderte Klara. Dann ging sie zu den drei Standuhren und öffnete die Erste. Im Pendelkasten gab es nur wenige Möglichkeiten, einen Schlüssel zu verstecken. Da sie hier nichts fand, suchte sie die Uhr von oben bis unten nach weiteren Plätzen für ein geeignetes Versteck ab. Aber sie konnte ihn nicht finden. Auch in der zweiten Uhr fand sie ihn nicht. Und in der Dritten entdeckte sie statt des Schlüssels nur über die Jahre angesammelten Staub.
Mit gerunzelter Stirn stieß Klara einen tiefen Seufzer aus. Die beiden Frauen sahen einander entmutigt an, dann sagte Klara:
»Sei mir nicht böse, Salvina, aber ich gehe jetzt nach oben. Mein Mann wird sicherlich schon zu Hause sein und mich vermissen. Überlege dir, wo der Schlüssel sein könnte, und wenn du ihn nicht findest, dann öffnen wir die Truhe morgen mit Gewalt. Aber für heute habe ich genug.«
Als Salvina sich bei Klara für ihre Hilfe bedanken wollte, hatte diese das Lager schon verlassen. Klara lebt schnell, dachte Salvina. Sogar bei wichtigen und weitreichenden Entscheidungen verharrt sie nie in langen Überlegungen. Sie macht sich im Nachhinein auch keine Gedanken darüber, ob ihre Entscheidungen richtig oder falsch waren. Wer will das auch beurteilen können? Niemand weiß, wie sich sein Leben unter dem Einfluss einer anderen Entscheidung entwickelt hätte. Trotzdem zerbrach sich Salvina oft den Kopf darüber, ob ihre Entscheidungen die Richtigen waren.
Sie setzte sich auf die Truhe und dachte darüber nach, weshalb ihr Vater die Truhe vor ihr versteckt hatte, und das mit solch hohem Aufwand. Doch solange sie nicht wusste, was in der Truhe war, konnte sie sein Verhalten nicht verstehen. Auch, ob er richtig gehandelt hatte, könnte sie erst beurteilen, nachdem sie die Truhe öffnete. Am meisten bewegte sie aber die Frage, ob es von ihr richtig und ihrem Vater gegenüber korrekt wäre, die Truhe zu öffnen. Immer wieder kreisten ihre Gedanken dabei um den Inhalt der Truhe. Dass in der Truhe etwas war, das er all die Jahre vor ihr geheim gehalten hatte, davon war sie inzwischen überzeugt.
Da ihre Neugier ihr niemals Ruhe gelassen hätte, beschloss sie, das Geheimnis ihres Vaters zu lüften. Aber wo konnte der Schlüssel sein? Vielleicht hatte ihr Vater den Schlüssel fortgeworfen, oder sie selbst hatte ihn in den vergangenen drei Jahren, die sie nun das Antiquitätengeschäft führte, weggeworfen, weil sie nicht wusste, zu welchem Schloss er gehörte. Sie hatte schon so vieles aus dem Nachlass ihres Vaters zum Müll gegeben.
Frustriert verließ sie das Lager und ging in ihre Wohnung.
In ihrer Küche war es noch hell. Es regnete nicht mehr, und die Sonne schenkte ihr durch die Lücken der Restwolken hindurch ihre letzten Strahlen. Salvina blieb nur so lange am Fenster, bis die Sonne hinter den Dächern der Häuser gegenüber verschwunden war. Danach machte sie sich eine große Schüssel Salat, trottete damit ins Wohnzimmer und legte sich aufs Sofa.
Auf dem Bauch liegend richtete sie ihren Oberkörper auf und stützte sich dabei mit den Ellbogen ab. In dieser Haltung nahm sie ihren Salat zu sich. Dazu aß sie noch die schon angetrocknete Semmel vom Vortag, die sie zum Frühstück beim Bäcker um die Ecke geholt und dann doch nicht gegessen hatte.
Sie blieb zu Hause. Wie jeden Abend. Sie hatte keine Freunde außer Klara, und alleine ging sie nicht gerne weg. Nur ins Kino. Ein-, zweimal im Jahr. Nicht öfter. Im Kino wird man unterhalten, da kann man konsumieren, ohne selbst aktiv sein zu müssen. Und im Kino ist es dunkel, da starrt einen niemand an, da treffen einen keine fragenden Blicke, auch keine mitleidigen. Da klebt nicht sofort der Makel des Alleinseins auf dir.
Salvina schaltete den Fernseher ein. Ihr war nach Konsum, nicht nach Aktivität. Aber sie wusste nicht, was lief. Sie wusste nie, was lief, denn sie kaufte sich nie eine Programmzeitschrift.
Im Ersten sang ein blonder, sehr junger Mann von Liebe. Mit beiden Händen hielt er das Mikrofon fest umklammert und weinte fast vor Schmerz. Vor der Kulisse einer blühenden Almwiese, im Hintergrund das schneeweiße Matterhorn, sang er von der wichtigsten Frau in seinem Leben, im Leben eines jeden Mannes. Die Zuschauer im Saal weinten mit, sie bewunderten seine Walliser Tracht, sie bewunderten seine wehmütige Stimme, sie bewunderten sein ehrerbietiges Lied. Er sang von seiner Mutter.
Im Zweiten lief eine Serie. Es konnte nur eine Serie sein, das sah Salvina auf den ersten Blick. Sie hätte nicht erklären können, woran sie es sah, aber bereits nach den ersten Sekunden wusste sie, es war eine Serie mit monatlicher Ausstrahlung, je Sendung eine Stunde Spielzeit mit drei bis vier in sich abgeschlossenen Episoden aus dem Alltag einer Frau von nebenan.
In den Dritten kamen Dokumentationen, Berichte, Diskussionsrunden. Die Privaten zeigten Werbung, amerikanische Serien mit grundlos lachendem Publikum oder Quizsendungen. Salvina wechselte von einem Fernsehkanal zum nächsten. Als sie alle Programme kurz durchgesehen hatte, zappte sie wieder zurück. Auf einem der Privatsender kam jetzt statt der Werbung die Fortsetzung eines bereits begonnen Spielfilms. Salvina legte die Fernbedienung auf den Tisch, kaute weiter ihren Salat und schaute in die Glotze.
Aber sie konnte der Handlung des Films nicht folgen. Zum einen fehlte ihr der Anfang, zum andern musste sie immer wieder an die Truhe und ihren Vater denken. Außerdem gefiel ihr nicht, was sie da sah. Die Hauptrolle gehörte offenbar einem kleinen, Baseball spielenden Jungen. Wenn er mal nicht auf dem Platz war, um einen seiner obligaten Home-Runs zu laufen, saß er zu Hause auf dem Sofa und spielte gelangweilt mit seinem übergroßen Baseballhandschuh. Nun kamen seine streitenden Eltern zu ihm ins Wohnzimmer, er sah sie wegen ihres Streits vorwurfsvoll an und sprach ein paar höchst pädagogische Sätze zu ihnen. Die Eltern schämten sich ihrer mangelnden Vernunft und Disziplin, setzten sich zu ihm und waren wieder glücklich. Von nun an saßen sie zu dritt auf dem Sofa; Vater und Sohn neckten einander und taten so, als würden sie sich um den Baseballhandschuh streiten.
Salvina schaltete den Fernseher aus und beendete ihren Tag früher als gewohnt.
Im Bad prüfte sie die wenigen feinen Unreinheiten ihrer Haut im Gesicht, die sie nur sehen konnte, wenn sie ganz nah an den hell beleuchteten Spiegel herantrat. Sie zupfte und drückte ein bisschen, bis sich die Haut rötete. Dann konzentrierte sie sich auf ihre Augen. An den Unterlidern bildeten sich die ersten kleinen Fältchen. Auf ihre glatte und reine Haut war sie immer sehr stolz gewesen.
Salvina glättete ihre Unterlider zuerst mit den Daumen, dann begann sie, Grimassen zu schneiden. Sie formte dabei ihren Mund zu einem O und zog gleichzeitig ihr Gesicht in die Länge. Anschließend machte sie einen breiten Mund. Diese Übung fördert die Durchblutung der Gesichtshaut und macht sie gleichzeitig geschmeidig, hatte sie einmal gelesen. Anschließend streifte sie ihren Hals mit den Händen glatt.
Dann zog sie sich aus. Sie drehte sich vorm Spiegel, legte die Hände unter die Brüste und hob sie etwas an. Um den Rest ihres Körpers besser sehen zu können, stieg sie auf den Deckel des Toilettensitzes hinter ihr. Nun strich sie sich mit den flachen Händen über die Schultern. Von dort aus glitten ihre Hände seitlich entlang ihrer Brüste, über die Taille, dann über ihre weiblichen Hüften bis hinab zu den Oberschenkeln, so, als wollte sie ein eng sitzendes Etuikleid glatt streifen. Abschätzig musterte sie sich vorm Spiegel, drehte sich nach links, dann nach rechts, und je länger sie sich im Spiegel betrachtete, desto unzufriedener wurde sie. Sie dachte an die vielen superschlanken Frauen, deren scheinbar perfekte Körper ihr von den Medien vorgeführt wurden. Bislang war sie stolz auf ihre schlanke Figur gewesen, doch genügte es, schlank zu sein? Perfekt wollte sie ihren Körper wissen, so perfekt, wie sie die Körper der Frauen glaubte, die sie noch nie in natura gesehen hatte.
Von ihren leichten Wölbungen entmutigt, stellte sie sich unter die Dusche. Nach ihrer Abendtoilette ging sie zu Bett.
Aber schlafen konnte sie nicht. Sie war noch nicht müde. Und sobald sie sich hinlegte und die Augen schloss, begannen ihre Gedanken zu kreisen. Sie wusste, Klara würde unter keinen Umständen mehr darauf verzichten, die Truhe zu öffnen. Notfalls würde sie die Truhe mit der Axt oder mit einem Hammer zertrümmern oder sie zersägen. Um dies zu verhindern, musste Salvina am nächsten Tag den Schlüssel finden.
Sie wälzte sich Stunde um Stunde im Bett, schaltete das Licht an, ging ins Bad, um sich das Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen, ging in die Küche, um ein Glas kalte Milch zu trinken. Es half alles nichts. Solange sie darüber grübelte, wo der Schlüssel sein könnte, konnte sie nicht schlafen. Erst sehr spät vergaß sie für einen längeren Moment den Schlüssel und schlief ein.
Der ursprünglich weiße Lack der Bretter von der Tür zum Keller war matt und übersät mit dunklen Schlieren. Die Türklinke – nur eine einfache, glatte Eisenstange, die beim Hinunterdrücken einen starren Riegel hochhob – fühlte sich kalt an. Das wuchtige Kastenschloss war auf die Bretter der Tür aufgeschraubt. Der Schlüssel dazu bestand aus einem bleistiftdicken Rohr mit einem breiten Bart und am anderen Ende einem ovalen Ring, der so groß war, dass Salvina Zeige- und Mittelfinger hindurchstecken konnte. Sie öffnete die Tür und schaltete das Licht an. Im ersten Moment schreckte sie zurück, denn das Licht flackerte. Aber sie musste in den Keller gehen, sie suchte etwas. Kurz überlegte sie, was sie suchte, sie hatte es vergessen. Nein, sie durfte nicht umkehren, jetzt nicht mehr. Sie musste weitergehen, dann würde es ihr schon wieder einfallen.
Vorsichtig ging sie die bekannten Stufen der Kellertreppe hinab. Am Ende der Treppe folgte sie dem kurzen Gang, vorbei an den Abteilen ihrer Mieter. Vor der Tür zum Lager ihres Geschäfts schaute sie sich noch einmal um. Sie war allein. Dann schloss sie die Tür auf, stemmte sich mit dem Gewicht ihres gesamten Körpers dagegen und trat ein. Auch hier flackerte das Licht. Wieder schreckte sie zurück, wieder befahl sie sich, weiterzugehen.
Hier ist jemand, dachte sie plötzlich. Ein Anflug von Panik breitete sich in ihr aus und wühlte sie auf. Doch für einen kurzen Moment beruhigte sie sich wieder. Es konnte niemand hier sein, denn nur sie allein hatte einen Schlüssel für das Lager. Dann hallte ein lauter, dumpfer Knall durch den Raum und ließ sie hochfahren. Sofort schaute sie um sich. Erleichtert stellte sie fest, es war nur die Tür, die hinter ihr ins Schloss gefallen war. Salvina vermied jetzt jede Bewegung, und so fühlte sie die beruhigende Wirkung der Stille, die sich mit dem Abklingen des Knalls nach und nach im Raum ausbreitete. Schon bald hörte sie nur noch das sanfte Rauschen ihres eigenen Atems.
In langsamen Schritten begann sie, das Lager zu durchqueren. Behutsam setzte sie ihre Schritte, sie wollte lautlos das andere Ende erreichen. Schon aus der Ferne sah sie die Truhe in der Ecke stehen, befreit von den Uhren und von dem alten Kleiderschrank. Alles war, wie sie und Klara es zurückgelassen hatten. Nur das Licht flackerte so stark, dass Salvina zeitweise stehen bleiben musste, um nicht in diesem Wechsel aus hell und dunkel gegen die Antiquitäten zu stoßen. Als sie die Truhe erreicht hatte, versuchte sie, den Deckel zu öffnen.
»Ich brauche den Schlüssel«, sagte sie laut vor sich hin und rüttelte am Deckel.
Dann rückte sie die Truhe etwas nach vorne und tastete deren Wände ab. Anschließend suchte sie mit ihrem Blick das Lager ab und senkte resigniert die Augen. Sie würde Wochen brauchen, wenn sie an allen möglichen Stellen nach dem Schlüssel suchen wollte. Wenigstens bei den Standuhren schaute sie noch einmal nach. Aber den Schlüssel mit dem ringförmigen Griff konnte sie nicht finden.
Sie setzte sich auf die Truhe und dachte darüber nach, wo sie den Schlüssel an ihres Vaters Stelle aufbewahrt hätte. Sie hätte ihn versteckt. An einem Ort, den niemand außer ihr kannte oder an dem sie sicher sein konnte, dass niemand außer ihr dort etwas suchte. Wieder erinnerte sie sich des Augenblicks, als ihr Vater ihr den Schlüssel aus der Hand gerissen hatte, nachdem sie mit Iris den Stundenschlägen der Uhren gelauscht hatte. Sie sah ihren Vater vor sich, wie er sie anschrie, mit einer schnellen Bewegung den Schlüssel ergriff und sofort in seine Hosentasche steckte. Von da an hatte sie den Schlüssel nicht mehr gesehen.
In dem flackernden Licht hatte sie den Eindruck, der Boden unter ihren Füßen würde sich bewegen. Sie schaute genauer hin und weitete ihre Augen. Dabei glitt ihr Blick über ihre Hose und sie bemerkte, dass es nicht ihre Hose war, die sie trug. Sofort sprang sie von der Truhe und betrachtete die Hose von oben bis unten. Es war die Hose ihres Vaters. Nur ihr Vater hatte diese altmodischen Hosen getragen, er war in der Zeit von Salvinas Geburt stehen geblieben. Sofort griff sie in beide Taschen. Zuerst glaubte sie die Taschen leer, doch die Taschen waren tief, viel tiefer, als Salvinas Hände lang waren. Sie führte ihre Hände noch weiter hinein, spürte mit den Fingerspitzen schon ihre Oberschenkel, als sie an ihrem rechten Mittelfinger eine metallene Kälte empfand. Sie griff nach diesem Metall und nahm es heraus. Es war der Schlüssel. Hastig steckte sie ihn in das Schloss und drehte ihn um. Dann hörte sie das Schloss aufschnappen.
Zuerst fasste sie ungeduldig den Deckel und hob ihn etwas an. Als sie merkte, dass sie ihn öffnen konnte, hielt sie inne. Dann spürte sie plötzlich eine schwere Hand auf ihrer Schulter. Erschrocken ließ sie den Deckel wieder fallen und drehte sich um. Ihr Vater stand hinter ihr und sah sie flehend an. Er sagte:
»Tu es nicht, Salvina! Bitte, tu es nicht!«
Noch im Aufwachen spürte sie seine Hand auf ihrer Schulter.
Später stand sie wie jeden Morgen mit weißen Socken in weißen Sandalen am offenen Fenster ihrer Küche. Sie beugte sich vor, stützte sich dabei auf ihre Ellbogen und sah an der Außenmauer des Hauses hinab auf das triste Grau des Straßenbelags. Dabei sah sie auf die Uhr und wusste, in genau fünf Minuten würde sie Paule die Tür öffnen. Diese exakte Uhrzeit hatte sich in den vergangenen zwei Jahren in Salvinas Tagesablauf fest eingespielt.
Schon sah sie Paule am Ende der schmalen Straße um die Ecke kommen und in kleinen, langsamen Schritten seinen mühevollen Weg humpeln. Sie beobachtete ihn, bis er vor ihrem Laden stehen blieb. Dann stellte sie sich vor, dass er auf sie wartete. Seit zwei Jahren hatte sie jeden Tag auf diese Weise begonnen, nie hatte sie den Ablauf verändert, seitdem Pater Franziskus sie besucht hatte.
Sie nahm den Schlüsselbund vom Tisch und ging in den Laden. Paule sollte sich freuen, wenn er sie sah, deshalb stellte sie sich vor, dass er sich bei ihrem Anblick aufrichtete und große, klare Augen bekam. Salvina selbst lächelte diesmal nicht. Ohne Regung öffnete sie die Tür, begrüßte ihn einsilbig und ging voran in die Küche. Dort rückte sie für ihn den Stuhl zurecht und machte ihm seine tägliche Tasse Kaffee.
»Was ist los mit dir? Dein Laden war gestern verschlossen«, hätte Paule an diesem Tag zögerlich fragen sollen.
Daraufhin schilderte Salvina ihre seltsamen Erlebnisse. Am Ende fügte sie ihren Worten noch hinzu: »Ich habe ein mulmiges Gefühl. Sogar Klara glaubt mittlerweile, dass mein Vater die Truhe vor mir versteckt hat.«
»Du machst dir zu viele Sorgen über das, was sein könnte. Du musst die Truhe öffnen, nur dann weißt du, ob deine Sorgen und Ängste begründet sind. Wahrscheinlich sind auch in dieser Truhe nur alte Teller und Vasen.«
»Ich kann sie nicht öffnen.«
»Du musst sie öffnen.«
»Du verstehst mich nicht, ich habe keinen Schlüssel.«
Paule suchte sich durch seinen klebrigen Bart einen Weg zum Kinn. Dann kratzte er sich mit seinen langen, schwarzen Fingernägeln und sagte: »Such im Schreibtisch deines Vaters.«
Salvina ekelte sich. Zum ersten Mal in den vergangenen zwei Jahren empfand sie vor dem Bild, das sie von Paules Erscheinung hatte, massive Abscheu. Sie schreckte vor seinen Fingernägeln im Bart zurück, und es graute ihr davor, dass es ihr Stuhl war, auf dem sie ihn sitzen sah, und auf den seine unsichtbar kleinen Hautschuppen fielen. Sie wollte ihr Bild von ihm nicht mehr sehen und schaute weg. Sie wandte sich ab, drehte sich zur Seite.
»Such im Schreibtisch deines Vaters«, hörte sie Paule wiederholt sagen.
»Den Schreibtisch benutze ich schon seit drei Jahren. Wenn der Schlüssel in einer der Schubladen wäre, hätte ich ihn schon längst finden müssen«, antwortete sie und schluckte.
»Vielleicht findest du irgendwo eine kleine Dose, die du bisher übersehen hast.«
Salvina gab ihm keine Antwort. Den Kopf weiterhin zur Seite gedreht, schloss sie die Augen. Nach einer Weile hörte sie die Glocke der Ladentür. Zuerst dachte sie, ein Kunde wäre gekommen, doch als sie die Augen wieder öffnete, sah sie, dass Paule verschwunden war. Als sie die Tür wieder ins Schloss fallen hörte, eilte sie in die Abstelle und holte einen Eimer, einen Putzlappen und Gummihandschuhe. Zuerst zog sie sich die Handschuhe über, dann nahm sie Paules Tasse und schüttete den Kaffee in das Spülbecken. Erst jetzt goss sie Wasser in den Eimer und spritzte kurz bevor sie das Wasser wieder abdrehte noch einen Strahl Reinigungsmittel hinein. Dann begann sie, fein säuberlich den Stuhl zu putzen. Anschließend wischte sie den gesamten Weg, den Paule in ihrer Vorstellung gegangen war.
Als sie fertig war, ging sie zum Schreibtisch ihres Vaters, an dem er all seine Schreibarbeiten erledigt hatte. Der stand in der von der Eingangstür entferntesten Ecke hinter einem mit Ornamenten verzierten dreiteiligen Paravent aus Holz. Den Wandschirm hatte noch ihr Vater aufgestellt, damit Kunden den Schreibtisch nicht sehen und ihn versehentlich als Kaufobjekt betrachten konnten.
Salvina öffnete zunächst die Schublade des linken Schreibtischunterschranks, dann die mittlere und schließlich die des rechten Unterschranks. Ein Anschlag verhinderte jeweils ein völliges Herausziehen der Schubladen. Sie durchwühlte alle drei nacheinander, doch den Schlüssel konnte sie nicht finden.
Im Aufsatz des Schreibtisches befanden sich links und rechts je vier weitere kleine Schubladen, die Salvina alle gründlich durchsuchte. Danach stöberte sie in den vielen Schreibutensilien auf dem Regalbrett des Aufsatzes. Die beiden Unterschränke räumte sie leer, und zuletzt tastete sie den gesamten Schreibtisch von allen Seiten her ab, in der Hoffnung, der Schlüssel hinge an irgendeinem versteckten Haken. Aber sie konnte ihn nicht finden.
Die Vorstellung, den Schreibtisch komplett leer räumen zu müssen, davor graute ihr. Deshalb ging sie in Gedanken noch einmal all ihre Schritte durch und überlegte, ob es vielleicht doch noch eine Stelle gab, an der sie nicht gesucht hatte. Da fiel ihr in ihrer Erinnerung etwas auf. Sofort öffnete sie alle Schubladen des Aufsatzes bis zum Anschlag und verglich die rechte mit der linken Seite. Auf der rechten Seite war die oberste Schublade die kürzeste, die unterste die längste. Die Vorderkanten aller vier Schubladen lagen ausgezogen und von der Seite betrachtet auf einer geraden Linie. Auf der linken Seite dagegen konnte sie die zweite Schublade von oben nur so weit herausziehen, dass deren Vorderkante genauso weit hervorstand wie die der obersten.
Salvina räumte den Inhalt der zweiten Schublade auf die Schreibunterlage. Dann tastete sie die Schublade innen ab. An der Rückwand fühlte sie einen kleinen Knopf, etwas größer als der Kopf eines Spielkegels. Sie fasste ihn und zog daran. Zuerst zog sie ganz sanft, dann etwas fester, und plötzlich löste sich der kugelförmige Messingknopf. Er war an einer Sperrholzplatte angeschraubt, die genau die Größe der Innenfläche der Rückwand hatte. An der Rückseite der Sperrholzplatte war an allen vier Ecken je eine Unterlegscheibe aus Stahl festgeklebt. In gleicher Position befanden sich an der Innenseite der Rückwand der Schublade vier Magneten. Salvina zog die Sperrholzplatte heraus. Nun ließ sich die Schublade ebenso weit herausziehen wie die auf der rechten Seite. Hinter der Sperrholzplatte lag ein einfacher, dunkel angelaufener Schlüssel mit einem ringförmigen Griff.
Salvina nahm den Schlüssel an sich. Dann räumte sie alles zurück in die Schublade und legte die Sperrholzplatte oben auf. Ohne die Tür abzuschließen, verließ sie den Laden und tastete sich die dunkle Treppe hinab in den Keller.
Als sie vor der alten Truhe aus einfachen Fichtenbrettern stand, bekam sie ein flaues Gefühl im Magen. Nun wurde sie sich dessen bewusst, dass sie kurz davor stand, ein Geheimnis ihres Vaters zu lüften, und dass sie damit seine Privatsphäre verletzte. Trotzdem steckte sie langsam den Schlüssel in das Schloss und drehte ihn behutsam, bis sie das Schloss aufschnappen hörte. Jetzt bräuchte sie nur noch den Deckel anzuheben, und sie wäre am Ziel, glaubte sie.
Bedächtig führte sie ihre Hände unter den Rand des Deckels und hob ihn ein Stück an. Dann erinnerte sie sich ihres nächtlichen Traumes, und erschrocken ließ sie den Deckel wieder fallen. Panisch drehte sie sich um und suchte mit ihrem Blick das Lager nach ihrem Vater ab. Ihr Herz pochte, Blut schoss ihr in den Kopf, ihr wurde augenblicklich unerträglich heiß. Dann schüttelte sie den Kopf, sie wunderte sich über sich selbst. Es war nur ein Traum gewesen. Ein dummer Traum, der ihr lediglich Gewissensbisse verursachen wollte. Aber sie brauchte kein schlechtes Gewissen gegenüber ihrem Vater zu haben. Er lebte nicht mehr, sie hatte sein Erbe angetreten, und diese Truhe hier war ein Teil dieses Erbes. Es war nicht nur ihr Recht, es war ihre Pflicht, sie zu öffnen.
Noch einmal griff sie nach dem Deckel und hob ihn behutsam an. Sie schloss die Augen, presste ihre Lider fest zusammen und öffnete den Deckel Stück für Stück weiter. Als sie ihn senkrecht glaubte, öffnete sie ihn noch ein weiteres Stück, bis sie einen leichten Widerstand spürte. Jetzt ließ sie ihn vorsichtig los. Der Deckel verharrte in seiner Position, und Salvina trat einen kleinen Schritt zurück. Schließlich öffnete sie langsam wieder ihre Augen.
Ganz oben lag in der ausgefüllten Truhe das Bild eines schlafenden Mädchens im Alter von vielleicht acht Jahren. Sie hatte dunkles, fast schwarzes, langes, welliges Haar. Ihre Haut war leicht gebräunt, und ihr Gesicht war frei von Regung, völlig gelöst, beinahe der Welt entrückt. Sie trug ein hellbraunes Sommerkleid mit weißem Blumenmuster. Die Ärmel waren kurz, und im Brustbereich hatte das Kleid eine Reihe weißer Knöpfe. Friedlich lag das Mädchen im Gras.
Ein einfacher Rahmen aus Holz zierte das in Öl auf Leinwand gemalte Bild. Vorsichtig entnahm sie es der Truhe und achtete darauf, dass sie es nicht beschädigte. Dann ging sie damit ans Licht. Dort betrachtete sie das Kleid des Mädchens genauer, den Stoff, das Muster, die Form der Knöpfe. Sie schüttelte den Kopf. Fieberhaft kramte sie in ihren Kindheitserinnerungen, doch an dieses Kleid konnte sie sich nicht erinnern. Sie war sich ganz sicher, nie ein solches Kleid besessen zu haben. Trotzdem zeigte das Gemälde ihr Porträt aus Kindertagen.
Die Klingel ertönte und Salvina erschrak so heftig, dass sie beinahe das Gemälde fallen gelassen hätte. Über das Bild hatte sie die Existenz ihres Ladens für einen kurzen Moment vergessen. Ihre Gedanken waren der Wirklichkeit entflohen, so, als wäre sie mit dem Bild in eine längst vergangene Zeit gereist, in eine Zeit, in der sie sich nicht verstellen musste, in der sie sein konnte, sein durfte, wie und was sie war. Doch jetzt musste sie sich beeilen, sie musste so schnell wie möglich in den Laden. Die Wirklichkeit rief sie zurück. Augenblicklich senkte sie den Deckel der Truhe, sperrte das Schloss ab, steckte den Schlüssel in die Tasche ihrer Jeans und eilte mit dem Bild unter dem Arm die schmale Treppe nach oben.
Salvina stellte das Bild neben dem Schreibtisch ihres Vaters auf den Boden und beeilte sich, die Dame mittleren Alters zu begrüßen, die in der Mitte des Ladens stand und bereits ungeduldig umher sah. In ihrem dunkelroten Kostüm war sie für Salvina nicht zu übersehen. Das kräftige Rot bildete einen eleganten Kontrast zu ihrem in hellem Blond gefärbten Haar. Schon von Ferne atmete Salvina den angenehmen Duft ihres leicht süßlichen und dennoch auf sie erfrischend wirkenden Parfüms. Als Salvina schließlich vor ihr stand, bemerkte sie die vielen zartgliedrigen goldenen Ketten, die ihre Kundin am Hals trug. Beinahe jeden Finger schmückte mindestens ein goldener Ring. Manche dieser Ringe waren mit Edelsteinen besetzt.
»Guten Tag, was kann ich für Sie tun?«, fragte Salvina. Die Dame reagierte nicht sofort auf ihre Frage, sie sah stattdessen zuerst auf Salvinas weiße Socken und ihre weißen Sandalen, dann auf ihre abgetragene Jeans, auf ihre farblose Bluse, bis ihr Blick auf Salvinas Frisur endlich zur Ruhe kam.
»Lassen Sie Ihre Kunden immer so lange warten?«, fragte sie in einer hellen, den Raum füllenden Stimme und hob ihre gepuderte Nase kaum sichtbar an.
Verlegen kratzte sich Salvina am Nacken und antwortete mit leiser Stimme: »Ich war gerade im Lager. Das ist im Keller, deshalb dauerte es eine Weile, bis ich wieder nach oben in den Laden kommen konnte. Aber nun bin ich ja hier.«
»Haben Sie Schmuck?«, fragte die Dame und schaute zuerst auf Salvinas nackten Hals, dann auf ihre schlanken Finger, die kein einziger Ring zierte. Da Salvina kurz zu überlegen schien, fügte sie hinzu: »Antiken, keinen Modeschmuck.«
»Nein, Schmuck habe ich nicht«, gestand Salvina kleinlaut.
»Das habe ich mir schon gedacht«, antwortete die Dame, drehte sich um und schritt, ohne sich zu verabschieden, zur Tür. Dabei klapperten ihre dünnen Absätze auf dem ausgetretenen Parkett.
»Warten Sie!«, rief Salvina. »Ich habe zwar keinen Schmuck, aber zwei sehr schöne Schmuckkästchen aus edlem Holz, die Ihnen bestimmt gefallen werden; mit feiner Intarsienarbeit, Ende neunzehntes Jahrhundert.«
Als sie dies sagte, wurde ihr heiß. Sie wusste nicht, aus welcher Zeit ihre Waren stammten. Es interessierte sie auch nicht. Aber sie spürte, dass sich die Kundin für die Schmuckkästchen interessieren würde, wenn sie alt genug wären.
Sie folgte Salvina zu den beiden Schmuckkästchen. Vorsichtig nahm sie das größere, öffnete es, begutachtete es von allen Seiten. Als sie das Preisetikett am Boden sah, sagte sie und runzelte dabei die Stirn: »Das ist nicht Ihr Ernst, mein Schätzchen.« Dann nahm sie das andere, begutachtete es auf die gleiche Weise und in derselben Reihenfolge wie das erste und sagte wieder mit immer noch gerunzelter Stirn: »Die Schmuckkästchen sind zwar sehr schön, auch erstklassig gearbeitet, aber nicht älter als fünfzig Jahre.« Nach einer kurzen Pause, in der sie Salvinas unruhige Hände beobachtete, sprach sie weiter: »Ich nehme sie trotzdem, jedoch nicht zu diesem Preis.« Dann holte sie ihr Portemonnaie aus der Handtasche, nahm einen Geldschein, hielt diesen Salvina entgegen, ergriff beide Schmuckkästchen und verließ den Laden, ehe Salvina darauf hätte etwas erwidern können.
Salvinas Augen begannen, vor Freude über ihren ersten Verkauf seit zwei Tagen leicht zu glänzen. So ging sie zur Registrierkasse und legte den Schein hinein. Aber ihre Freude währte nicht lange. Bereits als sie die Kasse öffnete und die leeren Geldfächer sah, fühlte sie sich von der Dame über den Tisch gezogen. Wie hatte sie in der kurzen Zeit und ohne eingehende Prüfung das Alter der Kästchen bestimmen können? Salvina glaubte ihr nicht. So, wie sie selbst das beachtliche Alter der Schmuckkästchen erfunden hatte, um den hohen Preis, den sie erst vor wenigen Tagen mit Bleistift und schlechtem Gewissen auf die Etiketten geschrieben hatte, verlangen zu können, dachte sie nun, hätte die Dame das Alter ohne sachkundiges Wissen zu niedrig angesetzt.
Sie schob den Geldkasten zurück in die Registrierkasse und begann, sich über sich selbst zu ärgern. Kein Wunder, dachte sie, dass mein Laden schlecht läuft, wenn ich mir von meinen Kunden die Preise diktieren lasse, und kratzte sich am Hals. Zuerst nur mit einem Finger und zart an der Oberfläche der Haut. Je länger sie sich ärgerte, desto mehr Finger benutzte sie. Immer fester drückte sie ihre Nägel dabei in den Hals, bis sie das Gefühl hatte, die Haut durchbohrt zu haben und bis ins Fleisch vorgedrungen zu sein. Erst jetzt stoppte sie, zog ihre Nägel langsam zurück und strich ihre Haut mit den sanften Fingerkuppen wieder glatt. Diesmal hörte sie noch rechtzeitig auf, bevor die Haut zu bluten begann.
»Immerhin habe ich etwas verkauft«, sagte sie laut zu sich selbst. Der Satz spendete ihr Trost, deshalb wiederholte sie ihn. Ein drittes Mal sprach sie ihn laut in den Raum, als wollte sie ihr unsichtbares Gegenüber davon überzeugen, dass ein schlechtes Geschäft immer noch besser sei, als gar kein Geschäft. Ihr Ärger verflog tatsächlich. Sie atmete bewusst langsam und tief, bis sich die Ruhe des Atems auf ihre Stimmung übertrug. Schon bald hatte sie die Dame und ihren Ärger über ihre mangelnde Geschäftstüchtigkeit vergessen.
Sie ging zum Schreibtisch ihres Vaters und nahm das Gemälde, das scheinbar ihr Porträt im Alter von acht Jahren zeigte. Sie führte ihre Hände an den Rahmen und hob es vorsichtig auf, wie einen zerbrechlichen Schatz. Dann trug sie es zum Schaufenster, dort hängte sie es an einen unbenutzten Nagel in der Wand. Als sie sich sicher war, dass der Nagel hielt, ging sie ein paar Schritte zurück und prüfte aus der Entfernung Lage und Ausrichtung des Bildes.
Am späten Nachmittag kam Klara. Mit offenen Armen stürmte sie von der Straße in den Laden direkt auf Salvina zu und küsste sie kräftig und laut auf die Wangen. Sogleich ließ sie Salvina wieder los und eilte weiter in die kleine Küche. Salvina schloss die Augen, sie wollte es nicht mit ansehen müssen, wenn bei Klaras stürmischem Auftritt etwas zu Bruch ging. Kurz wartete sie. Als keine Scherben klirrten, folgte sie ihr in die Küche.
Klara hatte sich bereits eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank geholt und war gerade dabei, sie zu öffnen. Es war Klaras Bier, das in Salvinas Kühlschrank stand. Salvina trank nur selten Bier. Wenn Klara nach der Arbeit bei Salvina vorbeikam, hatte sie immer Lust auf Bier, deshalb hatte sie sich in der kleinen Küche von Salvinas Laden einen ständigen Vorrat eingerichtet.
Sie setzten sich an den Tisch. Paules Stuhl blieb frei. Klaras Blick war ernst und mahnend, als sie zu sprechen begann: »Heute musste ich erst später zur Arbeit.« Mehr sagte sie zunächst nicht. Salvina zuckte mit den Achseln und antwortete: »Das freut mich für dich, dann konntest du ja endlich wieder ausschlafen.«
»Darum geht es nicht, Salvina. Ich habe euch gehört. Das soll heißen, ich habe dich gehört.«
»Das tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe.«
»Lenk nicht ab. Du weißt genau, was ich meine. Salvina, so geht das nicht weiter. Ich mache mir Sorgen, verstehst du?«
»Nein, ich verstehe dich nicht. Es ist meine Privatsache, mit wem ich mich unterhalte.«
»Ja, es ist deine Privatsache, natürlich. Und solange es deine Gesprächspartner wirklich gibt, würde ich mich auch niemals einmischen, das weißt du. Aber Paule ist seit Jahren tot, und du hattest ihn kaum gekannt. Salvina! Ich bitte dich! Du kannst doch nicht mit Toten sprechen, so, als würden sie neben dir sitzen. Du musst seinen Tod akzeptieren, sonst machst du dich noch verrückt.«
Salvina sah Klara mit großen Augen an und fasste sich an den Hals, aber sie kratzte sich nicht. Kraftvoll rieb sie sich mit der flachen Hand über die Kehle und sagte: »Wie oft soll ich dir das denn noch erklären, damit du mich endlich in Ruhe lässt? Ich hätte ihn bei mir wohnen lassen können, dann wäre er nicht erfroren. Immerhin war er ein guter Freund meines Vaters gewesen.«
»Eben, Salvina. Er war ein Freund deines Vaters, nicht dein Freund. Machte sich dein Vater auch solche Vorwürfe?«
»Das spielt keine Rolle. Wir schieben so viele Dinge vor, um uns ein gutes Gewissen zu bewahren, doch in Wirklichkeit sind wir nur bequem. Meine Bequemlichkeit hat Paule das Leben gekostet. Von dieser Schuld kannst du mich mit noch so schönen Worten nicht freisprechen.«
»Dich trifft keine Schuld. Paule hatte das Leben gelebt, für das er sich entschieden hatte. Du bist nicht für das Elend dieser Welt verantwortlich. Überfordere dich nicht, sonst bleibst am Ende du selbst auf der Strecke. Und dafür trägst du dann wirklich Schuld. Dein eigenes Leben ist es, wofür du endlich Verantwortung übernehmen musst, nicht das Leben der anderen.«
Salvina senkte den Kopf und nickte kaum sichtbar. Klara hätte sie gerne davor beschützt, in die Tiefen ihrer Seele abzustürzen. Denn sie hatte den Eindruck, Salvina würde immer häufiger ins Wanken geraten und dadurch Gefahr laufen, ihren Halt zu verlieren und abzustürzen. Aber sie fühlte sich Salvinas mangelnder Einsicht gegenüber machtlos. Ihrer Meinung nach fühlte sich Salvina nur deshalb für Paules Tod mitschuldig, weil sie sich selbst von der Notwendigkeit ablenken wollte, ihr eigenes Leben in Griff zu bekommen. Klara konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass Salvina Angst hatte: Angst, etwas falsch zu machen und Angst vor ihrer eigenen Courage.
»Hast du den Schlüssel gefunden?«, fragte sie unvermittelt.
Salvina sah auf und antwortete: »Du wirst es mir nicht glauben, aber es war Paule, der mir gesagt hat, wo ich den Schlüssel suchen soll. Und dort habe ich ihn schließlich gefunden.«
Klara lehnte sich im Stuhl zurück und schüttelte vehement den Kopf. »Nein Salvina, nicht Paule. Du selbst hast es dir gesagt, wo der Schlüssel ist. Aber dieses Theaterstück hättest du dir auch sparen können, wenn du eh wusstest, wo er ist.«
»Du glaubst also, ich hätte dich belogen, als ich behauptete, dass ich nicht weiß, wo der Schlüssel sein kann?«
Klara antwortete nicht. Also erzählte Salvina ausführlich, wie und wo der Schlüssel versteckt war. Da ihr Klara noch immer nicht glaubte, forderte Salvina sie auf, mit ihr zum Schreibtisch ihres Vaters zu gehen. Dort zeigte sie ihr die Schublade mit der doppelten Rückwand.
Klara sah Salvina mit großen Augen an und fragte: »Paule hat es dir gesagt?«
»Dass ich im Schreibtisch suchen soll, das hat er gesagt.«
»Und mehr nicht?«
»Nein, mehr nicht.«
»Und du bist dir sicher, dass du dieses kleine Brett noch nie bemerkt hast, auch nicht den Knopf daran?«
»Klara!«, stöhnte Salvina und verdrehte die Augen.
Klara nahm ihr das kleine Sperrholzbrett aus der Hand, fügte es an die Innenseite der Rückwand und war über den festen Halt des Brettchens verwundert, nachdem sie das metallene Klacken der Unterlegscheiben auf den Magneten gehört hatte. Sie räumte alles wieder in die Schublade und schob sie hinein. Dann öffnete und schloss sie der Reihe nach sämtliche Schubladen des Schreibtischaufsatzes. Noch einmal öffnete sie alle Schubladen und ließ sie offen stehen. Den Kopf leicht hin und her wiegend sagte sie schließlich:
»Manchmal bist du mir unheimlich. Ich glaube, ich hätte dieses Versteck nie gefunden.«
»Ich hätte es auch nicht gefunden, wenn mich nicht Paule gedrängt hätte, im Schreibtisch meines Vaters zu suchen. Nur deshalb suchte ich so hartnäckig. Und entdeckt habe ich es erst, als ich die offenen Schübe von der Seite anschaute. Von da siehst du, dass die Zweite kürzer ist, als sie sein müsste.«
Nun betrachtete Klara die Schubladen von der Seite. Sie nickte und bestätigte: »Aber das siehst du nur, wenn alle offen sind.«
Über Salvinas Mimik legte sich sofort ein Lächeln des Triumphes. Sie schloss alle Schübe und erwiderte knapp: »Komm mit, ich zeig dir was.« Dann fasste sie Klara am Arm, ging mit ihr den engen Weg zum Schaufenster und blieb vor dem Gemälde stehen.
Klara sah sich das Bild genau an. Ihr Gesicht blieb unbewegt. Schließlich zuckte sie mit den Achseln und sagte:
»Wer hat das gemalt? Es ist gut. Es sieht beinahe aus wie eine Fotografie. Du warst ein hübsches Mädchen.«
»Das bin ich nicht.«
Ungläubig sah Klara zu ihrer Freundin und fragte: »Nein? Wer sollte es sonst sein? Das Mädchen sieht dir verdammt ähnlich, sogar die Nase stimmt.«
»Ich habe keine Stupsnase, meine ist lang und kantig.«
»Kinder haben Stupsnasen. Mit zunehmendem Alter werden Nasen kantiger und länger. Bei manchen Menschen ist dies deutlicher, bei anderen weniger stark ausgeprägt. Auf jeden Fall verliert die Nase ihr kindliches Aussehen. Hast du nicht ein Foto von dir in diesem Alter? Dann könnten wir es vergleichen.«
Salvina holte ein Fotoalbum und suchte nach alten Aufnahmen von ihr. Als sie ein Bild von sich im Alter von acht Jahren fand, zeigte sich die verblüffende Ähnlichkeit.
»Ich sagte doch, dass es ein Porträt von dir ist. Ich glaube, du willst mich auf den Arm nehmen.«
»Nein Klara, das bin ich nicht. Das Gemälde lag in der Truhe, die mein Vater vor mir versteckt hatte.«
»Na also, Erinnerungen deines Vaters an deine Kindheit.«
»Nein Klara, nicht an meine Kindheit. Ich habe nie solch ein braunes Sommerkleid besessen.«
»Die Erinnerung trügt oftmals. Ich denke schon, dass du das Mädchen auf dem Gemälde bist.«
»Nein, da bin ich mir inzwischen ganz sicher.«
»Und wer soll es dann sein?«
»Die Enkelin von der Frau, die mir damals den Schlüssel geben wollte und gestern vor meinem Fenster stand.«
»Komm schon, Salvina. Mach dich nicht verrückt!«
»Klara! Ich spüre es.«