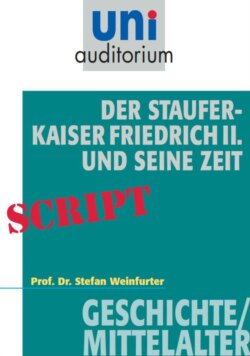Читать книгу Der Staufer-Kaiser Friedrich der II. und seine Zeit - Stefan Weinfurter - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kreuzzug als „Leitidee“ der Epoche
ОглавлениеDie Jahre um 1200, so kann man die Entwicklungen zusammenfassen, leiteten geistige, religiöse, wirtschaftliche, soziale und politische Umwälzungen von enormer Tragweite ein. Von ihnen wurde das künftige Bild des ganzen europäischen Kontinents geprägt. Die Jahrzehnte von etwa 1180 bis 1250 bedeuten geradezu eine Schlüsselepoche für die weitere Ausformung der politischen und ge-sellschaftlichen Ordnung, auch wenn die Wurzeln der neuen Denk- und Ordnungsmodelle vielfach weiter zurückreichten.
Als eines der Kennzeichen dieser Epoche wird man die Kreuzzugsbewegung nennen müssen. Am 4. Juli 1187 hatte das Heer Sultan Saladins (1169-1193) bei den „Hörnern von Hattin“ nördlich von Nazareth dem Kreuzfahrerheer eine vernichtende Niederlage zugefügt. Die Schlacht, die zu den folgenreichsten des Mittelalters gezählt werden muss, bedeutete für die Christen den Verlust Jerusalems am 2. Oktober 1187. Aber die Folgen für das gesamte Gefüge der Mittelmeerwelt und Westeuropas gingen weit darüber hinaus.
In ganz Europa wurden enorme Kräfte in die weitere Kreuzzugspolitik investiert. Die Propaganda und das politisch-diplomatische Verhalten waren zutiefst von der Forderung nach Rückeroberung Jerusalems und des Heiligen Landes bestimmt. Der „Kreuzzug“ entwickelte sich fortan zu einem ständigen Programm, vor allem an der Kurie in Rom.
Papst Innocenz III., der von 1198 bis 1216 auf dem Stuhl Petri saß, gilt als erster Papst, der den im-merwährenden Kreuzzug forderte. Er wartete nicht mehr auf ein besonderes politisches Ereignis aus dem Heiligen Land, um daraus die Berechtigung für einen Kreuzzug abzuleiten. Er sah sich vielmehr dazu verpflichtet, mit allen ihm und der römischen Christenheit zur Verfügung stehenden Mitteln die Herrscher, Fürsten und Ritter zum Kriegszug nach dem Orient zu veranlassen.
Um diesen Auftrag dem gesamten Christenvolk zu verkünden, lud er alle Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und Prioren zum vierten Laterankonzil ein, das 1215 in Rom veranstaltet wurde. Im päpstlichen Einladungsschreiben wird bereits deutlich, worum es Innocenz III. ging: Zwei Dinge, so heißt es da, seien es, die sein Herz zutiefst bewegten, die Wiedereroberung des Heiligen Landes und die Reform der ganzen Kirche. Und dann wörtlich: „Beide sind von so großer Dringlichkeit, dass sie ohne schwere und große Gefahr nicht weiter ignoriert oder aufgeschoben werden können.“
Der „Kreuzzug“ wurde zum bestimmenden Faktor der Zeit – der auch die Herrschaft und das Handeln Friedrichs II. zutiefst beeinflusst hat.
Insbesondere für die Mittelmeerwelt waren die Konsequenzen weitreichend. Für die Überfahrt des Kreuzfahrerheeres 1202 hatte Papst Innocenz III. die See- und Handelsmacht Venedig beauftragt – für die gewaltige Summe von 85000 Mark Silber. Außerdem sollte den Venezianern die Hälfte aller Eroberungen an Land und Habe zufallen. Als die Summe nicht aufgebracht werden konnte, eroberte das Heer für Venedig die Stadt Zadar an der dalmatinischen Küste. Anschließend erhielten die Kreuzfahrer vom vertriebenen Kaisersohn Alexios von Byzanz das Angebot, er würde ihnen 200000 Mark Silber bezahlen, wenn sie ihm die Herrschaft in Konstantinopel wieder verschaffen würden.
Als die Kreuzfahrer sich darauf einließen, begann das Unternehmen Byzanz, das 1204 mit der Eroberung und Plünderung der Stadt ihren traurigen Höhepunkt erlangte. In der Hagia Sophia wurde Graf Balduin von Flandern zum ersten „Lateinischen Kaiser“ von Byzanz gekrönt – anerkannt vom Papst in Rom. Damit war zum ersten Mal ein Kreuzzug gegen Christen gelenkt worden. Zum ersten Mal gab es zwei gleichartige Kaiser in Europa, nämlich beide legitimiert vom Papst.
Diese Vorgänge brachten erhebliche politische Umwälzungen für die Länder am Mittelmeer mit sich. Venedig stieg zur führenden Wirtschaftsmacht auf. Mit Genua und Pisa gab es freilich starke Konkurrenten, die sich um die Vermarktung der Erzeugnisse Italiens, vor allem Siziliens, stritten. Insbesondere Ägypten blieb ein stets gesuchter Handelspartner. Die ägyptische Herrschaft der Ayyubiden, die Sultan Saladin – dessen Vater den Namen Ayyub trug – aufgebaut hatte, befand sich um 1200 im Zerfall, so dass sich die Handelsbeziehungen erleichterten.
Seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert – auch das ist ein Zug der Zeit – verhärteten sich die religiösen Abgrenzungen.
In Spanien gab es scharfe Auseinandersetzungen mit den Muslimen. In Sizilien führte in den zwanziger Jahren der Stauferkaiser Friedrich II. erbitterte Kämpfe gegen die sarazenische Bevölkerung, die sich in den Bergen Siziliens verschanzt hielt. Große Teile der muslimischen Bewohner wurden in den Kämpfen getötet. Die Restbevölkerung siedelte Friedrich II. zwischen 1224 und 1246 auf das süditalienische Festland um, und zwar in die Stadt und die Gegend von Lucera in der Region Capitanata in Nordapulien. Dort war es ihnen fortan erlaubt, ihre Religion auszuüben. Dafür waren sie verpflichtet, Friedrich II. jederzeit als zuverlässige Krieger zur Verfügung zu stehen.
Dieser Umstand signalisiert im übrigen, dass man im beginnenden 13. Jahrhundert dazu überging, die Heere immer weniger aus Lehnsleuten als aus Sold- und Berufskriegern verschiedenster Art zusammenzustellen.
Die Umwälzungen in Europa führten zu einer ganzen Serie von Kriegen, die zum Teil Weichen stellende Bedeutung erlangten. Einer von ihnen war die Schlacht von Bouvines 1214. Durch sie gelang es dem König von Frankreich, Philipp II. Augustus (1180-1223), das Heer des englischen Königs, Johann Ohneland, zu schlagen. Der Verlierer musste ein Jahr später, 1215, hinnehmen, dass ihm die englischen Barone die Magna Charta abpressten.
Für Frankreich war es der Start zur europäischen Großmacht, denn der Sieg ermöglichte dem König von Frankreich, sich in den weiten Gebieten des Anjou, das bis dahin zur englischen Krone gehört hatte, auszubreiten.