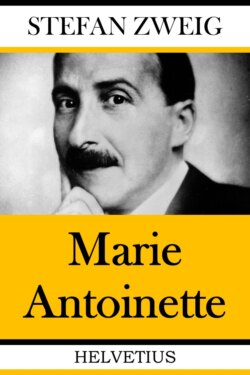Читать книгу Marie Antionette - Stefan Zweig - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Königin des Rokoko
ОглавлениеIm Augenblick, da Marie Antoinette, die Tochter seiner alten Gegnerin Maria Theresia, den französischen Thron besteigt, wird Friedrich der Große, der Erbfeind Österreichs, unruhig. Brief auf Brief sendet er an den preußischen Gesandten, er möge sorgfältig ihren politischen Plänen nachspüren. In der Tat, die Gefahr ist für ihn groß. Marie Antoinette brauchte nur zu wollen, sich ein ganz klein wenig zu bemühen, und alle Fäden der französischen Diplomatie liefen einzig durch ihre Hand, Europa wäre von drei Frauen beherrscht, von Maria Theresia, Marie Antoinette und Katharina von Rußland. Aber zum Glück für Preußen, zum Verhängnis für sich selbst, fühlt sich Marie Antoinette nicht im mindesten von der großartigen, der welthistorischen Aufgabe angezogen, sie denkt nicht daran, die Zeit zu verstehen, sondern einzig, sich die Zeit zu vertreiben, lässig greift sie nach der Krone wie nach einem Spielzeug. Statt die ihr zugefallene Macht zu nutzen, will sie sie bloß genießen.
Dies war der verhängnisvolle Fehler Marie Antoinettes von allem Anbeginn: sie wollte als Frau siegen statt als Königin, ihre kleinen weiblichen Triumphe zählten ihr mehr als die großen und weithinreichenden der Weltgeschichte, und weil ihr verspieltes Herz der königlichen Idee keinen seelischen Inhalt zu geben wußte, sondern nur eine vollendete Form, schrumpfte ihr unter den Händen eine große Aufgabe in ein vergängliches Spiel, ein hohes Amt in eine schauspielerische Rolle. Königin sein, heißt für Marie Antoinette fünfzehn leichtsinnige Jahre lang ausschließlich: als die eleganteste, die koketteste, die bestangezogene, verwöhnteste und vor allem die vergnügteste Frau eines Hofes bewundert zu werden, der arbiter elegantiarum, die tonangebende Mondäne jener vornehm überzüchteten Gesellschaftswelt zu sein, die sich selbst für die Welt hält. Zwanzig Jahre lang spielt sie auf ihrer Privatbühne von Versailles, die wie ein japanischer Blumensteig über einen Abgrund gebaut ist, selbstverliebt die Primadonnenrolle der vollkommenen Rokokokönigin mit Stil und Anmut. Aber wie arm bleibt das Repertoire dieser Gesellschaftskomödie: ein paar kleine flüchtige Koketterieen, ein paar dünne Intrigen, sehr wenig Geist und sehr viel Tanz. Bei diesen Spielen und Spielereien hat sie keinen rechten Partner als König zur Seite, keinen wahrhaften Helden als Gegenspieler und eine immer gleiche, gelangweilt snobistische Zuschauerschaft, indes außerhalb der vergoldeten Gittertore ein Millionenvolk auf seine Herrscherin harrt. Aber die Verblendete läßt nicht von der Rolle, sie wird nicht müde, immer mit neuen Nichtigkeiten ihr törichtes Herz zu betören; selbst als von Paris her schon der Donner über die Gärten von Versailles drohend heranrollt, läßt sie nicht ab. Erst da sie die Revolution gewaltsam von dieser winzigen Rokokobühne auf die große und tragische der Weltgeschichte reißt, erkennt sie den ungeheuren Irrtum, daß sie zwanzig Jahre lang eine zu geringe Rolle gewählt, die der Soubrette, die der Salondame, indes das Schicksal ihr Kraft und Seelenstärke für eine heldische verliehen hatte. Spät erkennt sie diesen Irrtum und doch nicht zu spät. Denn gerade in dem Augenblick, da sie die Rolle der Königin nicht mehr zu leben und nur noch zu sterben hat, im tragischen Nachspiel der Schäferkomödie, erreicht sie ihr wirkliches Maß. Erst als das Spiel Ernst wird und man ihr die Krone nimmt, wird Marie Antoinette wirklich vom Herzen her Königin.
Diese Gedanken- oder vielmehr Gedankenlosigkeitsschuld Marie Antoinettes, daß sie fast zwanzig Jahre lang das Wesenhafte dem Nichtigen aufopfert, die Pflicht dem Genuß, das Schwere dem Leichten, Frankreich dem kleinen Versailles, die wirkliche Welt ihrer Spielwelt, – diese historische Schuld ist beinahe unfaßbar. Um sie in ihrer Sinnlosigkeit sinnlich zu begreifen, nimmt man am besten zur Probe eine Karte Frankreichs zur Hand und zeichnet sich dort den winzigen Lebensraum nach, innerhalb dessen Marie Antoinette die zwanzig Jahre ihrer Regierung verbrachte. Das Ergebnis ist verblüffend. Denn dieser Kreis ist so klein, daß er auf einer mittleren Karte fast zum Pünktchen wird. Zwischen Versailles, Trianon, Marly, Fontainebleau, Saint-Cloud, Rambouillet, sechs Schlössern innerhalb eines lächerlichen Raumes weniger Wegstunden, rollt der goldene Kreisel ihrer betriebsamen Langeweile unablässig hin und her. Nicht ein einziges Mal hat, räumlich so wenig wie geistig, Marie Antoinette das Bedürfnis empfunden, dieses Pentagramm zu überschreiten, in dem sie der dümmste aller Teufel, der Vergnügungsteufel, eingeschlossen hielt. Nicht ein einziges Mal in fast einem Fünftteil eines Jahrhunderts hat die Herrscherin Frankreichs dem Wunsch Folge geleistet, ihr eigenes Reich kennen zu lernen, die Provinzen, deren Königin sie ist, zu sehen, das Meer, das die Küsten umspült, die Berge, Festungen, Städte und Kathedralen, das breite und vielfältige Land. Nicht ein einziges Mal stiehlt sie ihrem Müßiggang eine Stunde Zeit, einen ihrer Untertanen zu besuchen oder auch nur an sie zu denken, nicht ein einziges Mal betritt sie ein bürgerliches Haus: all diese wahrhafte Welt außerhalb ihres Adelskreises war faktisch für sie nicht vorhanden. Daß sich rund um das Opernhaus von Paris eine riesige Stadt dehnt, dicht gefüllt mit Armut und Unmut, daß hinter den Teichen von Trianon mit den chinesischen Enten und wohlgefütterten Schwänen und Pfauen, hinter dem sauber und schmuck von Hofarchitekten entworfenen Paradedorf, dem Hameau, die wirklichen Bauernhäuser verfallen und die Scheunen leer stehen, daß hinter den vergoldeten Gittern ihrer Parks ein Millionenvolk arbeitet, hungert und hofft, hat Marie Antoinette nie gewußt. Vielleicht konnte dem Rokoko nur jenes Nichtwissen und Nichtwissenwollen um alle Tragik und Trübe der Welt jene bezaubernde Grazie, jene leichte, sorglose Anmut geben; nur wer den Ernst der Welt nicht kennt, kann ja so selig spielen. Aber eine Königin, die ihr Volk vergißt, wagt hohes Spiel. Eine Frage hätte Marie Antoinette die Welt aufgetan, aber sie wollte nicht fragen. Ein Blick in die Zeit, und sie hätte begriffen, aber sie wollte nicht begreifen. Sie wollte in ihrem Abseits heiter, jung und unbehelligt bleiben. Von einem Irrlicht geführt, geht sie unablässig im Kreise und versäumt mit ihren Hofmarionetten und inmitten einer künstlichen Kultur die entscheidenden und nicht wieder einzuholenden Jahre ihres Lebens.
Das ist ihre Schuld, ihre unleugbare: mit einem Leichtsinn ohnegleichen hingetreten zu sein vor die gewaltigste Aufgabe der Geschichte, mit einem weichen Herzen in die härteste Auseinandersetzung des Jahrhunderts. Eine unleugbare Schuld und doch eine läßliche, weil begreiflich durch ein Maß der Versuchung, der auch ein stärkerer Charakter kaum hätte widerstehen können. Aus der Kinderstube ins Ehebett geholt, aus den Hinterzimmern eines Palastes über Nacht zur höchsten Macht gleichsam noch träumend gerufen, noch nicht fertig, noch nicht geistig erweckt, fühlt sich diese arglose, nicht sonderlich starke, nicht sonderlich wache Seele plötzlich sonnenhaft umkreist von einem Planetentanz der Bewunderung; und wie schurkisch gut ist dies Geschlecht des Dix-huitième geübt, eine junge Frau zu verführen! Wie durchtrieben geschult in der Giftmischerei feiner Schmeicheleien, wie erfinderisch in der Fertigkeit, mit Nichtigkeiten zu entzücken, wie meisterlich in der hohen Schule der Galanterie und der phäakischen Kunst, das Leben leicht zu nehmen! Erfahren und übererfahren in allen Verlockungen und Schwächungen der Seele, ziehen die Höflinge dieses unerfahrene, dieses auf sich selbst noch neugierige Mädchenherz gleich von Anfang an in ihren zauberischen Kreis. Seit dem ersten Tage ihres Königinnentums schwebt Marie Antoinette in einer Weihrauchwolke maßloser Vergötterung. Was sie sagt, gilt als klug, was sie tut, als Gesetz, was sie wünscht, wird erfüllt. Sie hat eine Laune, und morgen schon ist sie Mode. Sie macht eine Torheit, und ein ganzer Hof ahmt sie begeistert nach. Ihre Nähe ist Sonne für diese eitle, ehrgeizige Schar, ihr Blick ein Geschenk, ihr Lächeln Beglückung, ihr Kommen ein Fest; wenn sie Empfang hält, machen alle Damen, die ältesten wie die jüngsten, die vornehmsten wie die eben zum Hofe zugelassenen, die krampfhaftesten, die heitersten, die lächerlichsten, die läppischsten Anstrengungen, um Gottes willen nur für eine Sekunde ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, eine Artigkeit zu erhaschen, ein Wort, und wenn nicht dies, so doch wenigstens bemerkt und nicht übersehen zu werden. Auf den Straßen wiederum jubelt ihr das Volk, zu Scharen gereiht, gläubig entgegen, im Theater erhebt sich vom ersten Platz bis zum letzten die versammelte Zuhörerschaft, und wenn sie an den Spiegeln vorbeischreitet, sieht sie darin, herrlich gekleidet und vom eigenen Triumph beschwingt, eine junge hübsche Frau, sorglos und glücklich, so schön wie die schönsten am Hofe und somit auch – sie verwechselt ja diesen Hof mit der Welt – die schönste auf Erden. Wie mit einem kindischen Herzen, wie mit einer mittleren Kraft sich wehren gegen einen so betäubenden Rauschtrunk des Glücks, der aus allen scharfen und süßen Essenzen des Gefühls gemischt ist, aus dem Aufblick der Männer, dem bewundernden Neid der Frauen, der Hingabe des Volkes, aus dem eigenen Stolz? Wie nicht leichtsinnig werden, da alles so leicht ist? Da das Geld herschwebt auf immer neuen papiernen Zetteln und ein Wort, das eine Wort »payez«, flüchtig auf ein Blatt geschrieben, Dukaten tausendweise herrollt und kostbare Steine, Gärten und Schlösser hervorzaubert? Da die linde Luft des Glückes so süß und locker alle Nerven entspannt? Wie nicht sorglos und leichtherzig werden, wenn sich solche Schwingen vom Himmel her an die jungen leuchtenden Schultern heften? Wie nicht den Boden verlieren unter den Füßen, wenn einen solche Verführung entführt?
Diese Leichtfertigkeit der Lebensauffassung, von dem Aspekt der Geschichte aus gesehen zweifellos ihre Schuld, war zugleich Schuld ihrer ganzen Generation: gerade durch ihr völliges Eingehen auf den Geist ihrer Zeit ist Marie Antoinette die typische Vertreterin des Dix-huitième geworden. Das Rokoko, diese überzüchtete und zarteste Blüte uralter Kultur, das Jahrhundert der feinen und müßigen Hände, des verspielten und verzärtelten Geistes, wollte, ehe es unterging, sich darstellen in einer Gestalt. Kein König, kein Mann hätte nun dies Jahrhundert der Dame im Bilderbuch der Geschichte repräsentieren können, – nur in der Figur einer Frau, einer Königin konnte es sich sinnlich abbilden, und diese Königin des Rokoko ist Marie Antoinette vorbildlich gewesen. Von den Sorglosen die sorgloseste, von den Verschwendern die verschwenderischste, unter den galanten und koketten Frauen die zierlich galanteste, die bewußt koketteste, hat sie die Sitten und die künstlerische Lebensform des Dix-huitième in ihrer eigenen Person geradezu dokumentarisch deutlich und unvergeßlich zum Ausdruck gebracht. »Es ist unmöglich,« sagt Madame de Staël von ihr, »mehr Grazie und Güte in die Höflichkeit zu legen. Sie besitzt eine gewisse Art der Umgänglichkeit, die ihr nie erlaubt zu vergessen, daß sie Königin ist, und immer so tut, als ob sie es vergäße.« Marie Antoinette spielte mit ihrem Leben wie auf einem sehr zarten und zerbrechlichen Instrument. Statt menschlich groß für alle Zeiten wurde sie so charakteristisch für ihre Zeit; und während sie ihre innere Kraft sinnlos versäumte, hat sie doch einen Sinn erfüllt: in ihr vollendet sich das Dix-huitième, mit ihr geht es zu Ende.
Was ist die erste Sorge einer Rokokokönigin, wenn sie morgens in ihrem Schloß von Versailles erwacht? Die Berichte aus der Stadt, aus dem Staat? Die Briefe der Gesandten, ob die Armeen gesiegt haben, ob man den Krieg an England erklärt? Keineswegs. Marie Antoinette ist wie gewöhnlich erst um vier oder um fünf Uhr morgens heimgekehrt –, sie hat nur wenige Stunden geschlafen, ihre Unruhe braucht nicht viel Ruhe; mit wichtiger Zeremonie beginnt jetzt der Tag. Die Oberzofe, der die Garderobe untersteht, tritt mit einigen Hemden, Taschentüchern und Handtüchern zur Morgentoilette ein, ihr zur Seite die erste Kammerfrau. Diese verbeugt sich und reicht einen Folianten zur Ansicht, in dem mit Stecknadeln kleine Stoffmuster aller in der Garderobe vorhandenen Toiletten eingeheftet sind. Marie Antoinette hat sich zu entscheiden, welche Roben sie heute anzuziehen wünscht: welche schwierige, verantwortungsreiche Wahl, denn für jede Saison sind zwölf neue Staatskleider, zwölf Phantasiekleider, zwölf Zeremonieenkleider vorgeschrieben, die hundert andern gar nicht zu zählen, die alljährlich neu angeschafft werden (man erdenke die Schmach, eine Königin der Mode würde etwa dieselben Roben mehrmals tragen)! Dazu die Morgenröcke, die Leibchen, die Spitzentücher und Fichus, die Hauben, Mäntel, Gürtel, Handschuhe, Strümpfe und Unterkleider aus dem unsichtbaren Arsenal, das ein Heer von Schneiderinnen und Garderobefrauen beschäftigt. Die Wahl dauert gewöhnlich lange: schließlich werden mit Stecknadeln die Proben der Toiletten bezeichnet, welche Marie Antoinette für heute wünscht, das Staatskleid für den Empfang, das Deshabillé für den Nachmittag, das große Kleid für den Abend. Die erste Sorge ist erledigt, und das Buch mit den Stoffproben wird hinaus-, die gewählten Roben werden im Original hereingebracht.
Kein Wunder, daß bei solcher Wichtigkeit der Toilette die oberste Modistin, die göttliche Mademoiselle Bertin, mehr Macht über Marie Antoinette bekommt als alle Staatsminister, diese doch dutzendweise ersetzbar, jene einzig und unvergleichlich. Von Herkunft zwar nur eine gewöhnliche Putzmacherin aus der untersten Volksklasse, derb, selbstbewußt, ellbogenkräftig und eher ordinär als von feinen Manieren, hält diese Meisterin der haute couture die Königin vollkommen in ihrem Bann. Um ihretwillen wird achtzehn Jahre vor der eigentlichen Revolution eine Palastrevolution in Versailles angezettelt: Mademoiselle Bertin sprengt die Vorschrift der Etikette, die einer Bürgerlichen den Eintritt in die petits cabinets der Königin versagt; diese Künstlerin in ihrem Fach erreicht, was Voltaire und allen Dichtern und Malern der Zeit nie gelang: von der Königin allein empfangen zu werden. Wenn sie zweimal in der Woche mit ihren neuen Dessins erscheint, verläßt Marie Antoinette ihre adeligen Hofdamen und begibt sich zu geheimer Beratung mit der verehrten Künstlerin in verschlossene Privatgemächer, um mit ihr eine neue, noch närrischere Mode als die gestrige loszulassen. Selbstverständlich münzt die geschäftstüchtige Modistin einen solchen Triumph weidlich für ihre Kasse aus. Nachdem sie Marie Antoinette selbst zu dem kostspieligsten Aufwand verleitet, brandschatzt sie den ganzen Hof und Adel: mit Riesenlettern läßt sie über ihrem Geschäft in der Rue Saint-Honoré ihren Titel als Hoflieferantin der Königin anbringen und erklärt hochfahrend nachlässig ihren Kunden, die sie warten läßt: »Ich habe eben mit Ihrer Majestät zusammen gearbeitet.« Bald steht ihr ein ganzes Regiment von Schneiderinnen und Stickerinnen zu Diensten, denn je eleganter sich die Königin trägt, um so ungestümer bemühen sich die andern Damen, nicht zurückzustehen. Manche bestechen mit schweren Goldstücken die ungetreue Zauberin, ihnen ein Modell zu schneidern, das die Königin selbst noch nicht getragen hat: wie eine Krankheit greift der Toilettenluxus um sich. Die Unruhen im Lande, die Auseinandersetzungen mit dem Parlament, der Krieg mit England erregen bei weitem nicht so sehr diese eitle Hofgesellschaft wie das neue Flohbraun, das Mademoiselle Bertin in Mode bringt, oder eine besonders kühn geschweifte Turnüre des Reifrockes oder eine in Lyon zum erstenmal erzeugte Seidennuance. Jede Dame, die auf sich hält, fühlt sich verpflichtet, den Affentanz der Übertreibungen Schritt für Schritt mitzumachen, und seufzend klagt ein Gatte: »Niemals haben die Frauen in Frankreich so viel Geld ausgegeben, um sich lächerlich zu machen.«
Aber in dieser Sphäre die Königin zu sein, empfindet Marie Antoinette als ihre ureigene Pflicht. Nach einem Vierteljahr Regierung ist die kleine Prinzessin schon zur Modepuppe der eleganten Welt aufgestiegen, zum Modell aller Kostüme und Frisuren; durch alle Salons, durch alle Höfe rauscht ihr Triumph. Freilich auch bis nach Wien, und von dort kommt unfrohes Echo. Maria Theresia, die für ihr Kind würdigere Aufgaben wollte, schickt dem Botschafter ärgerlich ein Bild zurück, das ihr die Tochter modisch aufgeputzt und in übertriebenem Prunke zeigt, es sei das Bild einer Schauspielerin und nicht einer Königin von Frankreich. Ärgerlich mahnt sie die Tochter, freilich wie immer vergeblich: »Du weißt, daß ich stets der Meinung war, man müsse die Moden maßvoll befolgen, aber sie niemals übertreiben. Eine junge hübsche Frau, eine Königin voll Anmut hat allen diesen Unsinn nicht nötig, im Gegenteil, Einfachheit der Kleidung steht ihr besser an und ist dem Rang einer Königin würdiger. Da sie den Ton angibt, wird sich die ganze Welt bemühen, ihr selbst auf ihren kleinen Fehltritten zu folgen. Aber ich, die ich meine kleine Königin liebe und sie Schritt für Schritt beobachte, darf nicht zögern, sie auf diese kleine Leichtfertigkeit aufmerksam zu machen.«
Zweite Sorge jedes Morgens: die Frisur. Glücklicherweise ist auch hier ein hoher Künstler zur Stelle, Herr Léonard, der unerschöpfliche und unübertreffliche Figaro des Rokoko. Als großer Herr fährt er sechsspännig jeden Morgen von Paris nach Versailles, um mit Kamm, Haarwässern und Salben seine edle und täglich neue Kunst an der Königin zu erproben. Wie Mansart, der große Architekt, auf die Häuser die nach ihm benannten kunstvollen Dächer, so baut Herr Léonard über der Stirn jeder Frau von Rang, die auf sich hält, ganze Türme von Haaren auf und modelliert das hochgesträubte Gebilde zu symbolischen Ornamenten. Mit riesigen Haarnadeln und kräftiger Verwendung von starrer Pomade werden zunächst die Haare von der Wurzel her über der Stirn kerzengerade aufgebäumt, etwa doppelt so hoch wie eine preußische Grenadiermütze, dann erst im luftigen Raum, einen halben Meter über der Augenhöhe beginnt das eigentliche plastische Reich des Künstlers. Nicht nur ganze Landschaften und Panoramen mit Früchten, Gärten, Häusern und Schiffen, mit bewegtem Meer, eine farbige Allerweltsschau wird auf diesen »Poufs« oder »Quäsacos« (so heißen sie nach einem Pamphlet von Beaumarchais) mit dem Kamm modelliert, sondern um die Mode recht abwechslungsreich zu machen, bilden diese Plastiken jederzeit das Geschehnis des Tages symbolisch nach. Alles, was diese Kolibrigehirne beschäftigt, was diese meist hohlen Frauenköpfe füllt, muß auf dem Kopfe affichiert werden. Erregt die Oper Glucks Aufsehen, sofort erfindet Léonard eine Coiffure à la Iphigénie mit schwarzen Trauerbändern und dem Halbmond der Diana. Wird der König gegen die Pocken geimpft, prompt erscheint dieses aufregende Tagesereignis als »Poufs de l'inoculation«. Kommt der amerikanische Aufstand in die Mode, gleich wird die Freiheitscoiffure die Siegerin des Tages, aber noch niederträchtiger und dümmer: als die Bäckerläden von Paris während der Hungersnot geplündert werden, weiß diese frivole Hofgesellschaft nichts Wichtigeres, als das Ereignis in den »Bonnets de la révolte« zur Schau zu tragen. Diese Kunstbauten über leeren Köpfen übersteigern sich immer toller. Allmählich werden die Haartürme, dank massigerer Unterlagen und künstlicher Strähnen so hoch, daß die Damen damit nicht mehr in ihren Karossen sitzen können, sondern mit aufgehobenen Röcken knieen müssen, sonst würde das kostbare Haargebäude an die Wagendecke stoßen; die Türrahmen im Schloß werden höher geschnitten, damit die Damen in großer Toilette sich nicht immer beim Durchschreiten zu bücken brauchen, die Decken in den Theaterlogen werden aufgewölbt. Welche besonderen Peinlichkeiten diese überirdischen Schöpfe gar den Liebhabern dieser Damen bereiten, darüber findet man mancherlei Ergötzliches in den zeitgenössischen Satiren. Aber wenn es eine Mode gilt, sind Frauen bekanntlich zu jedem Opfer bereit, und die Königin ihrerseits bildet sich offenbar ein, nicht wirklich die Königin zu sein, wenn sie nicht alle diese Tollheiten anführte oder überböte.
Und wieder grollt das Echo aus Wien: »Ich kann nicht umhin, einen Punkt zu berühren, den ich in den Zeitungen so oft wiederholt finde, nämlich Deine Frisuren! Man sagt, daß sie von der Wurzel des Haares sechsunddreißig Zoll hoch sind und darüber noch Federn und Bänder haben.« Ausflüchtend antwortet die Tochter der chère Maman, hier in Versailles seien die Augen schon so sehr daran gewöhnt, daß die ganze Welt – mit Welt meint Marie Antoinette immer nur die hundert Edeldamen des Hofes – nichts Auffälliges daran fände. Und Meister Léonard baut munter weiter und weiter, bis es dem allmächtigen Herrn beliebt, der Mode Einhalt zu gebieten, und im nächsten Jahr werden die Türme abgetragen, freilich nur um einer noch kostspieligeren Mode, jener der Straußfedern, Platz zu machen.
Dritte Sorge: Kann man immer andersartig angezogen sein, ohne den entsprechenden Schmuck? Nein, eine Königin braucht größere Diamanten, dickere Perlen als alle andern. Sie braucht mehr Ringe und Reifen und Armbänder und Diademe und Haarketten und Edelsteine, mehr Schuhspangen oder Diamanteinfassungen für die von Fragonard gemalten Fächer als die Frauen der jüngeren Brüder des Königs, als alle andern Damen des Hofes. Zwar hat sie schon von Wien reichlich Diamanten mitbekommen und von Ludwig XV. zur Hochzeit eine ganze Kassette mit Familienschmuck. Aber wozu wäre man Königin, wenn nicht, um immer neue, schönere und kostbarere Steine zu kaufen? Marie Antoinette, jeder weiß dies in Versailles – und es wird sich bald zeigen, daß es nicht gut tut, wenn jeder davon redet und raunt, – ist vernarrt in Schmuck. Nie kann sie widerstehen, wenn diese geschickten und geschmeidigen Juweliere, diese aus Deutschland zugewanderten Juden Böhmer und Bassenge ihr auf samtenen Platten ihre neuesten Kunstwerke zeigen, zauberhafte Ohr- und Fingerringe und Schließen. Außerdem machen diese braven Männer ihr den Kauf niemals schwer. Sie wissen eine Königin von Frankreich zu ehren, indem sie ihr zwar doppelte Preise anrechnen, aber Kredit gewähren und ihr allenfalls die alten Diamanten zur Hälfte des Wertes in Abzug bringen; ohne das Herabwürdigende solcher Wuchergeschäfte zu bemerken, macht Marie Antoinette nach allen Seiten hin Schulden – im Notfall, sie weiß es, springt der sparsame Gatte ein.
Jetzt aber kommt schon härter die Mahnung aus Wien: »Alle Nachrichten aus Paris stimmen darin überein, daß Du abermals Dir Braceletts für zweihundertfünfzigtausend Livres gekauft und damit Deine Einkünfte in Unordnung und Dich in Schulden gebracht hast und daß Du sogar, um dem zu steuern, um einen geringen Preis Deine Diamanten verkaufst ... Solche Mitteilungen zerreißen mein Herz, insbesondere wenn ich an die Zukunft denke. Wann wirst Du Du selbst werden?« ruft ihr die Mutter verzweifelt zu. »Eine Herrscherin erniedrigt sich, wenn sie sich so herausputzt, und sie erniedrigt sich noch mehr, wenn sie gerade in einer solchen Zeit es bis zu solchen Ausgaben treibt. Ich kenne nur zu sehr diesen Geist der Verschwendung und kann nicht darüber schweigen, weil ich Dich um Deinetwillen liebe und nicht um Dir zu schmeicheln. Gib acht, nicht durch solche Frivolitäten das Ansehen zu verlieren, das Du im Anfang der Regierung gewonnen hast. Man weiß allgemein, daß der König sehr bescheiden ist, so fiele alle Schuld einzig auf Dich. Eine solche Veränderung, einen solchen Umsturz wünsche ich nicht zu erleben.«
Diamanten kosten Geld, Toiletten kosten Geld, und obwohl gleich nach dem Regierungsantritt der gutmütige Gatte seiner Frau die Apanage verdoppelt hat, diese reich gefüllte Schatulle muß doch irgendein Loch haben, denn immer herrscht dort erschreckende Ebbe.
Wie also Geld beschaffen? Für die Leichtsinnigen hat glücklicherweise der Teufel ein Paradies erfunden: das Spiel. Vor Marie Antoinette galt das Spiel am Königshofe noch als unschuldige Abendunterhaltung etwa wie Billard oder Tanz: man spielte das ungefährliche Lansquenet mit kleinen Einsätzen. Marie Antoinette entdeckt sich und den andern das berüchtigte Pharao, das wir von Casanova als das erlesene Jagdfeld aller Gauner und Schwindler kennen. Daß ein ausdrücklich erneuter Befehl des Königs jedes Hasard unter Strafe gesetzt hat, ist ihren Kumpanen gleichgültig: zu den Salons der Königin hat die Polizei keinen Zutritt. Und daß er selbst diese mit Gold beschwerten Spieltische nicht dulden will, kümmert diese frivole Bande keinen Pfifferling: man spielt eben hinter seinem Rücken weiter, und die Türsteher haben Auftrag, falls der König kommt, sofort Alarm zu geben. Dann verschwinden wie weggezaubert die Karten unter dem Tisch, es wird nur noch geplaudert, alles lacht über den braven Biedermann, und die Partie geht weiter. Zur Belebung des Geschäfts und zur Steigerung des Umsatzes gewährt die Königin jedem Beliebigen, der Geld in die Bude bringt, Zutritt zu ihrem grünen Tisch; Schlepper und Schieber drängen sich heran, es dauert nicht lange, und man spricht in der Stadt die Schande herum, daß in der Gesellschaft der Königin falsch gespielt werde. Nur eine weiß nichts davon, weil sie, in ihrem Vergnügen verblendet, nichts wissen will, Marie Antoinette. Wo sie einmal in Schwung und Feuer ist, kann niemand sie halten, sie spielt Tag für Tag bis drei, bis vier, bis fünf Uhr morgens, einmal sogar zum Skandal des Hofs die ganze Nacht vor Allerheiligen durch.
Und wieder das Echo aus Wien: »Das Spiel ist zweifellos eine der allergefährlichsten Vergnügungen, denn es zieht schlechte Gesellschaft und üble Rede heran ... Es fesselt zu sehr durch die Leidenschaft, zu gewinnen, und wenn man richtig rechnet, ist man dabei doch der Genarrte, denn auf die Dauer kann man, wenn man anständig spielt, nicht gewinnen. So bitte ich Dich, meine geliebte Tochter: keine Nachgiebigkeit, man muß sich mit einem Ruck von einer solchen Leidenschaft losreißen.«
Aber Kleider, Putz und Spiel, das beschäftigt nur den halben Tag, die halbe Nacht. Eine andere Sorge macht mit dem Uhrzeiger den doppelten Stundenkreis: Wie amüsiert man sich? Man reitet aus, man jagt, uraltes fürstliches Vergnügen: allerdings begleitet man dabei, er ist ja so sterbenslangweilig, selten den eigenen Gatten, sondern wählt lieber den muntern Schwager d'Artois und andere Kavaliere. Manchmal reitet man auch zum Spaß auf Eseln, das ist zwar nicht so vornehm, aber man kann, wenn ein solcher grauer Bursche bockt, auf die bezauberndste Weise herunterfallen und dem Hof die Spitzendessous und wohlgeformten Beine einer Königin zeigen. Im Winter fährt man, warm eingepackt, im Schlitten spazieren, im Sommer belustigt man sich abends an Feuerwerken und ländlichen Bällen, an kleinen Nachtkonzerten im Park. Ein paar Schritte von der Terrasse hinab, und man ist mit seiner auserlesenen Gesellschaft ganz vom Dunkel geschützt und kann dort munter plaudern und spaßen – in allen Ehren natürlich, aber doch spielen mit der Gefahr wie mit allen andern Dingen des Lebens. Daß dann irgendein boshafter Höfling eine Broschüre in Versen schreibt über die nächtlichen Abenteuer einer Königin »Le lever de l'aurore«: was hat das weiter auf sich? – der König, der nachsichtige Gatte, gerät durch derlei Nadelstiche nicht in Harnisch, und man hat sich gut unterhalten. Nur nicht allein sein, nur keinen Abend zu Hause, mit einem Buch, mit dem eigenen Mann, nur immer munteres Treiben und Getriebensein. Wo eine neue Mode in Schwung kommt, ist Marie Antoinette die erste, ihr zu huldigen; kaum bringt der Graf von Artois – seine einzige Leistung für Frankreich – die Pferderennen von England herüber, schon sieht man die Königin auf der Tribüne, von Dutzenden junger anglomaner Gecken umringt, wettend, spielend und von dieser neuartigen Nervenspannung leidenschaftlich erregt. Gewöhnlich hält allerdings dieses Strohfeuer ihrer Begeisterungen nicht lange an, meist langweilt sie schon morgen, was sie gestern noch entzückte; nur steter Wechsel im Vergnügen kann ihre nervöse Unrast, die, es ist kein Zweifel, durch jenes Geheimnis des Alkovens begründet ist, überspielen. Die liebsten unter hundert wechselnden Unterhaltungen, die einzigen, in die sie dauernd vernarrt bleibt, sind allerdings auch die für ihren Ruf gefährlichsten: die Maskenredouten. Sie werden Marie Antoinettes dauernde Leidenschaft, denn da kann sie doppelt genießen, die Lust, Königin zu sein, und die zweite, dank der dunklen Samtmaske nicht mehr als Königin erkennbar, sich bis an den Rand zärtlicher Abenteuer zu wagen, nicht also nur wie am Spieltisch bloß Geld einzusetzen, sondern sich selber als Frau. Verkleidet als Artemis oder in kokettem Domino, kann man von der eiskalten Höhe der Etikette hinabsteigen in das fremde, warme Menschengewühl, den Atem der Zärtlichkeit, die Nähe der Verführung, das Schon-halb-Hinabgleiten in die Gefahr bis ins Mark schauernd spüren, man kann sich einen eleganten jungen, einen englischen Gentleman unter dem Schutz der Larve für eine halbe Stunde an den Arm nehmen oder dem bezaubernden schwedischen Kavalier, Hans Axel von Fersen, durch ein paar kühne Worte zeigen, wie sehr er der Frau gefällt, die leider, ach leider, als Königin zur Tugend gewaltsam gezwungen ist. Daß dann diese kleinen Späße, vom Gerede in Versailles sofort grob erotisiert, sich in allen Salons herumsprechen, daß, als einmal ein Rad der Hofkarosse unterwegs bricht und Marie Antoinette für zwanzig Schritte einen Mietfiaker nimmt, um zum Opernhaus zu fahren, die Berichte in den geheimen Journalen diese Torheiten zu frivolen Abenteuern umlügen, das weiß Marie Antoinette nicht, oder sie will es nicht wissen. Vergebens mahnt die Mutter: »Wäre es noch in der Gesellschaft des Königs, so würde ich schweigen, aber immer ohne ihn und immer mit dem schlechtesten und jüngsten Volk von Paris, und dabei die bezaubernde Königin die Älteste unter der ganzen Bande. Die Zeitungen, die Blätter, die früher mir Wohltat bedeuteten, weil sie die Großmut und Herzensgüte meiner Tochter rühmten, sind mit einmal verwandelt. Man hört nichts als von Pferderennen, Hasardspielen und durchwachten Nächten, so daß ich sie gar nicht mehr sehen will; aber dennoch, ich kann nichts daran ändern, daß alle Welt, die meine Liebe und Zärtlichkeit zu meinen Kindern kennt, davon spricht und erzählt. Oft vermeide ich sogar in Gesellschaft zu gehen, damit ich nichts davon höre.«
Aber alle Vorstellungen haben keine Gewalt über die Unverständige, die schon so weit ist, nicht mehr zu verstehen, daß man sie nicht versteht. Warum denn nicht das Leben genießen, es hat doch keinen andern Sinn. Und mit erschütternder Offenheit antwortet sie auf die mütterlichen Mahnungen dem Botschafter Mercy: »Was will sie? Ich habe Angst, mich zu langweilen.«
»Ich habe Angst, mich zu langweilen«: mit diesem Wort hat Marie Antoinette das Stichwort der Zeit und ihrer ganzen Gesellschaft ausgesprochen. Das achtzehnte Jahrhundert ist an seinem Ende, es hat seinen Sinn erfüllt. Das Reich ist gegründet, Versailles ist erbaut, die Etikette vollendet, nun hat der Hof eigentlich nichts mehr zu tun; die Marschälle sind, da kein Krieg ist, bloße Haubenstöcke in Uniformen geworden, die Bischöfe, da dieses Geschlecht nicht mehr an Gott glaubt, galante Herren in violetten Soutanen, die Königin, da sie keinen wahren König zur Seite und keinen Thronfolger zu erziehen hat, eine muntere Mondäne. Gelangweilt und verständnislos stehen sie alle vor der mächtig anströmenden Zeit; mit neugierigen Händen greifen sie manchmal hinein, sich ein paar glitzernde Steinchen zu holen; lachend wie die Kinder spielen sie, weil es ihnen so leicht um die Finger sprüht, mit dem ungeheuren Element. Aber keiner spürt das rasche und raschere Steigen der Flut; und als sie endlich der Gefahr gewahr werden, ist die Flucht schon vergebens, das Spiel bereits verloren, das Leben vertan.