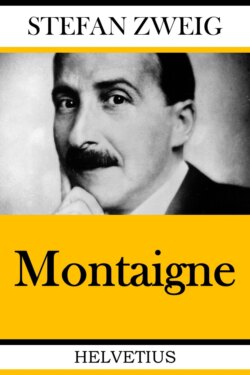Читать книгу Montaigne - Stefan Zweig - Страница 2
1. Kapitel
ОглавлениеEs gibt einige wenige Schriftsteller, die jedem aufgetan sind in jedem Alter und in jeder Epoche des Lebens – Homer, Shakespeare, Goethe, Balzac, Tolstoi – und dann wieder andere, die sich erst zu bestimmter Stunde in ihrer ganzen Bedeutung erschließen. Zu ihnen gehört Montaigne. Man darf nicht allzu jung, nicht ohne Erfahrungen und Enttäuschungen sein, um ihn richtig würdigen zu können, und am hilfreichsten wird sein freies und unbeirrbares Denken einer Generation, die, wie etwa die unsere, vom Schicksal in einen kataraktischen Aufruhr der Welt geworfen wurde. Nur wer in der eigenen erschütterten Seele eine Zeit durchleben muß, die mit Krieg, Gewalt und tyrannischen Ideologien dem Einzelnen das Leben und innerhalb seines Lebens wieder die kostbarste Substanz, die individuelle Freiheit, bedroht, nur der weiß, wieviel Mut, wieviel Ehrlichkeit und Entschlossenheit vonnöten sind, in solchen Zeiten der Herdentollheit seinem innersten Ich treu zu bleiben. Nur er weiß, daß keine Sache auf Erden schwerer und problematischer wird als innerhalb einer Massenkatastrophe sich seine geistige und moralische Unabhängigkeit unbefleckt zu bewahren. Erst wenn man selbst an der Vernunft, an der Würde der Menschheit gezweifelt und verzweifelt hat, vermag man es als Tat zu rühmen, wenn ein Einzelner inmitten eines Weltchaos sich vorbildlich aufrecht erhält.
Daß man Montaignes Weisheit und Größe erst als Erfahrener, als Geprüfter zu würdigen vermag, habe ich an mir selber erfahren. Als ich das erste Mal mit zwanzig Jahren seine »Essais«, dies einzige Buch, in dem er sich uns hinterlassen hat, zur Hand nahm, wußte ich – ehrlich gesagt – nicht viel damit anzufangen. Ich besaß zwar genug literarischen Kunstverstand, um respektvoll zu erkennen, daß sich hier eine interessante Persönlichkeit kundtat, ein besonders hellsichtiger und weitsichtiger, ein liebenswerter Mensch und überdies noch ein Künstler, der jedem Satz und jedem Diktum individuelle Prägung zu geben wußte. Aber meine Freude blieb eine literarische, eine antiquarische Freude; es fehlte die innere Zündung der leidenschaftlichen Begeisterung, das elektrische Überspringen von Seele zu Seele. Schon die Thematik der »Essais« schien mir ziemlich abwegig und zum größten Teil ohne Überschaltungsmöglichkeit in meine eigene Seele. Was gingen mich jungen Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts die weiträumigen Exkurse des Sieur de Montaigne über die »Cérémonie de l'entrevue des rois« oder seine »Considérations sur Cicero« an? Wie schulmäßig und unzeitgemäß dünkte mich das schon stark von der Zeit angebräunte Französisch, das obendrein mit lateinischen Zitaten gespickt war. Und selbst zu seiner milden, temperierten Weisheit fand ich keine Beziehung. Sie kam zu früh. Denn was sollte das kluge Abmahnen Montaignes, man solle sich nicht ehrgeizig mühen, sich nicht allzu leidenschaftlich in die äußere Welt verstricken? Was konnte sein beschwichtigendes Drängen zu Temperiertheit und Toleranz einem ungestümen Alter bedeuten, das nicht desillusioniert werden will und nicht beruhigt, sondern unbewußt nur verstärkt sein mochte in seinem vitalen Auftrieb? Es liegt im Wesen der Jugend, daß sie nicht zu Milde, zur Skepsis beraten zu sein wünscht. Jeder Zweifel wird ihr zur Hemmung, weil sie Gläubigkeit und Ideale braucht zur Auslösung ihrer inneren Stoßkraft. Und selbst der radikalste, der absurdeste Wahn wird ihr, sofern er sie nur befeuert, wichtiger sein als die erhabenste Weisheit, die ihre Willenskraft schwächt.
Und dann – jene individuelle Freiheit, deren entschlossenster Herold für alle Zeiten Montaigne geworden ist, schien sie uns wirklich um 1900 noch derart hartnäckiger Verteidigung zu bedürfen? War das alles denn nicht schon längst Selbstverständlichkeit geworden, durch Gesetz und Sitte garantierter Besitz einer längst von Diktatur und Knechtschaft emanzipierten Menschheit? Selbstverständlich uns gehörig, wie der Atem unseres Mundes, der Pulsschlag unseres Herzens, schien uns das Recht auf das eigene Leben, die eigenen Gedanken und ihre ungehemmte Aussage in Wort und Schrift. Offen lag uns die Welt, Land um Land, wir waren nicht Gefangene des Staates, nicht geknechtet in Kriegsdienst, nicht Untertan der Willkür tyrannischer Ideologien. Niemand war in Gefahr, geächtet, verbannt, eingekerkert und vertrieben zu werden. So schien Montaigne unserer Generation sinnlos an Ketten zu rütteln, die wir längst zerbrochen meinten, ahnungslos, daß sie vom Schicksal uns schon neu geschmiedet wurden, härter und grausamer als je. So ehrten und respektierten wir seinen Kampf um die Freiheit der Seele als einen historischen, der für uns längst überflüssig und ohne Belang war. Denn es gehört zu den geheimnisvollen Gesetzen des Lebens, daß wir seiner wahren und wesentlichen Werte immer erst zu spät gewahr werden: der Jugend, wenn sie entschwindet, der Gesundheit, sobald sie uns verläßt, und der Freiheit, dieser kostbarsten Essenz unserer Seele, erst im Augenblick, da sie uns genommen werden soll oder schon genommen worden ist.
Es mußte also, um Montaignes Lebenskunst und Lebensweisheit zu verstehen, um die Notwendigkeit seines Kampfes um das »soi-même« als die notwendigste Auseinandersetzung unserer geistigen Welt zu begreifen, eine Situation kommen, die der seines eigenen Lebens ähnlich war. Auch wir mußten, wie er, erst einen jener entsetzlichen Rückfälle der Welt aus einem der herrlichsten Aufstiege erleben. Auch wir mußten aus unseren Hoffnungen, Erfahrungen, Erwartungen und Begeisterungen mit der Peitsche zurückgejagt werden bis auf jenen Punkt, wo man schließlich nurmehr sein nacktes Ich, seine einmalige und unwiederbringliche Existenz verteidigt. Erst in dieser Bruderschaft des Schicksals ist mir Montaigne der unentbehrliche Helfer, Tröster und Freund geworden, denn wie verzweifelt ähnlich ist sein Schicksal dem unseren! Als Michel de Montaigne ins Leben tritt, beginnt eine große Hoffnung zu erlöschen, eine gleiche Hoffnung, wie wir sie selbst zu Anfang unseres Jahrhunderts erlebt haben: die Hoffnung auf eine Humanisierung der Welt. Im Verlauf eines einzigen Lebensalters hatte die Renaissance der beglückten Menschheit mit ihren Künstlern, ihren Malern, ihren Dichtern, ihren Gelehrten eine neue, in gleicher Vollkommenheit nie erhoffte Schönheit geschenkt. Ein Jahrhundert – nein, Jahrhunderte schienen anzubrechen, wo die schöpferische Kraft das dunkle und chaotische Dasein Stufe um Stufe, Welle um Welle dem Göttlichen entgegentrug. Mit einem Male war die Welt weit, voll und reich geworden. Aus dem Altertum brachten die Gelehrten mit der lateinischen, der griechischen Sprache die Weisheit Platos und Aristoteles' wieder den Menschen zurück. Der Humanismus unter Erasmus' Führung versprach eine einheitliche, eine kosmopolitische Kultur; die Reformation schien eine neue Freiheit des Glaubens neben der neuen Weite des Wissens zu begründen. Der Raum und die Grenzen zwischen den Völkern zerbrachen, denn die eben entdeckte Druckerpresse gab jedem Wort, jeder Meinung die Möglichkeiten beschwingter Verbreitung; was einem Volke geschenkt war, schien allen gehörig, man glaubte, daß durch den Geist eine Einheit geschaffen sei über dem blutigen Zwist der Könige, der Fürsten und der Waffen. Und abermaliges Wunder: zugleich mit der geistigen weitete sich die irdische Welt ins Ungeahnte. Aus dem bisher weglosen Ozean tauchten neue Küsten, neue Länder auf, ein riesiger Kontinent verbürgte eine Heimstatt für Generationen und Generationen. Rascher pulsierte der Blutkreislauf des Handels, Reichtum durchströmte die alte europäische Erde und schuf Luxus, und der Luxus wiederum Bauten, Bilder und Statuen – eine verschönte, eine vergeistigte Welt. Immer aber, wenn der Raum sich erweitert, spannt sich die Seele. Wie in unserer eigenen Jahrhundertwende, da abermals der Raum sich großartig dehnte, dank der Eroberung des Äthers durch das Flugzeug und das unsichtbar die Länder überschwebende Wort, da Physik und Chemie, Technik und Wissenschaft Geheimnis auf Geheimnis der Natur entrangen und ihre Kräfte den Menschen dienstbar machten, beseelte unsagbare Hoffnung die schon so oft enttäuschte Menschheit, und aus tausend Seelen klang Antwort dem Jubelruf Ulrich von Huttens zurück: »Es ist eine Lust zu leben.«
Aber immer, wenn die Welle zu steil und zu rasch ansteigt, fällt sie um so kataraktischer zurück. Und so wie in unserer Zeit gerade die neuen Errungenschaften, die Wunder der Technik sich in die fürchterlichsten Faktoren der Zerstörung verwandeln, so verwandeln sich die Elemente der Renaissance und des Humanismus, die heilsam erschienen, in mörderisches Gift. Die Reformation, die Europa einen neuen Geist der Christlichkeit zu geben träumte, zeitigt die beispiellose Barbarei der Religionskriege, die Druckerpresse verbreitet statt Bildung den Furor Theologicus, statt des Humanismus triumphiert die Intoleranz. In ganz Europa zerfleischt sich jedes Land in mörderischem Bürgerkrieg, indes in der Neuen Welt sich die Bestialität der Konquistadoren mit einer unüberbietbaren Grausamkeit austobt. Das Zeitalter eines Raffael und Michelangelo, eines Leonardo da Vinci, Dürer und Erasmus fällt zurück in die Untaten eines Attila, eines Dschingiskhan, eines Tamerlan.
Diesen grauenhaften Rückfall aus dem Humanismus in die Bestialität, einer dieser sporadischen Wahnsinnsausbrüche der Menschheit, wie wir ihn heute abermals erleben, völlig ohnmächtig mitansehen zu müssen, trotz unbeirrbarer geistiger Wachheit und mitfühlendster seelischer Erschütterung: das bedeutet die eigentliche Tragödie im Leben Montaignes. Er hat den Frieden, die Vernunft, die Konzilianz, alle diese hohen geistigen Kräfte, denen seine Seele verschworen war, nicht einen Augenblick seines Lebens in seinem Land, in seiner Welt wirksam gesehen. Beim ersten Blick in die Zeit, wie beim Abschiednehmen, wendet er sich – wie wir – voll Grauen ab von dem Pandämonium der Wut und des Hasses, das sein Vaterland, das die Menschheit schändet und verstört. Er ist ein halber Knabe, nicht älter als fünfzehn Jahre, als vor seinen Augen in Bordeaux der Volksaufstand gegen die »gabeile«, die Salzsteuer, mit einer Unmenschlichkeit niedergeschlagen wird, die ihn selbst zeitlebens zum rasenden Feind aller Grausamkeit macht. Der Knabe sieht, wie Menschen zu Hunderten vom Leben zu Tode gequält werden, gehängt, gepfählt, gevierteilt, enthauptet, verbrannt, er sieht die Raben noch tagelang um die Richtstatt flattern, um sich vom verbrannten und halb verfaulten Fleisch der Opfer zu nähren. Er hört die Schreie der Gepeinigten und muß den Geruch des verbrannten Fleisches riechen, der durch die Gassen schwelt. Und kaum da der Knabe erwachsen ist, beginnt der Bürgerkrieg, der mit seinen fanatischen Gegensätzen der Ideologien Frankreich so völlig verwüstet, wie heute die sozialen und nationalen Fanatismen die Welt von einem bis zum anderen Ende zerstören. Die »Chambre Ardente« läßt die Protestanten verbrennen, die Bartholomäusnacht rottet achttausend Menschen an einem Tage aus. Die Hugenotten wieder vergelten Verbrechen mit Verbrechen: sie stürmen die Kirchen, sie zerschmettern die Statuen, selbst den Toten läßt die Besessenheit keinen Frieden und die Gräber Richard Löwenherz' und Wilhelms des Eroberers werden aufgerissen und geplündert. Von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt ziehen die Truppen, bald die katholischen, bald die hugenottischen, aber immer Franzosen gegen Franzosen, Bürger gegen Bürger, und keine Partei der anderen nachgebend in ihrer überreizten Bestialität. Ganze gefangene Garnisonen werden niedergemacht vom ersten bis zum letzten Mann, die Flüsse verpestet durch die niederschwemmenden Leichen; auf 120 000 sind die Dörfer geschätzt, die vernichtet und geplündert werden, und bald löst das Morden sich los von seinem ideellen Vorwand. Bewaffnete Banden überfallen die Schlösser und die Reisenden, gleichgültig, ob Protestanten oder Katholiken. Ein Ritt durch einen nachbarlichen Wald vor dem Hause ist nicht weniger gefährlich als eine Fahrt ins neue Indien oder zu den Kannibalen. Niemand weiß mehr, ob sein Haus ihm gehört und seine Habe, ob er morgen noch leben wird oder tot sein, gefangen oder frei, und als alter Mann, am Ende seines Lebens, 1588, schreibt Montaigne: »In dieser Verwirrung, in der wir uns seit dreißig Jahren befinden, sieht sich jeder Franzose stündlich einer Lage gegenüber, die eine völlige Umkehrung seines Schicksals bedeuten kann.« Es gibt keine Sicherheit mehr auf Erden: dieses Grundgefühl wird sich in Montaignes geistiger Anschauung notwendigerweise widerspiegeln. Man muß daher suchen, solche Sicherheit außerhalb dieser Welt zu finden, abseits seines Vaterlandes; man muß sich weigern, mitzutoben im Chorder Besessenen, und jenseits der Zeit sein eigenes Vaterland, seine eigene Welt sich schaffen.
Wie die humanen Menschen in jener Zeit gefühlt – grauenhaft ähnlich unserem eigenen Empfinden –, bezeugt das Gedicht, das La Boétie 1560 an Montaigne, seinen siebenundzwanzigjährigen Freund, richtet und in dem er ihn anruft: »Was für ein Schicksal hat uns gerade in diesen Zeiten geboren sein lassen. Der Untergang meines Landes liegt vor meinen Augen, und ich sehe keinen anderen Weg als auszuwandern, mein Haus zu verlassen und zu gehen wohin immer mich das Schicksal trägt. Lange schon hat der Zorn der Götter mich gemahnt zu fliehen, indem er mir die weiten und offenen Länder jenseits des Ozeans wies. Wenn an der Schwelle unseres Jahrhunderts eine neue Welt aus den Wogen erstand, so war es, weil die Götter sie bestimmten als ein Refugium, wo die Menschen frei unter einem besseren Himmel ihr Feld bestellen sollten, indes das grausame Schwert und eine schmachvolle Plage Europa zum Untergang verdammt.«
In solchen Epochen, da die Edelwerte des Lebens, da unser Friede, unsere Selbständigkeit, unser eingeborenes Recht, alles, was unser Dasein reiner, schöner, berechtigter macht, aufgeopfert werden der Besessenheit eines Dutzends von Fanatikern und Ideologen, münden alle Probleme für den Menschen, der seine Menschlichkeit nicht an die Zeit verlieren will, in ein einziges: wie bleibe ich frei? Wie bewahre ich mir trotz aller Drohungen und Gefahren inmitten der Tollwut der Parteien die unbestechliche Klarheit des Geistes, wie die Humanität des Herzens unverstört inmitten der Bestialität? Wie entziehe ich mich den tyrannischen Forderungen, die Staat oder Kirche oder Politik mir wider meinen Willen aufzwingen wollen? Wie wehre ich mich dagegen, nicht weiter zu gehen in meinen Mitteilungen oder Handlungen, als mein innerstes Ich innerlich will? Wie schütze ich diese einzige, einmalige Parzelle meines Ichs gegen die Einstellung auf das Reglementierte und das von außen dekretierte Maß? Wie bewahre ich meine ureigenste Seele und ihre nur mir gehörige Materie, meinen Körper, meine Gesundheit, meine Gedanken, meine Gefühle vor der Gefahr, fremdem Wahn und fremden Interessen aufgeopfert zu werden?
An diese Frage, und an sie allein, hat Montaigne sein Leben und seine Kraft gewandt. Um dieser Freiheit willen hat er sich beobachtet, überwacht, geprüft und getadelt in jeder Bewegung und in jedem Gefühl. Und dies Suchen um die seelische Rettung, um die Rettung der Freiheit in einer Zeit der allgemeinen Servilität vor Ideologien und Parteien bringt ihn uns heute brüderlich nahe wie keinen anderen Künstler. Wenn wir ihn vor allen ehren und lieben, so geschieht es darum, weil er wie kein anderer sich der höchsten Kunst des Lebens hingegeben hat: »rester soi-même«.
Andere, ruhigere Zeiten haben die literarische, die moralische, die psychologische Nachlassenschaft Montaignes aus einem anderen Gesichtswinkel betrachtet; sie haben gelehrt darüber gestritten, ob er Skeptiker gewesen oder Christ, Epikuräer oder Stoiker, Philosoph oder Amüseur, Schriftsteller oder bloß genialer Dilettant. In Doktor-Dissertationen und Abhandlungen sind seine Anschauungen über Erziehung und Religion auf das sorglichste seziert worden. Mich aber berührt und beschäftigt an Montaigne heute nur dies: wie er in einer Zeit ähnlich der unsrigen sich innerlich freigemacht hat und wie wir, indem wir ihn lesen, uns an seinem Beispiel bestärken können. Ich sehe ihn als den Erzvater, Schutzpatron und Freund jedes »homme libre« auf Erden, als den besten Lehrer dieser neuen und doch ewigen Wissenschaft, sich selbst zu bewahren, gegen alle und alles. Wenige Menschen auf Erden haben ehrlicher und erbitterter darum gerungen, ihr innerstes Ich, ihre »essence« unvermischbar und unbeeinflußbar vom trüben und giftigen Schaum der Zeiterregung zu halten, und wenigen ist es gelungen, dieses innerste Ich vor ihrer Zeit zu retten für alle Zeiten.
Dieser Kampf Montaignes um die Wahrung der inneren Freiheit, der vielleicht bewußteste und zäheste, den je ein geistiger Mensch geführt, hat äußerlich nicht das geringste Pathetische oder Heroische an sich. Nur gezwungen könnte man Montaigne in die Reihe der Dichter und Denker einreihen, die mit ihrem Wort für die »Freiheit der Menschheit« gekämpft haben. Er hat nichts von den rollenden Tiraden und dem schönen Schwung eines Schiller oder Lord Byron, nichts von der Aggressivität eines Voltaire. Er hätte gelächelt über den Gedanken, etwas so Persönliches wie innere Freiheit auf andere Menschen und gar auf Massen übertragen zu wollen, und die professionellen Weltverbesserer, die Theoretiker und Überzeugungsverschleißer hat er aus dem innersten Grunde seiner Seele gehaßt. Er wußte zu gut, eine wie ungeheure Aufgabe schon dies allein bedeutet: in sich selbst innere Selbständigkeit zu bewahren. So beschränkt sich sein Kampf ausschließlich auf die Defensive, auf die Verteidigung jener innersten Schanze, die Goethe die »Zitadelle« nennt und zu der kein Mensch einem anderen Zutritt verstattet. Seine Taktik war, im Äußeren möglichst unauffällig und unscheinbar zu bleiben, mit einer Art Tarnkappe durch die Welt zu gehen, um den Weg zu sich selbst zu finden.
So hat Montaigne eigentlich nicht das, was man eine Biographie nennt. Er hat nie Anstoß erregt, weil er sich im Leben nicht vordrängte und für seine Gedanken nicht um Zuhörer und Jasager warb. Nach außen schien er ein Bürger, ein Beamter, ein Ehemann, ein Katholik, ein Mann, der unscheinbar das äußerlich Verlangte seiner Pflichten erfüllte. Er nahm für die Umwelt die Schutzfarbe der Unauffälligkeit an, um nach innen das Farbenspiel seiner Seele in allen Nuancen entfalten und betrachten zu können. Sich herzuleihen war er jederzeit bereit – sich herzugeben niemals. Immer behielt er in jeder Form seines Lebens das Beste, das Eigentliche seines Wesens zurück. Er ließ die andern reden und sich zu Rotten scharen, eifern, predigen und paradieren; er ließ die Welt ihre wirren und törichten Wege gehen und kümmerte sich nur um eines: vernünftig zu sein für sich selbst, menschlich in einer Zeit der Unmenschlichkeit, frei innerhalb des Massenwahnes. Er ließ jeden spotten, der ihn gleichgültig nannte, unentschieden und feige; er ließ die andern sich wundern, daß er sich nicht vordrängelte zu Ämtern und Würden. Selbst die Nächsten, die ihn kannten, ahnten nicht, mit welcher Ausdauer, Klugheit und Geschmeidigkeit er im Schatten der Öffentlichkeit an der einen Aufgabe arbeitete, die er sich gestellt hatte: statt eines bloßen Lebens sein eignes Leben zu leben.
Damit hat der scheinbar Tatenlose eine unvergleichliche Tat getan. Indem er sich selbst erhielt und beschrieb, hat er den Menschen in nuce in sich erhalten, den nackten und überzeitlichen Menschen. Und während alles andere, die theologischen Traktate und die philosophischen Exkurse seines Jahrhunderts uns fremd und verjährt anmuten, ist er unser Zeitgenosse, der Mann von heute und immer, ist sein Kampf der aktuellste auf Erden geblieben. Hundertmal, von Blatt zu Blatt, wenn man Montaigne aufschlägt, hat man das Gefühl: nostra res agitur, das Gefühl, hier ist besser, als ich selbst es sagen könnte, gedacht, was die innerste Sorge meiner Seele in dieser Zeit ist. Hier ist ein Du, in dem mein Ich sich spiegelt, hier ist die Distanz aufgehoben, die Zeit von Zeiten trennt. Nicht ein Buch ist mit mir, nicht Literatur, nicht Philosophie, sondern ein Mensch, dem ich Bruder bin, ein Mensch, der mich berät, der mich tröstet, ein Mensch, den ich verstehe und der mich versteht. Nehme ich die »Essais« zur Hand, so verschwindet im halbdunklen Raum das bedruckte Papier. Jemand atmet, jemand lebt mit mir, ein Fremder ist zu mir getreten und ist kein Fremder mehr, sondern jemand, den ich mir nahe fühle wie einen Freund. Vierhundert Jahre sind verweht wie Rauch: es ist nicht der Seigneur de Montaigne, der gentilhomme de la chambre eines verschollenen Königs von Frankreich, nicht der Schloßherr aus Périgord, der zu mir spricht; er hat die weiße gefältelte Schaube abgelegt, den Spitzhut, den Degen, er hat die stolze Kette mit dem Orden des St. Michel vom Halse genommen. Es ist nicht der Bürgermeister von Bordeaux, der bei mir zu Besuch ist, und nicht der Schriftsteller. Ein Freund ist gekommen, mich zu beraten und von sich zu erzählen. Manchmal ist in seiner Stimme eine leise Trauer über die Gebrechlichkeit unseres menschlichen Wesens, die Unzulänglichkeit unseres Verstandes, die Engstirnigkeit unserer Führer, den Widersinn und die Grausamkeit unserer Zeit, jene edle Trauer, die sein Schüler Shakespeare gerade den liebsten seiner Gestalten, einem Hamlet, Brutus oder Prospero so unvergeßlich mitgegeben hat. Aber dann spüre ich wieder sein Lächeln: warum nimmst du dies alles so schwer? Warum läßt du dich anfechten und niederbeugen von dem Unsinn und der Bestialität deiner Zeit? All das rührt doch nur an deine Haut, nicht an dein inneres Ich. Das Außen kann dir nichts nehmen und kann dich nicht verstören, solange du dich nicht selber verstören läßt. »L'homme d'entendement n'a rien à perdre.« Die zeitlichen Geschehnisse sind machtlos über dich, sofern du dich weigerst, an ihnen teilzunehmen, der Wahnsinn der Zeit ist keine wirkliche Not, solange du selbst deine Klarheit behältst. Und selbst die schlimmsten deiner Erlebnisse, die scheinbaren Erniedrigungen, die Schläge des Schicksals –, du fühlst sie nur, solange du schwach vor ihnen wirst, denn wer ist es als du selbst, der ihnen Wert und Schwere, der ihnen Lust und Schmerz zuteilt? Nichts kann dein Ich erheben und erniedrigen als du selbst – selbst der schwerste Druck von außen hebt sich dem leicht auf, der innerlich fest und frei bleibt. Immer und insbesondere, wenn das einzelne Individuum in seinem seelischen Frieden und seiner Freiheit bedrängt ist, bedeutet das Wort und der weise Zuspruch Montaignes eine Wohltat, denn nichts schützt uns mehr in Zeiten der Verwirrung und Parteiung als Aufrichtigkeit und Menschlichkeit. Immer und jedesmal ist, was er vor Jahrhunderten sagte, noch gültig und wahr für jeden, der sich um seine eigene Selbständigkeit bemüht. Niemand aber haben wir dankbarer zu sein als jenen, die in einer unmenschlichen Zeit wie der unseren das Menschliche in uns bestärken, die uns mahnen, das Einzige und Unverlierbare, das wir besitzen, unser innerstes Ich, nicht preiszugeben. Denn nur jener, der selbst frei bleibt gegen alles und alle, mehrt und erhält die Freiheit auf Erden.