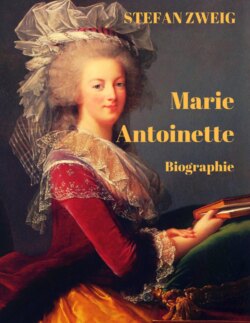Читать книгу Marie Antoinette - Stefan Zweig - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Kind wird verheiratet
ОглавлениеJahrhunderte lang haben Habsburg und Bourbon auf Dutzenden deutscher, italienischer, flandrischer Schlachtfelder um die Vorherrschaft Europas gerungen; endlich sind sie müde, alle beide. In zwölfter Stunde erkennen die alten Rivalen, daß ihre unersättliche Eifersucht nur andern Herrscherhäusern den Weg freigekämpft hat; schon greift von der englischen Insel ein Ketzervolk nach dem Imperium der Welt, schon wächst die protestantische Mark Brandenburg zu mächtigem Königtum, schon bereitet sich das halbheidnische Rußland vor, seine Machtsphäre ins Unermeßliche auszudehnen; wäre es nicht besser, so beginnen sich – wie immer zu spät – die Herrscher und ihre Diplomaten zu fragen, man hielte miteinander Frieden, statt abermals und abermals zugunsten ungläubiger Emporkömmlinge das verhängnisvolle Kriegsspiel zu erneuern? Choiseul am Hofe Ludwigs XV., Kaunitz als Berater Maria Theresias schmieden ein Bündnis, und damit es sich dauerhaft und nicht bloß als Atempause zwischen zwei Kriegen bewähre, schlagen sie vor, die beiden Dynastieen Habsburg und Bourbon sollten sich durch Blut binden. An heiratsfähigen Prinzessinnen hat es im Hause Habsburg zu keiner Zeit gefehlt; auch diesmal steht eine reichhaltige Auswahl aller Alterslagen bereit. Zuerst erwägen die Minister, Ludwig XV. trotz seines großväterlichen Standes und seiner mehr als zweifelhaften Sitten mit einer habsburgischen Prinzessin zu vermählen, aber der Allerchristlichste König flüchtet rasch aus dem Bett der Pompadour in das einer andern Favoritin, der Dubarry. Auch Kaiser Joseph, zum zweitenmal verwitwet, zeigt keine rechte Neigung, sich mit einer der drei altbackenen Töchter Ludwigs XV. verkuppeln zu lassen – so bleibt als natürlichste Verknüpfung die dritte, den heranwachsenden Dauphin, den Enkel Ludwigs XV. und zukünftigen Träger der französischen Krone, mit einer Tochter Maria Theresias zu verloben. 1766 kann die damals elfjährige Marie Antoinette bereits als ernstlich vorgeschlagen gelten; ausdrücklich schreibt der österreichische Botschafter am 24. Mai an die Kaiserin: »Der König hat sich in einer Art und Weise ausgesprochen, daß Eure Majestät das Projekt schon als gesichert und entschieden betrachten können.« Aber Diplomaten wären nicht Diplomaten, setzten sie nicht ihren Stolz daran, einfache Dinge schwierig zu machen, und vor allem, jede wichtige Angelegenheit kunstvoll zu verzögern. Intrigen von Hof zu Hof werden eingeschaltet, ein Jahr, ein zweites, ein drittes, und Maria Theresia, nicht mit Unrecht argwöhnisch, fürchtet, ihr ungemütlicher Nachbar, Friedrich von Preußen, »le monstre«, wie sie ihn in herzhafter Erbitterung nennt, werde schließlich auch noch diesen für Österreichs Machtstellung so entscheidenden Plan mit einer seiner machiavellistischen Teufeleien durchkreuzen; so wendet sie alle Liebenswürdigkeit, Leidenschaft und List an, um den französischen Hof aus dem halben Versprechen nicht mehr herauszulassen. Mit der Unermüdlichkeit einer berufsmäßigen Heiratsvermittlerin, mit der zähen und unnachgiebigen Geduld ihrer Diplomatie läßt sie immer wieder die Vorzüge der Prinzessin nach Paris melden; sie überschüttet die Gesandten mit Höflichkeiten und Geschenken, damit sie endlich aus Versailles ein bindendes Eheangebot heimholen; mehr Kaiserin als Mutter, mehr auf die Mehrung der »Hausmacht« bedacht als auf das Glück ihres Kindes, läßt sie sich auch durch die warnende Mitteilung ihres Gesandten nicht abhalten, die Natur habe dem Dauphin alle Gaben versagt: er sei von sehr beschränktem Verstand, höchst ungeschlacht und völlig gefühllos. Aber wozu braucht eine Erzherzogin glücklich zu werden, wenn sie nur Königin wird? Je hitziger Maria Theresia auf Pakt und Brief drängt, desto überlegener hält der weltkluge König Ludwig XV. zurück; drei Jahre lang läßt er sich Bilder und Berichte über die kleine Erzherzogin schicken und erklärt sich grundsätzlich dem Heiratsplan geneigt. Aber er spricht nicht das erlösende Werbungswort, er bindet sich nicht.
Das ahnungslose Unterpfand dieses wichtigen Staatsgeschäftes, die elfjährige, die zwölfjährige, die dreizehnjährige Toinette, zart gewachsen, anmutig, schlank und unbezweifelbar hübsch, tollt und spielt unterdessen mit Schwestern und Brüdern und Freundinnen temperamentvoll in den Zimmern und Gärten von Schönbrunn; mit Studien, Büchern und Bildung befaßt sie sich wenig. Ihre Gouvernanten und die Abbés, die sie erziehen sollen, versteht sie mit ihrer natürlichen Liebenswürdigkeit und quecksilbernen Munterkeit so geschickt um den Finger zu wickeln, daß sie allen Schulstunden entwischen kann. Mit Schrecken bemerkt eines Tages Maria Theresia, die sich bei der Fülle der Staatsgeschäfte nie um ein einzelnes Stück ihrer Kinderherde sorgfältig bekümmern konnte, daß die zukünftige Königin von Frankreich mit dreizehn Jahren weder Deutsch noch Französisch richtig zu schreiben versteht und nicht einmal mit den oberflächlichsten Kenntnissen in Geschichte und allgemeiner Bildung behaftet ist; mit den musikalischen Leistungen steht es nicht viel besser, obwohl kein Geringerer als Gluck ihr Klavierunterricht gab. In zwölfter Stunde soll jetzt das Versäumnis nachgeholt, die verspielte und faule Toinette zur gebildeten Dame heranerzogen werden. Wichtig für eine zukünftige Königin von Frankreich ist vor allem, daß sie anständig tanzt und mit gutem Akzent Französisch spricht; zu diesem Zweck engagiert Maria Theresia eiligst den großen Tanzmeister Noverre und zwei Schauspieler einer in Wien gastierenden französischen Truppe, den einen für die Aussprache, den andern für Gesang. Aber kaum meldet dies der französische Gesandte dem bourbonischen Hof, als schon ein entrüsteter Wink aus Versailles kommt: eine zukünftige Königin von Frankreich dürfe nicht von Komödiantenpack unterrichtet werden. Hastig werden neue diplomatische Verhandlungen eingeleitet, denn Versailles betrachtet die Erziehung der vorgeschlagenen Braut des Dauphins bereits als eigene Angelegenheit, und nach langem Hin und Her wird auf Empfehlung des Bischofs von Orléans ein Abbé Vermond als Erzieher nach Wien gesandt; von ihm besitzen wir die ersten verläßlichen Berichte über die dreizehnjährige Erzherzogin. Er findet sie reizend und sympathisch: »Mit einem entzückenden Antlitz vereint sie alle erdenkbare Anmut der Haltung, und wenn sie, wie man hoffen darf, etwas wächst, wird sie alle Reize haben, die man für eine hohe Prinzessin wünschen kann. Ihr Charakter und ihr Gemüt sind ausgezeichnet.« Bedeutend vorsichtiger äußert sich jedoch der brave Abbé über die tatsächlichen Kenntnisse und die Lernfreude seiner Schülerin. Verspielt, unaufmerksam, ausgelassen, von einer quecksilberigen Munterkeit, hat die kleine Marie Antoinette trotz leichtester Auffassung nie die geringste Neigung gezeigt, sich mit irgendeinem ernsten Gegenstand zu beschäftigen. »Sie hat mehr Verstand, als man lange bei ihr vermutet hat, doch leider ist dieser Verstand bis zum zwölften Jahre an keine Konzentration gewöhnt worden. Ein wenig Faulheit und viel Leichtfertigkeit haben mir den Unterricht bei ihr noch erschwert. Ich begann während sechs Wochen mit den Grundzügen der schönen Literatur, sie faßte gut auf, urteilte richtig, aber ich konnte sie nicht dazu bringen, tiefer in die Gegenstände einzudringen, obwohl ich fühlte, daß sie die Fähigkeiten dazu hätte. So sah ich schließlich ein, daß man sie nur erziehen kann, indem man sie gleichzeitig unterhält.«
Fast wörtlich werden noch zehn, noch zwanzig Jahre später alle Staatsmänner über diese Denkunwilligkeit bei großem Verstand, über dieses gelangweilte Davonhuschen aus jedem gründlichen Gespräch klagen; schon in der Dreizehnjährigen liegt die ganze Gefahr dieses Charakters, der alles könnte und nichts wahrhaft will, völlig zutage. Aber am französischen Hofe wird seit der Mätressenwirtschaft die Haltung einer Frau mehr geschätzt als ihr Gehalt; Marie Antoinette ist hübsch, sie ist repräsentativ und anständigen Charakters, – das genügt, und so geht denn endlich 1769 das langersehnte Schreiben Ludwigs XV. an Maria Theresia ab, in dem der König feierlich um die Hand der jungen Prinzessin für seinen Enkel, den zukünftigen Ludwig XVI., wirbt und als Termin der Heirat die Ostertage des nächsten Jahres vorschlägt. Beglückt stimmt Maria Theresia zu; nach vielen sorgenvollen Jahren erlebt die tragisch resignierte Frau noch einmal eine helle Stunde. Gesichert scheint ihr jetzt der Frieden des Reiches und damit Europas; mit Stafetten und Kurieren wird sogleich allen Höfen feierlich verkündet, daß Habsburg und Bourbon für ewige Zeiten aus Feinden Blutsverbündete geworden sind. »Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube«; noch einmal hat sich der alte Hausspruch der Habsburger bewährt.
Die Aufgabe der Diplomaten, sie ist glücklich beendet. Aber nun erst erkennt man: dies war der Arbeit leichterer Teil. Denn Habsburg und Bourbon zu einer Verständigung zu überreden, Ludwig XV. und Maria Theresia zu versöhnen, welch ein Kinderspiel dies im Vergleich zu der ungeahnten Schwierigkeit, das französische und österreichische Hof- und Hauszeremoniell bei einer so repräsentativen Festlichkeit unter einen Hut zu bringen. Zwar haben die beiderseitigen Obersthofmeister und sonstigen Ordnungsfanatiker ein ganzes Jahr lang Zeit, das ungeheuer wichtige Protokoll der Hochzeitsfestivitäten in allen Paragraphen auszuarbeiten, aber was bedeutet ein flüchtiges, nur zwölfmonatiges Jahr für derart verzwickte Chinesen der Etikette. Ein Thronfolger von Frankreich heiratet eine österreichische Erzherzogin – welche welterschütternden Taktfragen löst solcher Anlaß aus, wie tiefsinnig muß hier jede Einzelheit durchdacht werden, wie viel unwiderrufliche Fauxpas heißt es da durch Studium jahrhundertealter Dokumente vermeiden! Tag und Nacht sinnen die heiligen Hüter der Sitten und Gebräuche in Versailles und Schönbrunn mit dampfenden Köpfen; Tag und Nacht verhandeln die Gesandten wegen jeder einzelnen Einladung, Eilkuriere mit Vorschlägen und Gegenvorschlägen sausen hin und her, denn man bedenke, welche unübersehbare Katastrophe (ärger als sieben Kriege) könnte hereinbrechen, würde bei diesem erhabenen Anlaß die Rangeitelkeit eines der hohen Häuser verletzt! In zahllosen Dissertationen rechtsüber, linksüber den Rhein erwägt und erörtert man heikle Doktorfragen, etwa diese, wessen Name an erster Stelle im Heiratskontrakt genannt sein solle, derjenige der Kaiserin von Österreich oder des Königs von Frankreich, wer zuerst unterzeichnen dürfe, welche Geschenke gegeben, welche Mitgift vereinbart werden solle, wer die Braut zu begleiten, wer sie zu empfangen habe, wieviel Kavaliere, Ehrendamen, Militärs, Gardereiter, Ober- und Unterkammerfrauen, Friseure, Beichtiger, Ärzte, Schreiber, Hofsekretäre und Waschfrauen dem Hochzeitszug einer Erzherzogin von Österreich bis zur Grenze gebühren und wie viele dann der französischen Thronfolgerin von der Grenze bis nach Versailles. Während aber die beiderseitigen Perücken über die Grundlinien der Grundfragen noch lange nicht einig sind, streiten ihrerseits schon, als gälte es den Schlüssel des Paradieses, an beiden Höfen die Kavaliere und ihre Damen untereinander, gegeneinander, übereinander um die Ehre, den Hochzeitszug, sei es begleiten, sei es empfangen zu dürfen, jeder einzelne verteidigt seine Ansprüche mit einem ganzen Kodex von Pergamenten; und obwohl die Zeremonienmeister wie die Galeerensträflinge arbeiten, kommen sie doch innerhalb eines ganzen Jahres mit diesen weltwichtigsten Fragen des Vortritts und der Hofzulässigkeit nicht völlig zu Rand: im letzten Augenblick wird zum Beispiel die Vorstellung des elsässischen Adels aus dem Programm gestrichen, um »die langwierigen Etikettefragen auszuschalten, die zu regeln keine Zeit mehr bleibt«. Und hätte königlicher Befehl das Datum nicht auf einen ganz bestimmten Tag festgesetzt, die österreichischen und französischen Zeremonienhüter wären bis zum heutigen Tage über die »richtige« Form der Hochzeit noch nicht einig, und es hätte keine Königin Marie Antoinette und vielleicht keine Französische Revolution gegeben.
Auf beiden Seiten wird, obwohl Frankreich wie Österreich Sparsamkeit bitter nötig hätten, die Hochzeit auf höchsten Pomp und Prunk gestellt. Habsburg will hinter Bourbon und Bourbon hinter Habsburg nicht zurückbleiben. Das Palais der französischen Gesandtschaft in Wien erweist sich als zu klein für die fünfzehnhundert Gäste; Hunderte von Arbeitern errichten in fliegender Eile Anbauten, während gleichzeitig ein eigener Opernsaal in Versailles für die Hochzeitsfeier vorbereitet wird. Für die Hoflieferanten, für die Hofschneider, Juweliere, Karossenbauer kommt hüben und drüben gesegnete Zeit. Allein für die Einholung der Prinzessin bestellt Ludwig XV. bei dem Hoffournisseur Francien in Paris zwei Reisewagen von noch nie dagewesener Pracht: köstliches Holz und schimmernde Gläser, innen mit Samt ausgeschlagen, außen mit Malereien verschwenderisch geschmückt, von Kronen überwölbt und trotz dieses Prunks herrlich federnd und schon bei leichtestem Zuge fortrollend. Für den Dauphin und den königlichen Hof werden neue Paraderöcke angeschafft und mit kostbaren Juwelen durchstickt, der große Pitt, der herrlichste Diamant jener Zeit, schmückt den Hochzeitshut Ludwigs XV., und mit gleichem Luxus bereitet Maria Theresia den Trousseau ihrer Tochter: Spitzenwerk, eigens in Mecheln geklöppelt, zartestes Leinen, Seide und Juwelen. Endlich trifft der Gesandte Durfort als Brautwerber in Wien ein, herrliches Schauspiel für die leidenschaftlich schaulustigen Wiener: achtundvierzig sechsspännige Karossen, darunter die beiden gläsernen Wunderwerke, rollen langsam und gravitätisch durch die bekränzten Straßen zur Hofburg, hundertsiebentausend Dukaten haben allein die neuen Livreen der hundertsiebzehn Leibgarden und Lakaien gekostet, die den Brautwerber begleiten, der ganze Einzug nicht weniger als dreihundertfünfzigtausend. Von dieser Stunde an reiht sich Fest an Fest: öffentliche Werbung, feierlicher Verzicht Marie Antoinettes auf ihre österreichischen Rechte vor Evangelium, Kruzifix und brennenden Kerzen, Gratulationen des Hofes, der Universität, Parade der Armee, Théâtre paré, Empfang und Ball im Belvedere für dreitausend Personen, Gegenempfang und Souper für fünfzehnhundert Gäste im Liechtensteinpalais, endlich am 19. April die Eheschließung per procurationem in der Augustinerkirche, bei der Erzherzog Ferdinand den Dauphin vertritt. Dann noch ein zärtliches Familiensouper und am 21. feierlicher Abschied, letzte Umarmung. Und durch ein ehrfürchtiges Spalier fährt in der Karosse des französischen Königs die gewesene Erzherzogin von Österreich, Marie Antoinette, ihrem Schicksal entgegen.
Der Abschied von ihrer Tochter war Maria Theresia schwer geworden. Jahre und Jahre hat die alternde, abgemüdete Frau diese Heirat um der Mehrung der habsburgischen »Hausmacht« Willen als das höchste Glück erstrebt, und doch macht in letzter Stunde das Schicksal ihr Sorge, das sie selbst ihrem Kinde bestimmt. Blickt man tiefer in ihre Briefe, in ihr Leben, so erkennt man: diese tragische Herrscherin, der einzige große Monarch des österreichischen Hauses, trägt die Krone längst nur noch als Bürde. Mit unendlicher Mühe, in immerwährenden Kriegen hat sie das zusammengeheiratete und in gewissem Sinne künstliche Reich gegen Preußen und Türken, gegen Osten und Westen als Einheit behauptet, aber gerade jetzt, da es äußerlich gesichert scheint, sinkt ihr der Mut. Eine merkwürdige Ahnung bedrängt die ehrwürdige Frau, dieses Reich, dem sie ihre ganze Kraft und Leidenschaft gegeben, werde unter ihren Nachfolgern verfallen und zerfallen; sie weiß, hellsichtige und fast seherische Politikerin, wie locker dieses Gemisch zufällig gekoppelter Nationen gefügt ist und mit wieviel Vorsicht und Zurückhaltung, mit wieviel kluger Passivität einzig sein Bestand verlängert werden kann. Wer aber soll fortführen, was sie so sorglich begonnen hat? Tiefe Enttäuschungen an ihren Kindern haben einen Kassandrageist in ihr erweckt, bei ihnen allen vermißt sie, was die ureigenste Kraft ihres Wesens war, die große Geduld, das langsame sichere Planen und Beharren, das Verzichten-Können und das weise Sich-selbst-Beschränken. Aber von dem lothringischen Blut ihres Mannes muß eine heiße Unruhwelle in die Adern ihrer Kinder geströmt sein; alle sind sie bereit, für die Lust eines Augenblicks unabsehbare Möglichkeiten zu zerstören: ein kleines Geschlecht, unernst, ungläubig und nur um vergänglichen Erfolg bemüht. Ihr Sohn und Mitregent Joseph II. umschmeichelt voll Kronprinzenungeduld Friedrich den Großen, der sie ein Leben lang verfolgt und verhöhnt hat; er buhlt um Voltaire, den sie, die fromme Katholikin, als den Antichrist haßt; ihr anderes Kind, das sie gleichfalls für einen Thron bestimmt hat, die Erzherzogin Maria Amalia, hält, kaum nach Parma verheiratet, ganz Europa mit ihrer Leichtfertigkeit in Atem. In zwei Monaten zerrüttet sie die Finanzen, desorganisiert sie das Land, vergnügt sich mit Liebhabern. Und auch die andere Tochter in Neapel macht ihr wenig Ehre; keine von den Töchtern zeigt Ernst und sittliche Strenge, und das ungeheure Werk aufopfernder und pflichthafter Bemühung, dem die große Kaiserin ihr ganzes persönliches und privates Leben, jede Freude, jeden leichten Genuß unerbittlich aufgeopfert hatte, erscheint ihr sinnlos vollbracht. Am liebsten würde sie in ein Kloster flüchten, und nur aus Angst, aus dem richtigen Vorgefühl, der eilfertige Sohn werde mit unbedachtem Experimentieren sofort alles zerstören, was sie erbaut, hält die alte Kämpferin das Zepter fest, dessen ihre Hand längst müde geworden ist.
Auch über ihr Nesthäkchen Marie Antoinette gibt sich die starke Charakterkennerin keiner Täuschung hin; sie weiß um die Vorzüge – die große Gutmütigkeit und Herzlichkeit, die frische muntere Klugheit, das unverstellte humane Wesen – dieser ihrer jüngsten Tochter, sie kennt aber auch die Gefahren, ihre Unausgereiftheit, ihre Leichtfertigkeit, Verspieltheit, Zerfahrenheit. Um ihr näher zu kommen, um noch in letzter Stunde eine Königin aus diesem temperamentvollen Wildfang zu formen, läßt sie Marie Antoinette die letzten zwei Monate vor der Abreise in ihrem eigenen Zimmer schlafen: sie sucht sie in langen Gesprächen auf ihre große Stellung vorzubereiten; und um die Hilfe des Himmels zu gewinnen, nimmt sie das Kind zu einer Wallfahrt nach Mariazell mit. Je näher indes die Stunde des Abschieds kommt, um so unruhiger wird die Kaiserin. Irgendeine finstere Ahnung verstört ihr das Herz, Ahnung kommenden Unheils, und sie setzt alle Kraft ein, die dunklen Mächte zu bannen. Vor der Abreise gibt sie Marie Antoinette eine ausführliche Verhaltungsvorschrift mit und nimmt dem achtlosen Kinde den Eid ab, sie jeden Monat sorgfältig zu überlesen. Sie schreibt außer dem offiziellen Brief noch einen privaten an Ludwig XV., in welchem die alte Frau den alten Mann beschwört, Nachsicht mit dem kindischen Unernst der Vierzehnjährigen zu haben. Aber noch immer ist ihre innere Unruhe nicht beschwichtigt. Noch kann Marie Antoinette nicht in Versailles angelangt sein, und schon wiederholt sie die Mahnung, jene Denkschrift zu Rate zu ziehen. »Ich erinnere Dich, meine geliebte Tochter, an jedem 21. des Monats jenes Blatt nachzulesen. Sei verläßlich in Hinblick auf diesen meinen Wunsch, ich bitte Dich darum; ich fürchte ja bei Dir nichts als Deine Nachlässigkeit im Beten und in der Lektüre und die daraus folgende Unachtsamkeit und Trägheit. Kämpfe gegen sie an ... und vergiß nicht Deine Mutter, die, wenn auch entfernt, nicht aufhören wird, bis zum letzten Atemzug um Dich besorgt zu sein.« Mitten im Jubel der Welt über den Triumph ihrer Tochter geht die alte Frau in die Kirche und betet zu Gott, er möge ein Unheil wenden, das sie allein von allen vorausfühlt.
Während die riesige Kavalkade – dreihundertvierzig Pferde, die an jeder Poststation gewechselt werden müssen – langsam durch Oberösterreich, Bayern zieht und sich nach zahllosen Festen und Empfängen der Grenze nähert, hämmern Zimmerleute und Tapezierer auf der Rheininsel zwischen Kehl und Straßburg an einem sonderbaren Bau. Hier haben die Obersthofmeister von Versailles und Schönbrunn ihren großen Trumpf ausgespielt; nach endlosem Beraten, ob die feierliche Übergabe der Braut noch auf österreichischem Hoheitsgebiet oder erst auf französischem erfolgen solle, erfand ein Schlaukopf unter ihnen die salomonische Lösung, auf einer der kleinen unbewohnten Sandinseln im Rhein, zwischen Frankreich und Deutschland, in Niemandsland also, einen eigenen Holzpavillon für die festliche Übergabe zu erbauen, ein Wunder der Neutralität, zwei Vorzimmer auf der rechtsrheinischen Seite, die Marie Antoinette noch als Erzherzogin betritt, zwei Vorzimmer auf der linksrheinischen Seite, die sie nach der Zeremonie als Dauphine von Frankreich verläßt, und in der Mitte den großen Saal der feierlichen Übergabe, in dem sich die Erzherzogin endgültig in die Thronfolgerin Frankreichs verwandelt. Kostbare Tapisserieen aus dem erzbischöflichen Palais verdecken die rasch aufgezimmerten hölzernen Wände, die Universität von Straßburg leiht einen Baldachin, die reiche Straßburger Bürgerschaft ihr schönstes Mobiliar. In dieses Heiligtum fürstlicher Pracht einzudringen, ist bürgerlichem Blick selbstverständlich verwehrt; ein paar Silberstücke jedoch machen Wächter allorts nachsichtig, und so schleichen einige Tage vor Marie Antoinettes Ankunft einige junge deutsche Studenten in die halbfertigen Räume, um ihrer Neugier Genüge zu tun. Und einer besonders, hochgewachsen, freien leidenschaftlichen Blicks, die Aura des Genius über der männlichen Stirn, kann sich nicht sattsehen an den köstlichen Gobelins, die nach Raffaels Kartons gefertigt sind; sie erregen in dem Jüngling, dem sich eben erst am Straßburger Münster der Geist der Gotik offenbart hatte, stürmische Lust, mit gleicher Liebe klassische Kunst zu begreifen. Begeistert erklärt er den weniger beredten Kameraden diese ihm unvermutet erschlossene Schönheitswelt italienischer Meister, aber plötzlich hält er inne, wird unmutig, die starke dunkle Braue wölkt sich fast zornig über dem eben noch befeuerten Blick. Denn jetzt erst ist er gewahr geworden, was diese Wandteppiche darstellen, in der Tat eine für ein Hochzeitsfest denkbar unpassende Legende, die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa, das Erzbeispiel einer verhängnisvollen Eheschließung. »Was,« ruft der genialische Jüngling, ohne auf das Erstaunen der Umstehenden achtzuhaben, mit lauter Stimme aus, »ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der gräßlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen wurde, bei ihrem ersten Eintritt so unbesonnen vor Augen zu führen? Gibt es denn unter den französischen Architekten, Dekorateuren und Tapezierern gar keinen Menschen, der begreift, daß Bilder etwas vorstellen, daß Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, daß sie Eindrücke machen, daß sie Ahnungen erregen? Ist es doch nicht anders, als hätte man dieser schönen und, wie man hört, lebenslustigen Dame das abscheulichste Gespenst bis an die Grenze entgegengeschickt.« Mit Mühe gelingt es den Freunden, den Leidenschaftlichen zu beschwichtigen, beinahe mit Gewalt führen sie Goethe – denn kein anderer ist dieser junge Student – aus dem bretternen Haus. Bald aber naht jener »gewaltige Hof- und Prachtstrom« des Hochzeitszuges und überschwemmt mit heiterm Gespräch und froher Gesinnung den geschmückten Raum, nicht ahnend, daß wenige Stunden zuvor das seherische Auge eines Dichters in diesem bunten Gewebe schon den schwarzen Faden des Verhängnisses erblickt.
Die Übergabe Marie Antoinettes soll Abschied von allen und allem veranschaulichen, was sie mit dem Hause Österreich verbindet; auch hierfür haben die Zeremonienmeister ein besonderes Symbol ersonnen: nicht nur darf niemand ihres heimatlichen Gefolges sie über die unsichtbare Grenzlinie begleiten, die Etikette heischt sogar, daß sie keinen Faden heimatlicher Erzeugung, keinen Schuh, keinen Strumpf, kein Hemd, kein Band auf dem nackten Leibe behalten dürfe. Von dem Augenblicke an, da Marie Antoinette Dauphine von Frankreich wird, darf nur Stoff französischer Herkunft sie umhüllen. So muß sich im österreichischen Vorzimmer die Vierzehnjährige vor dem ganzen österreichischen Gefolge bis auf die Haut entkleiden; splitternackt leuchtet für einen Augenblick der zarte, noch unaufgeblühte Mädchenleib in dem dunklen Raum; dann wird ihr ein Hemd aus französischer Seide übergeworfen, Jupons aus Paris, Strümpfe aus Lyon, Schuhe des Hofkordonniers, Spitzen und Maschen; nichts darf sie als liebes Andenken zurückbehalten, nicht einen Ring, nicht ein Kreuz – würde die Welt der Etikette denn nicht einstürzen, bewahrte sie eine einzige Spange oder ein vertrautes Band? – nicht ein einziges von den seit Jahren gewohnten Gesichtern darf sie von jetzt an um sich sehen. Ist es ein Wunder, wenn in diesem Gefühl so jäh ins Fremde-gestoßen-Seins das kleine, von all diesem Pomp und Getue erschreckte Mädchen ganz kindhaft in Tränen ausbricht? Aber sofort heißt es wieder Haltung bewahren, denn Aufwallungen des Gefühls sind bei einer politischen Hochzeit nicht statthaft; drüben im andern Zimmer wartet schon die französische Suite, und es wäre beschämend, mit feuchten Augen, verweint und furchtsam diesem neuen Gefolge entgegenzutreten. Der Brautführer, Graf Starhemberg, reicht ihr zum entscheidenden Gange die Hand, und französisch gekleidet, zum letztenmal gefolgt von ihrer österreichischen Suite, betritt sie, zwei letzte Minuten noch Österreicherin, den Saal der Übergabe, wo in hohem Staat und Prunk die bourbonische Abordnung sie erwartet. Der Brautwerber Ludwigs XV. hält eine feierliche Ansprache, das Protokoll wird verlesen, dann kommt – alle halten den Atem an – die große Zeremonie. Sie ist Schritt für Schritt errechnet wie ein Menuett, voraus geprobt und eingelernt. Der Tisch in der Mitte des Raumes stellt symbolisch die Grenze dar. Vor ihm stehen die Österreicher, hinter ihm die Franzosen. Zuerst läßt der österreichische Brautführer, Graf Starhemberg, die Hand Marie Antoinettes los; statt seiner ergreift sie der französische Brautführer und geleitet langsam, mit feierlichem Schritt das zitternde Mädchen um die Flanke des Tisches herum. Während dieser genau ausgesparten Minuten zieht sich, langsam nach rückwärts gehend, im selben Takt, wie die französische Suite der künftigen Königin entgegenschreitet, die österreichische Begleitung gegen die Eingangstür zurück, so daß genau in demselben Augenblick, da Marie Antoinette inmitten ihres neuen französischen Hofstaates steht, der österreichische bereits den Raum verlassen hat. Lautlos, musterhaft, gespenstig-großartig vollzieht sich diese Orgie der Etikette; nur im letzten Augenblick hält das kleine verschüchterte Mädchen dieser kalten Feierlichkeit nicht mehr stand. Und statt kühl gelassen den devoten Hof knicks ihrer neuen Gesellschaftsdame, der Komtesse de Noailles, entgegenzunehmen, wirft sie sich ihr schluchzend und wie hilfesuchend in die Arme, eine schöne und rührende Geste der Verlassenheit, die vorzuschreiben alle Großkophtas der Repräsentation hüben und drüben vergaßen. Aber Gefühl ist nicht eingerechnet in die Logarithmen der höfischen Regeln, schon wartet draußen die gläserne Karosse, schon dröhnen vom Straßburger Münster die Glocken, schon donnern die Artilleriesalven, und, von Jubel umbrandet, verläßt Marie Antoinette für immer die sorglosen Gestade der Kindheit: ihr Frauenschicksal beginnt.
Der Einzug Marie Antoinettes wird eine unvergeßliche Feststunde für das mit Festen schon lange nicht mehr verwöhnte französische Volk. Seit Jahrzehnten hat Straßburg keine künftige Königin gesehen und vielleicht noch nie eine derart bezaubernde wie dieses junge Mädchen. Aschblonden Haars, schlanken Wuchses lacht und lächelt das Kind mit blauen, übermütigen Augen aus der gläsernen Karosse den unermeßlichen Scharen zu, die, in schmucker elsässischer Landestracht aus allen Dörfern und Städten herangeströmt, den prunkvollen Zug umjubeln. Hunderte weißgekleideter Kinder schreiten blumenstreuend dem Wagen vorauf, ein Triumphbogen ist aufgerichtet, die Tore sind bekränzt, auf dem Stadtplatz fließt Wein aus dem Brunnen, ganze Ochsen werden auf Spießen gebraten, Brot aus riesigen Körben an die Armen verteilt. Abends werden alle Häuser illuminiert, feurige Lichtschlangen züngeln den Münsterturm empor, durchsichtig erglüht das rötliche Spitzenwerk der göttlichen Kathedrale. Auf dem Rhein gleiten, Lampions wie glühende Orangen tragend, zahllose Schiffe und Barken mit farbigen Fackeln, in den Bäumen schimmern, von Lichtern angestrahlt, bunte Glaskugeln, und von der Insel her flammt, allen sichtbar, als Abschluß eines grandiosen Feuerwerks, inmitten mythologischer Figuren das verschlungene Monogramm des Dauphins und der Dauphine. Bis tief in die Nacht zieht das schaulustige Volk die Ufer und Straßen entlang, Musik dudelt und dröhnt, an hundert Stellen schwingen Männer und Mädchen sich munter im Tanz; ein goldenes Zeitalter des Glücks scheint mit dieser blonden Botin aus Österreich gekommen, und noch einmal hebt das verbitterte, verärgerte Volk Frankreichs sein Herz heiterer Hoffnung entgegen.
Aber auch dieses großartige Gemälde birgt einen kleinen versteckten Riß, auch hier hat ebenso wie in die Gobelins des Empfangssaales das Schicksal symbolisch ein Unheilszeichen eingewoben. Als am nächsten Tage Marie Antoinette vor der Abfahrt noch die Messe hören will, begrüßt sie am Portal der Kathedrale statt des ehrwürdigen Bischofs dessen Neffe und Koadjutor an der Spitze der Geistlichkeit. In seinem flutenden violetten Gewände etwas weibisch aussehend, hält der mondäne Priester eine galant-pathetische Ansprache – nicht umsonst hat ihn die Akademie in ihre Reihen gewählt –, die in den höfischen Sätzen gipfelt: »Sie sind für uns das lebendige Bildnis der verehrten Kaiserin, welche seit langem Europa ebenso bewundert, wie die Nachwelt sie verehren wird. Die Seele Maria Theresias vereint sich nun mit der Seele der Bourbonen.« Ehrfürchtig ordnet sich nach der Begrüßung der Zug in den blauschimmernden Dom, der junge Priester geleitet die junge Prinzessin zum Altar und hebt mit feiner, beringter Liebhaberhand die Monstranz. Es ist Louis Prinz Rohan, der als erster in Frankreich ihr Willkommen bietet, der spätere tragikomische Held der Halsbandaffäre, ihr gefährlichster Gegner, ihr verhängnisvollster Feind. Und die Hand, die jetzt segnend über ihrem Haupte schwebt, ist dieselbe, die ihr Krone und Ehre später in Schmutz und Verachtung schleudern wird.
Nicht lange darf Marie Antoinette in Straßburg, im halbheimatlichen Elsaß, bleiben: wenn ein König von Frankreich wartet, wäre jedes Zögern Verstoß. An brausenden Ufern des Jubels vorbei, durch Triumphpforten und bekränzte Tore steuert die Brautfahrt endlich dem ersten Ziel entgegen, dem Walde von Compiègne, wo mit riesiger Wagenburg die königliche Familie ihr neues Mitglied erwartet. Hofherren, Hofdamen, Offiziere, die Leibgarden, Trommler, Trompeter und Bläser, alle in neuen schimmernden Kleidern, stehen in bunter Rangordnung geschart; der ganze mailichte Wald leuchtet von diesem flackernden Farbenspiel. Kaum künden Fanfaren beider Gefolge das Nahen des Hochzeitszuges, so verläßt Ludwig XV. seine Karosse, um die Frau seines Enkels zu empfangen. Aber schon eilt mit ihrem vielbewunderten leichten Schritt Marie Antoinette ihm entgegen und kniet mit anmutigstem Knicks (nicht umsonst Schülerin des großen Tanzmeisters Noverre) vor dem Großvater ihres zukünftigen Gatten nieder. Der König, von seinem Hirschpark her ein guter Kenner frischen Mädchenfleisches und höchst empfänglich für graziöse Anmut, biegt sich zärtlich-zufrieden herab zu dem jungen blonden appetitlichen Ding, hebt die Enkelsbraut empor und küßt sie auf beide Wangen. Dann erst stellt er ihr den zukünftigen Gemahl vor, der, fünf Fuß zehn Zoll hoch, steifleinen und tölpelig-verlegen zur Seite steht, jetzt endlich die verschlafenen kurzsichtigen Augen hebt und ohne sonderliche Beflissenheit seine Braut, der Etikette gemäß, formell auf die Wange küßt. In der Karosse sitzt Marie Antoinette zwischen Großvater und Enkel, zwischen Ludwig XV. und dem zukünftigen Ludwig XVI. Der alte Herr scheint eher die Rolle des Bräutigams zu spielen, angeregt plaudert er und macht ihr sogar ein wenig den Hof, indes der zukünftige Gatte sich gelangweilt und stumm in seine Ecke drückt. Abends, da die Verlobten und per procurationem bereits Vermählten in ihren abgesonderten Zimmern schlafen gehen, hat der triste Liebhaber noch kein einziges zärtliches Wort zu diesem entzückenden Backfisch gesprochen, und in sein Tagebuch schreibt er als Resümee des entscheidenden Tages einzig die dürre Zeile: »Entrevue avec Madame la Dauphine.«
Sechsunddreißig Jahre später wird in ebendemselben Wald von Compiègne ein anderer Herrscher Frankreichs, Napoleon, eine andere österreichische Erzherzogin, Marie Louise, als Gattin erwarten. Sie wird nicht so hübsch, nicht so knusperig wie Marie Antoinette sein, die rundliche, langweilig sanfte Marie Louise. Aber doch ergreift der energische Mann und Werber von der ihm zubestimmten Braut sofort zärtlich und stürmisch Besitz. Noch am selben Abend fragt er den Bischof, ob ihm die Wiener Heirat schon eheliche Rechte gäbe, und ohne die Antwort abzuwarten, zieht er die Folgerungen: am nächsten Morgen frühstücken die beiden schon gemeinsam im Bett. Marie Antoinette aber ist im Wald in Compiègne keinem Liebhaber und keinem Mann begegnet: nur einem Staatsbräutigam.
Die zweite, die eigentliche Hochzeitsfeier findet am 16. Mai zu Versailles in der Kapelle Ludwigs XIV. statt. Ein solcher Hof- und Staatsakt des Allerchristlichsten Herrscherhauses bedeutet eine zu intime, zu familiäre, wie auch zu erlauchte und souveräne Angelegenheit, als daß man dem Volk erlaubte, dabei Zuschauer zu sein oder auch nur Spalier vor den Türen zu bilden. Nur adeliges Blut – mindestens hundertästiger Stammbaum berechtigt, den Kirchenraum zu betreten, der, strahlende Frühlingssonne hinter den bunten Gläsern, den gestickten Brokat, die schillernde Seide, die unermeßlich ausgebreitete Pracht der erwählten Geschlechter wie ein letztes Fanal der alten Welt noch einmal überwältigend aufleuchten läßt. Der Erzbischof von Reims vollzieht die Trauung. Er segnet die dreizehn Goldstücke und den Hochzeitsring; der Dauphin steckt Marie Antoinette den Ring an den vierten Finger, überreicht ihr die Goldstücke, darauf knieen beide hin, den Segen zu empfangen. Mit Orgelklang setzt die Messe ein, beim Paternoster wird ein silberner Baldachin über die Häupter des jungen Paares gehalten, dann erst unterzeichnet der König und in sorglicher Rangabstufung die gesamte Blutsverwandtschaft den Hochzeitspakt. Es wird ein ungeheuer langes, vielgefaltetes Dokument; noch heute sieht man auf dem verblichenen Pergament die stolprig und ungeschickt hingesetzten vier Worte: Marie Antoinette Josepha Jeanne, von der Kinderhand der Fünfzehnjährigen mühsam hingekritzelt, und daneben – abermals raunen alle: ein böses Omen – einen mächtigen Tintenklecks, der ihr und einzig ihr allein von allen Unterzeichnern aus der widerstrebenden Feder spritzt.
Marie Antoinette am Clavecin
Ölgemälde von François Hubert Drouais
Nun, nach beendeter Zeremonie, wird gnädig auch dem Volk gestattet, sich am Feste der Monarchen mitzufreuen. Unzählbare Menschenmengen – halb Paris ist entvölkert – ergießen sich in die Gärten von Versailles, die heute auch dem profanum vulgus ihre Wasserkünste und Kaskaden, ihre Schattengänge und Wiesenflächen offenbaren; das Hauptgaudium soll das abendliche Feuerwerk sein, das großartigste, das man je an einem Königshofe gesehen hat. Doch der Himmel macht Feuerwerk auf eigene Rechnung. Finster, unglückverheißend türmen sich nachmittags Wolken auf, ein Gewitter zuckt nieder, ungeheuer schüttet sich ein Platzregen aus, und in wildem Aufruhr strömt das Volk, um sein Schauspiel betrogen, nach Paris zurück. Indes schlotternd vor Kälteschauern Zehntausende über die Straßen flüchten, sturmgejagt, tumultuarisch und naß, und die Bäume, regengeschüttelt, im Park sich biegen, beginnt hinter den von vielen tausend Kerzen erhellten Fenstern des neuerbauten »salle de spectacle« in vorbildlichem, durch keinen Orkan und kein Weltbeben zu erschütterndem Zeremoniell das große Hochzeitsmahl: zum erstenmal und letztenmal versucht Ludwig XV. die Pracht seines großen Vorgängers Ludwigs XIV. zu übertreffen. Sechstausend erlesene Adelsgäste haben mit Mühe Eintrittskarten erkämpft, freilich nicht, um mitzuspeisen, sondern einzig, um ehrfürchtig von der Galerie zusehen zu dürfen, wie die zweiundzwanzig Angehörigen des Königshauses Messer und Gabel zum Munde führen. Alle sechstausend halten den Atem an, um die Erhabenheit dieses großen Schauspiels nicht zu stören; nur zart und gedämpft begleitet von den marmornen Arkaden ein Orchester von achtzig Musikern das fürstliche Mahl. Dann schreitet unter dem Salut der französischen Garden die ganze königliche Familie durch das demütig gebeugte Spalier des Adels: die offizielle Feier ist zu Ende, und der königliche Bräutigam hat jetzt keine andere Pflicht als die jedes andern Ehemanns zu erfüllen. Zur rechten Hand die Dauphine, zur linken den Dauphin, führt der König das kindliche Paar (zusammen zählt es kaum dreißig Jahre) in sein Schlafgemach. Noch bis in die Brautstube drängt sich die Etikette ein, denn wer anders könnte dem Thronfolger das Nachthemd überreichen als der König von Frankreich in Person, und wer anders der Dauphine das ihre als die jüngst verheiratete Dame höchsten Ranges, in diesem Fall die Herzogin von Chartres? Dem Bette selbst aber darf nur ein einziger außer den Brautleuten nahen: der Erzbischof von Reims, der es segnet und mit Weihwasser besprengt.
Endlich verläßt der Hof den intimen Raum; Ludwig und Marie Antoinette bleiben zum erstenmal ehelich allein, und der Baldachin des Himmelbettes rauscht über ihnen nieder, brokatener Vorhang einer unsichtbaren Tragödie.