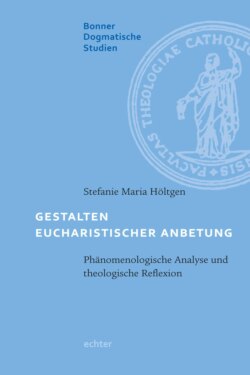Читать книгу Gestalten eucharistischer Anbetung - Stefanie Maria Höltgen - Страница 11
Оглавление1. Charles de Foucauld (1858-1916)
Der Franzose Charles de Foucauld praktiziert bis zum Ende seines Lebens eine eucharistische Frömmigkeit, die von der Anbetung bestimmt ist. Seine Gotteserfahrungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit seinen Erfahrungen während der Beschauung der konsekrierten Hostie. Diese lässt sich vor allem aus seinen unzähligen meditativen Notizen erschließen, aber auch aus seinen vielen Briefen an Verwandte, Freunde und an seinen Seelenführer.
Foucauld hat seine Gedanken nicht aus theologischem Interesse niedergeschrieben; mit Sicherheit hatte er nie die Absicht, eine Theologie eucharistischer Anbetung zu entfalten. Sie dienten vielmehr seiner geistlichen Erinnerung und waren eigentlich nie zur Veröffentlichung gedacht. Heute geben sie jedoch umfangreichen Aufschluss über sein Denken. Wenngleich sich in seinen Notizen vieles häufig wiederholt, ähnelt und von einer einfachen Ausdrucksweise ist, so sind seine Aufzeichnungen doch von einer beachtlichen Reflexivität über das, was ihm in der Begegnung mit dem Evangelium und dem eucharistischen Brot widerfährt. Jene erkennenden Momente innerhalb der Anbetung zeigen sich außerdem in seiner Lebensgestaltung verankert, weshalb sich seine Praxis und Theologie der eucharistischen Anbetung nicht losgelöst von seiner Biographie betrachten lassen.
Für Foucauld ist das Gebet vor allem ein ausdauerndes Verharren in der Gegenwart Gottes. Die Vergegenwärtigung Jesu Christi vor dem inneren betrachtenden Auge soll niemals abbrechen, nicht während der Arbeit, des Schlafes oder sonstiger Beschäftigungen, denen Charles alltäglich nachgeht. Es handelt sich um ein fortwährendes, sich in der alltäglichen Arbeit fortsetzendes Gebet. Sein Beten verleiblicht sich in der Aktion; und diese Verleiblichung verbindet ihn tiefer mit dem eucharistischen Leib Christi48.
Die Anbetung wird für Charles de Foucauld zu einer Haltung und hat dennoch ihren ausgezeichneten Platz: vor der heiligen Eucharistie. In dem Verweilen vor dem Allerheiligsten wird das konkret und wirklich, worum Charles de Foucauld stets bemüht ist: sich selbst ganz und gar vor die Gegenwart Jesu Christi zu bringen, von Ihm her alles andere bestimmen zu lassen. Immer wieder bekennt er, dass die Stunden, die er vor dem Allerheiligsten kniend verbringen darf, die schönsten sind49.
Solche Zeiten der Ruhe und Sammlung sind in Foucaulds Augen unerlässlich, will man sich nicht in der Banalität des Alltäglichen verlieren: „[…] es sollen schließlich Zeiten der Einsamkeit in Jesu Gesellschaft sein, Zeiten, die wir ganz mit Ihm verbringen, ausschließlich Ihm widmen, sanftmütig zu seinen Füßen sitzen und Ihn anblicken, ohne ein Wort zu sagen, oder Ihn befragen, Ihn immerzu genießen […]“50. Die eucharistische Anbetung erachtet Foucauld zwar nicht als die alleingültige Weise der Beschauung; er nennt sie eine Form, die am besten dann praktiziert wird, wenn ihr der jeweilige Seelenzustand angemessen entspricht51. Für ihn selbst hat das Gebet zu Füßen des eucharistischen Brotes jedoch Vorrang, wie zahlreiche Ausweise seiner Sehnsucht nach Zeiten in der Beschauung des Allerheiligsten belegen52.
Foucauld spricht von einem bestimmten Zustand der Seele: „Gebet ist jedes Gespräch der Seele mit Gott; es ist auch jener Zustand der Seele, die Gott wortlos, einzig in seinen Anblick versunken betrachtet, indem sie ihm mit ihren Blicken sagt, daß sie ihn liebt, während die Lippen, ja auch die Gedanken stumm bleiben“53. Trotzdem ist jener Zustand nicht einer der Tatenlosigkeit, vielmehr handelt es sich um eine ununterbrochene Bewegung der Liebe. Das Gebet muss von Liebe gekennzeichnet sein: „Das Gebet, das aus der größten Liebe kommt, ist das Beste, und das Gebet ist umso besser, je mehr Liebe es enthält“54.
Selbstverständlich hat auch das gesprochene Wort seinen Platz in Foucaulds Spiritualität: Hier sollte vor allem das Danken einen besonderen Platz einnehmen, unter dieser Prämisse aber auch die Bitte. Von der Notwendigkeit des bittenden Gebetes ist Foucauld fest überzeugt. Jeder Bitte wird Gott auf die eine oder andere, für den Menschen nicht immer gleich erkennbare Art und Weise nachkommen. Gerade vor den großen scheinbar unmöglichen Bitten soll sich der Betende nicht scheuen, denn sie werden der Größe Gottes nur umso gerechter55. Wird eine Bitte augenscheinlich nicht erfüllt, dann lediglich, weil Gott besseren Wissens über das eigene Wohlergehen ist und einen anderen Weg geht als jenen, den der Bittende vermutet. Durch seine persönlichen Meditationen, die er auf Anraten seines Beichtvaters Abbé Huvelin während seiner Gebetszeiten in ein Schulheft einträgt, lassen sich bedeutende Schlüsse für das Verstehen von Foucaulds Spiritualität ziehen: Diese dienten – wie er selbst sagt – in erster Linie dazu, „bei der Sache“ zu bleiben und sich bei seiner Betrachtung des Allerheiligsten nicht aus der Sammlung treiben zu lassen. Gleichzeitig wird hier manifest, wie Foucauld seinen jugendlichen Agnostizismus überwunden hat. In der Reflexion wird das Gebet zu Gott zugleich zum Gebet über Gott: nicht um Gott auf das eigene Denken zu reduzieren, sondern um ihn mittels der Sprache zu verlebendigen und somit verkündigend beizutragen zu seiner Sichtbarmachung in der Welt. Anbetung verbleibt nicht zwischen dem Ich des Anbetenden und dem Du des Angebeteten, sondern wird zu Theologie; zu einem Reden über Gott, das sich vom Inneren des Anbetenden in das Außen der Welt kehrt.
Folgende Kurzbiographie soll den Zusammenhang der Spiritualität Foucaulds mit seinem Lebensweg erklären. Damit die biografischen Ausführungen der systematischen Analyse dienlich sind, habe ich die verschiedenen Aspekte seiner in der eucharistischen Anbetung gründenden Spiritualität einzelnen Phasen seiner Biografie zugeordnet. So kann die Verankerung der Frömmigkeit im Leben Foucaulds deutlich werden; womit natürlich nicht gesagt ist, dass die besagten Aspekte nur in jeweils einem Lebensabschnitt seine Frömmigkeit charakterisieren.
1.1 Ein kurzer Überblick: Sein Leben vor und nach der Bekehrung
Charles de Foucauld wird am 15. September des Jahres 1858 in Straßburg geboren. Er ist das erste von zwei Kindern des Ehepaars Foucauld. Seine Schwester Marie wird drei Jahre später – am 13. August 1861 – geboren. Der Name Foucauld, aber auch der Mädchenname seiner Mutter – de Morlet – haben beide eine weitreichende Geschichte und nicht unbedeutende Persönlichkeiten in Kirche und Militär hervorgebracht. Charles Familie ist etabliert, wohlhabend und von einem ausgeprägten Patriotismus zum französischen Staat geprägt. Dennoch bleibt Charles Kindheit nicht lange eine unbeschwerte: Früh erkrankt sein Vater an der damals noch unheilbaren Tuberkulose, verlässt der Ansteckung wegen seine Familie und zieht zu seiner Schwester nach Paris. Kurze Zeit später stirbt Charles Mutter an den Folgen einer Fehlgeburt. Der Tod seines Vaters lässt nicht lange auf sich warten. Im Jahre 1864 sind Charles und seine Schwester Vollwaisen, finden aber in einer fürsorglichen und liebevollen Weise einen Platz im Hause des Großvaters de Morlet. Später wird sich zeigen, dass Charles niemals die letzten Worte seiner Mutter vergaß: „Mein Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner“.
Doch seinen eigenen Kinderglauben kann Charles schon früh nicht mehr halten, geschweige denn weiterentwickeln; seinem erheblichen Gesprächsbedarf in Sachen Glaube und Religion wird kaum einer gerecht. Die einzige Person, zu der er schon sehr früh ein inniges Vertrauen fasst, ist seine Cousine Marie Moitessier, die spätere Vicomtesse de Bondy. Das einzigartige und vertraute Verhältnis zu ihr wird Charles sein Leben lang nicht verlieren.
1870 müssen die Morlets in Folge des verlorenen Krieges gegen Deutschland das Elsass verlassen und flüchten nach Nancy. Der Verlust der bisherigen Heimat und die Niederlage des Vaterlandes sind ein weiterer Schlag, den Charles zu bewältigen hat. In Nancy geht Charles 1872 zwar zur Ersten Heiligen Kommunion, dennoch fühlt er sich als Jugendlicher mehr und mehr von der agnostischen Atmosphäre seiner Zeit angezogen. Wenngleich er seine Achtung vor dem Glauben bewahrt56, kann er für sich selbst dort keine Heimat mehr finden. Es ist für Charles vor allem die Frage nach der Wahrheit des christlichen Glaubens, auf die er keine Antwort findet. Zunehmend wird Charles de Foucauld zu einem Freigeist, der beginnt, sich von der soliden Lebensart seiner Familie abzusetzen. Unumstritten macht ihm die Heirat seiner Cousine Marie mit dem Vicomte Olivier de Bondy zu schaffen, denn er fürchtet einen Bruch in ihrer beider besonderen Freundschaft. 1874 macht er das Abitur 1, ein Jahr später, das er auf der Kadettenschule Sainte-Geneviève in der Rue des Postes verbracht hat, das Abitur 2 mit der Note sehr gut. Dort möchte er seine Ausbildung auch fortsetzen, wird jedoch 1876 der Schule verwiesen. Im Rückblick auf diese Zeit beurteilt er sich selbst äußerst streng und hebt seine damalige schwierige Art hervor57. Noch im selben Jahr tritt er gemäß der Familientradition de Morlet in die Militärschule Saint-Cyr bei Versailles ein und verpflichtet sich im Oktober zu fünf Jahren Dienst. Die kommenden zwei Jahre führt Charles de Foucauld ein eher laues als streng militärisches Leben. Er bringt den Vorgängen in der Militärschule eine ausgesprochene Teilnahmslosigkeit entgegen, demonstriert, wo er nur kann, Desinteresse und verfällt in eine ungesunde Essens- und Trinklust. Das Ganze verschlimmert sich noch, als Charles im Februar 1878 seinen Großvater, den Oberst de Morlet, begraben muss und somit einen weiteren der wenigen Vertrauten verliert. Alles, was das Militär eigentlich als solches auszeichnet, wird von Charles mit außerordentlicher Missachtung gepflegt: Disziplin, Reinlichkeit, Tadellosigkeit. Am 15. September des Todesjahres von Oberst de Morlet erhält Charles seine Mündigkeit und kann nun über seine gesamte Erbschaft verfügen. Und dies tut er auch! Er verschleudert geradezu das Familienvermögen. Die Eigenschaft des Geizes ist ihm vollkommen fremd, er organisiert rauschende Feste für seine Kameraden, ist ihnen gegenüber in jeder Hinsicht spendierfreudig und scheint in keiner Weise an seinem finanziellen Vermögen zu hängen. Er verkehrt mit in den Augen der französischen Gesellschaft sehr zweifelhaften Damen und ergeht sich in Dekadenz und Luxus. Dies spiegelt nicht nur sein Verhalten, sondern auch seine Gestalt paradehaft wider: Charles de Foucauld ist alles andere als ein schlanker Mann. Er genießt die Welt in vollen Zügen und muss bis auf die treue Cousine Marie die Unterstützung seiner Familie einbüßen.
Schon damals ist seine Lebensführung von einer enormen Radikalität gekennzeichnet, die sich in gewandelter Form durch sein ganzes Leben hindurchziehen wird. Zu seiner Militärzeit jedoch ist es in erster Linie die endlose Langeweile am Leben, die ihn zu allerlei Ausschweifungen treibt58. Zugleich ist diese Zeit allerdings auch eine des Schließens von Freundschaften, die ein Leben lang andauern sollen. So zum Beispiel jene mit Morès, Lyautey, Laperrine und Motylinski, die ihm auch nach seiner Bekehrung verbunden bleiben. Trotz seiner unsoliden Art zu leben ist Charles de Foucauld unter seinen Kameraden beliebt; und das nicht nur, weil er sein Geld großzügig für sie ausgibt.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1878 tritt er für die Dauer eines Jahres in die Kavallerieschule von Saumur ein, wo er in der Abschlussprüfung den letzten Platz belegt, und ist anschließend bis 1880 in den Garnisonen Sézanne und Pont-à-Mousson stationiert. Ende 1880 wird sein Regiment nach Algerien verlegt. Wider aller Vernunft nimmt Charles seine Geliebte, eine junge Halbweltdame namens Mimi, mit nach Nordafrika und gibt sie als seine Frau, die Vicomtesse de Foucauld, aus. Natürlich fliegt dieser Schwindel über kurz oder lang auf und Charles wird vor die Wahl gestellt: Entweder die Armee oder diese Frau. Charles macht seinem Mut und seiner Unberechenbarkeit alle Ehre, entscheidet sich für Mimi und wird in die Reserve versetzt59. Daraufhin lebt er mit Mimi in der Schweiz, doch ist dieser Entschluss nicht von langer Dauer. Als er von schweren Gefechten anlässlich des Aufstandes bei Bu Amama hört, in die sein Regiment verwickelt ist, kann er den Gedanken, seine Kameraden im Stich gelassen zu haben, nicht mehr ertragen, und kehrt nach einem erfolgreichen Gesuch um Wiedereinsetzung, ebenso entschlossen, wie er das Militär verlassen hat, nach Algerien zurück.
In dem von den Franzosen besetzten Kolonialgebiet begegnet Charles de Foucauld erstmalig dem Glauben der Muslime. Dieser und vor allem die gelebte Frömmigkeit der Muslime beeindrucken ihn zutiefst. Zum ersten Mal seit seiner Jugendzeit wird er wieder vor die Frage nach Gott gestellt. Daneben prägt ihn nachhaltig die Landschaft der Wüste, deren Leere und Einsamkeit nichts von dem großen Glanz des materialistischen Frankreichs übrig lässt. Seine Kameraden nehmen erste Änderungen an ihrem Freund Charles wahr: Er wird ernsthafter, nachdenklicher und pflichtbewusster.
Zu Beginn des Jahres 1882 verabschiedet sich Charles von der Armee und widmet sich mit Feuereifer einer neuen Idee, der sich seine Familie nur sehr widerwillig beugt, und auch nur unter der Bedingung, seine Vormundschaft zu übernehmen. Die Familie hat Angst, Charles könne das Familienvermögen nun gänzlich an den Mann bringen und stellt ihm nunmehr lediglich 350 Francs monatlich zur Verfügung. An der Ausführung seiner Idee hindert ihn dies jedoch nicht; und so begibt er sich 1883 auf eine Forschungsreise durch Marokko60. Als Jude verkleidet, um so behördlichen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, reist er in bescheidenen Verhältnissen als erster Europäer durch das ihn so faszinierende Land und studiert dessen Kultur, Ethnologie und Ethnografie aufs Genaueste, kartographiert weite Teile des noch unerschlossenen Gebietes und eignet sich die arabische Sprache an. Während dieser langen und entbehrungsreichen Expedition zeigt sich erstmals das enorme Durchhaltevermögen des Charles de Foucauld. Für seine wertvollen Forschungsergebnisse erhält Foucauld 1885 nach ihrer Veröffentlichung die höchste Auszeichnung der Französischen Geographischen Gesellschaft.
Das folgende Jahr ist für Charles ein Jahr der Unruhe, der Suche. Nach seiner Reise hatte sich Charles kurzzeitig mit einer jungen Katholikin verlobt, deren Familie in Nordafrika lebte. Diese Verlobung lässt er aber auf Anraten seiner Familie, vor allem auf das Drängen seiner Cousine Marie hin, wieder lösen. Seine Schwester heiratet in der Zwischenzeit Raymond de Blic, mit dem er später ein freundschaftliches Verhältnis haben wird.
Foucauld reist zwischen Frankreich und Afrika, wo er seine Forschungen fortführt, hin und her. In Afrika sucht er erneut nach Begegnungen mit dem Islam und beginnt, ihn mit dem Christentum zu vergleichen61. Sein Interesse am christlichen Glauben ist wieder aufgeflammt. Obwohl noch immer ohne Glauben, setzt er sich wieder mit ihm auseinander. Er bewundert den Glauben seiner Cousine; und diese wiederum versteht es, Charles klug und behutsam – mit ihrem eigenen Glaubensleben als Beispiel – erneut an den christlichen Glauben heranzuführen62. Ausschlaggebend ist hier besonders ein sechswöchiger Aufenthalt im Juli 1884 auf dem Landsitz der Moitessiers, der etwas, das Charles verloren glaubte, wiedererweckt63. Er beginnt zu beten: „Mein Gott, wenn Du wirklich da bist, gib, daß ich dich erkenne!“64.
Ende Oktober 1886 findet sein rastloser Geist endlich sein Ziel: am Tag seiner zugleich unspektakulären und spektakulären Bekehrung. Im Hause seiner Cousine hatte Charles einige Zeit zuvor Abbé Huvelin von der Kirche Saint-Augustin in Paris kennengelernt. Er fasst Vertrauen zu diesem ruhigen und verständigen Seelsorger, der sich Charles in keiner Weise aufdrängt, und möchte alle Fragen, die ihm auf der Seele brennen, mit diesem erörtern und diskutieren. Aus diesem Grunde besucht Charles Abbé Huvelin in seiner Kirche, doch dieser lässt sich auf keine Diskussionen ein, sondern bewegt Charles de Foucauld zur Beichte und zur Kommunion. Von diesem Augenblick an verändert sich das Leben Charles de Foucaulds vollkommen. So wird Charles in einem späteren Brief an Henri de Castries sagen: „Sobald ich glaubte, daß es einen Gott gibt, begriff ich, daß ich nur noch für ihn leben könne“65. Was zu Charles Bekehrung führte, waren keine großen Worte der Überzeugung, sondern der einfache gelebte und praktizierte Glaube, das, was ihn auch an den Muslimen schon so sehr fasziniert hatte66.
Im Hinblick auf die Thematik dieser Arbeit sei an dieser Stelle auf den beachtenswerten Umstand hingewiesen, dass nach all der Zeit, in der Charles de Foucauld Gott das erste Mal wieder begegnet, dies in der Eucharistie geschieht.
Die Wandlung, die sich nun in dem Menschen Charles vollzogen hatte, macht sich sogleich bemerkbar und zeigt ihre Konsequenzen. Zum einen wählt sich Charles Abbé Huvelin zu seinem Seelenführer, dem er von nun an alle wichtigen Entscheidungen zunächst vorlegen wird, zum anderen entschließt er sich, in einen Orden einzutreten. Bei all diesen anfänglichen Schritten hin in ein geistliches Leben wird Charles de Foucauld vor allem begleitet von einem Satz Abbé Huvelins, der ihn Zeit seines Lebens nie mehr verlassen wird: „Unser Heiland hat so sehr den letzten Platz eingenommen, dass nie jemand ihn hat streitig machen können“67. Huvelin warnt ihn jedoch vor übereilten Entschlüssen und rät ihm zu einer Pilgerfahrt ins Heilige Land. Dort besucht er alle heiligen Stätten und verbringt Weihnachten 1888 in Bethlehem. Nach seiner Rückkehr im Februar 1889 hat sich an seinem Entschluss nichts geändert, und nach einigen Exerzitien in französischen Klöstern tritt er am 16. Januar 1890 nach schmerzlicher Trennung von seiner Familie68 in das Trappistenkloster Notre-Dame des Neiges69 ein. Schon bald aber vermisst er hier die von ihm ersehnte Einfachheit und Strenge, so dass er im Juni in das Trappistenkloster Akbès in Syrien übersiedelt, das er für sich als besser geeignet ansieht. Charles schließt nun mit seinem weltlichen Leben gänzlich ab und tritt sowohl als Mitglied der Geographischen Gesellschaft als auch als Reserveoffizier zurück, seinen ganzen Besitz überträgt er seiner Schwester. 1892 legt er die einfachen Gelübde ab. Auf Geheiß der Ordensoberen beginnt Charles mit dem Theologiestudium, um Priester zu werden, widersetzt sich diesem Beschluss aber letztendlich und verlässt nach Einverständnis von Huvelin und des Generalabtes der Trappisten den Orden und wird von seinen einfachen Gelübden dispensiert. Charles de Foucauld fühlt sich zu einem Leben der Nachfolge des einfachen Lebens Jesu in Nazareth berufen und entfaltet erste Pläne hinsichtlich einer eigenen Ordensgründung vom Heiligsten Herzen. Er legt seine privaten Gelübde der Keuschheit, Armut und Besitzlosigkeit ab und lebt von 1897 an als Hausknecht der Klarissen in Nazareth in ärmlichsten Verhältnissen. Bis 1900 lebt er dort das verborgene Leben Jesu von Nazareth, ohne jedoch seinen innigen Wunsch nach einem eigenen Orden aus dem Blick zu verlieren. In der Zeit bis 1900 unternimmt er mehrere Reisen nach Jerusalem, plant den Berg der Seligpreisungen zu kaufen, lässt diesen Plan wieder fallen und entscheidet sich schließlich – mit Hilfe der Überzeugungskraft der Klarissen-Äbtissin – doch noch dazu, die Priesterweihe zu empfangen. Charles glaubt, auf diese Weise Jesus am besten verherrlichen zu können70. Zur Vorbereitung kehrt er nach Frankreich zurück und wird im Juni 1901 zum Priester geweiht. Kurz darauf lässt Charles de Foucauld sich im algerischen Beni Abbès nahe der marokkanischen Grenze nieder, um Jesus dort bekannt zu machen, wo man nichts von ihm weiß. Dort möchte er eine Bruderschaft errichten und baut so eine weitläufige Eremitage, da er fest mit künftigen Brüdern rechnet. Hier verfasst er ebenfalls seine Regel für die kleinen Brüder und Schwestern vom Heiligsten Herzen Jesu. Daneben fasst er konkrete Pläne für eine Missionierung der nordafrikanischen Wüste und begegnet erstmalig den Greueln der Sklaverei, gegen die er sein Leben lang einen erbitterten Kampf führen wird.
Im Jahre 1905 siedelt Charles de Foucauld ein letztes Mal um und baut sich im Hoggar nahe Tamanrasset eine kleine Niederlassung. Mitten unter dem Berbervolk der Tuareg führt der katholische Priester und Mönch ein Leben nach dem Evangelium. Er lernt ihre Sprache, von der er sagt, sie sei der Zugang zum Herzen dieses Volkes71, und arbeitet an einem Wörterbuch für Französisch-Tuareg und Tuareg-Französisch sowie an einer Sammlung von Gedichten und Liedern der Tuareg.
Charles de Foucauld unternimmt vom Hoggar aus noch zwei Reisen nach Frankreich, um für seine Bruderschaft zu werben, kehrt aber immer wieder allein zurück. Niemand schafft es, sein strenges Leben der Armut und des Verzichts auf sich zu nehmen.
1910 stirbt sein langjähriger Seelenführer Abbé Huvelin; und als nur ein paar Jahre später der Erste Weltkrieg ausbricht, bleibt auch das Gebiet des Hoggar nicht unberührt von den Ereignissen, die den Rest der Welt erschüttern. Es kommt zu Aufständen und Kämpfen. Dennoch will Charles die Tuareg gerade in dieser Situation nicht verlassen. Trotz des kleinen Forts, in das er sich zurückgezogen hat, kommt es am 1. Dezember 1916 zu einem Überfall auf Charles de Foucauld, bei dem ihm – mehr durch ein böses Unglück als durch willentliche Absicht – von einem der Räuber in den Kopf geschossen wird. Charles de Foucauld stirbt auf der Stelle im Alter von 58 Jahren.
1.2 Aspekte eucharistischer Frömmigkeit und deren Sitz im Leben von Charles de Foucauld
Am 16. Januar 1890 tritt Charles de Foucauld in das Trappistenkloster Notre-Dame des Neiges ein und erhält den Namen Bruder Marie-Albéric. Schon im August 1888 hatte er mit seiner Cousine Marie ein Trappistenkloster besucht, und es waren besonders die Einfachheit und Armut der Mönche, die ihn angezogen hatten. Während der darauffolgenden Exerzitien und auf seiner Pilgerreise durch Jerusalem nehmen die Vorstellungen von Charles über sein künftiges Leben konkretere Formen an: Es ist das verborgene Leben Jesu in Nazareth, das ihn festhält. Foucaulds Verlangen, den Weg der Nachahmung Jesu vor allem in der Armut zu verwirklichen, führt dazu, sich für den Orden der Trappisten zu entscheiden, der in seiner Armut und Strenge andere Orden übertrifft.
Auf die Frage des Warum – denn zweifellos bedeutet die Trennung von seiner Familie und seinen Freunden ein großes Opfer für Charles – kann er nur antworten: „Aus Liebe, aus reiner Liebe“72.
1.2.1 Bruder Marie-Albéric bei den Trappisten (1890-1897)
Foucaulds Leben bei den Trappisten ist nach einem klösterlichen Rhythmus von Gebet und einfacher Handarbeit geordnet. Doch schon bald erfüllt das Kloster in Frankreich nicht mehr seinen Wunsch nach unbedingter Armut und Strenge, so dass er in die Niederlassung der Trappisten in Akbès in Syrien wechselt. Die politische Situation dort ist äußerst unstabil. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Verfolgungen der armenischen Christen durch die Türken. Brandschatzungen, Plünderungen und Morde beherrschen das Umfeld des Trappistenklosters und rufen Charles de Foucauld auch in eine besondere Verantwortung der Nächstenliebe.
Foucaulds Art der Nachahmung der Existenz Jesu ist in dieser ersten Phase seines Daseins als Mönch vorrangig eine wortgetreue, betrachtende und kontemplative.
1.2.1.1 Demut: Verähnlichung mit dem bis in die Unscheinbarkeit der einzelnen Hostie hinabsteigenden Sohn
Es ist besonders jener Satz Huvelins, Jesus habe so sehr den letzten Platz eingenommen, dass dieser ihm von niemandem mehr streitig gemacht werden könne, der das Fundament der Spiritualität Charles de Foucaulds bildet. Diese Spiritualität aber ist von Beginn an vor allem in der eucharistischen Anbetung verankert und führt zu einer inneren Haltung der Demut, die Foucauld wie eine notwendige Konsequenz aus der Erfahrung des eucharistischen Brotes erscheint. Was er zum Zeitpunkt seiner Bekehrung schon anfanghaft erfuhr, erfährt er im Laufe der Zeit immer deutlicher: Der Gott, der ihm in der heiligen Eucharistie begegnet, ist niemand anderes als der menschgewordene und erniedrigte Sohn Gottes. Dieser gedemütigte Jesus ist es, dessen Nachfolge Foucauld verwirklichen möchte.
In diesem Zusammenhang ist eine Predigt Huvelins von nicht geringer Bedeutung, deren Inhalt Charles sicherlich mit beeinflusst haben wird73. In ihr charakterisiert Huvelin die Eucharistie als das Geheimnis des Schenkens und weist darauf hin, dass dieses einzigartige Geschenk Gottes seinen inneren Grund darin hat, den Menschen selbst – also den Beschenkten – zu befähigen, sich selbst zum Geschenk an Gott und die Mitmenschen zu machen. Der Mensch ist so nicht dazu angehalten, nur etwas von sich zu schenken, sondern ganz und gar sich selbst. Huvelin lädt zur beständigen Betrachtung dieses Geschenkes ein: Denn wenn Jesus sich immer wieder dem Menschen schenkt, wenn er immer wieder diesen Weg des Abstiegs auf sich nimmt, wie können wir diesen Weg dann nicht wagen? In der Eucharistie – so Huvelin – ist Jesus bleibend gegenwärtig und lehrt uns die eigene Hingabe an Gott. Niemals wird der Mensch den Grad an Erniedrigung erreichen, den Jesus erlangte, aber er muss ihm stets als Anspruch und Ziel innewohnen und ihn dazu treiben, es immer wieder erneut zu versuchen. Den Opfergeist, die Selbstverleugnung, die Erniedrigung nennt Huvelin unbedingte Voraussetzungen, um Gutes zu tun.
In diesem Verständnis seines Seelenführers lässt sich viel für Charles de Foucauld Grundlegendes wiederfinden. Das erste und größte Opfer, das Charles in diesem Sinne interpretiert, ist die Trennung von seiner Familie: „Das Opfer ist nichts anderes als der höchste Liebeserweis“74. Was er mit diesem Opfer getan hat, ist nichts anderes, als auf das Geschenk Gottes in der Gnade der Eucharistie zu antworten und sich selbst zu schenken. Der lateinische Begriff hostia bedeutet ja nichts anderes als das Opfer, und indem Foucauld sich auf das Opfer der Eucharistie, also auf den in der Hostie gegenwärtigen und hingegebenen Christus, einlässt, erlangt er auch den Opfergeist des im Brote vorhandenen Christus. Der Verzicht auf die Seinen ist somit der erste verwirklichende Schritt einer Haltung, die ihren Grund und ihre Quelle in der eucharistischen Anbetung findet: der Demut.
Es ist die Zeit bei den Trappisten, in der der Tabernakel – so Jean-Francois Six – der Ort der großen Vertrautheit mit Jesus wird75, der ihm die völlige Hingabe an Gott ermöglicht. Immer wieder sucht er die Nähe des Allerheiligsten und verbringt viele Stunden im Schweigen, den gedemütigten Jesus betrachtend. Im eucharistischen Brot erkennt Charles de Foucauld Jesus als denjenigen, der sich ganz klein gemacht hat. Er, der mächtige Sohn Gottes, ist so unscheinbar wie ein Stück Brot und ist gerade so das der Welt geschenkte Heil. Der Abstieg, den Christus unüberbietbar in der Inkarnation vollzogen hat, findet immer wieder von Neuem in der Eucharistie statt. Unscheinbar und klein nimmt Jesus dort den letzten Platz ein und gibt sich dem Menschen hin zu dessen Heilung. Foucauld lässt sich in der eucharistischen Anbetung auf die Kleinheit Jesu im Brote ein, zugleich aber bedeutet gerade dieses unscheinbare Stück Brot für Charles eine unüberbietbare, gegenwärtige Nähe Gottes. Es ist also letztendlich die Kleinheit, die Verborgenheit, in der sich die ganze Größe Gottes offenbart. Diese Verborgenheit Jesu wird zum Ursprung und zum Ziel der Demut Foucaulds. Aus der Erkenntnis der Erniedrigung Jesu heraus wird Foucauld befähigt, selbst demütig zu sein, sich klein zu machen, sich zu erniedrigen76.
Eine kritische Beobachtung könnte vermuten, Charles de Foucauld offenbare hier ein gestörtes Verhältnis zum eigenen Sein, zur eigenen Person. Doch muss gerade aus den gewonnenen Schlussfolgerungen heraus konstatiert werden, dass die Haltung Foucaulds eben nicht aus einer Angst vor sich selbst, den eigenen Fähigkeiten oder einem anderweitig gestörten Selbstbewusstsein resultiert, sondern aus dem tiefen Glauben entspringt, es dem, von dem man sich unbedingt geliebt fühlt, gleich zu tun; sich zu bemühen, ihm immer ähnlicher zu werden, da man schuldig ist, das zu geben, was man selbst empfängt: „Laßt uns Gott lieben, weil Er uns zuerst geliebt hat…Ihn, der so schön, so liebenswert ist, der sich selber vollauf genügt und sich doch herabgelassen hat, uns […] eine solche Liebeserklärung zu machen…Beantworten wir diese Liebeserklärung, wenden wir die darin enthaltene Lehre an, indem wir, Ihn nachahmend, unsere Liebe erklären“77.
Daran zeigt sich ebenfalls, dass Demut für Charles de Foucauld nicht einfachhin Demut ist: Demut muss eine liebende sein, ansonsten bleibt sie statisch und für sich. Der Beweggrund Jesu, den letzten Platz einzunehmen, war seine Liebe zur Welt und zu den Menschen. Auf diese Liebe aber will geantwortet werden: Was in der Anbetung für Foucauld geschieht, ist nicht bloß ein einfaches Sein vor Gott, sondern ein Ereignis zwischen Gott und dem Anbetenden. Es ist eine Bewegung der Liebe, ein stetes Empfangen und Schenken. Jene Gegenseitigkeit wiederum versetzt Charles de Foucauld selbst in die Lage, sich die Haltung der Demut anzueignen, basierend auf einem in der Anbetung erfahrenen unendlichen Vertrauen in Gott. Denn wen die Konsequenz der Liebe so sehr an den letzten Platz gestellt hat, der muss wahrhaftig sein78. Diesen letzten Platz hat Jesus nicht nur während seines Lebens unter den Menschen eingenommen: In der heiligen Eucharistie bleibt er für immer gegenwärtig als der Erniedrigte, der Kleine, Unscheinbare und Verborgene. Diese Verborgenheit, die den „letzten Platz“ des inkarnierten Gottessohnes kennzeichnet, ist dennoch alles andere als die Verhüllung des Verhältnisses des innertrinitarischen Sohnes zum Vater, sondern gerade dessen Offenbarung. In der Verborgenheit von Nazareth offenbart sich die ganze Fülle Gottes.
Das Dasein vor dem Tabernakel bringt Charles de Foucauld so sehr in die Gegenwart Jesu, in die ihn erfüllende Nähe Gottes, dass er nichts anderes mehr braucht, dass all sein Verlangen – bis auf jenes nach Jesus – gestillt ist. Dieses Verlangen befähigt ihn, sich selbst – angesichts der ungeheuren Nähe Jesu Christi – leer und demütig zu machen, keiner Dinge mehr zu bedürfen79. Die Nähe Christi im Tabernakel kann ihm genügen. Alle menschlichen Bedürfnisse – ja sogar die grundlegendsten – verlieren an Bedeutung. Obwohl Gott in der Eucharistie in der Verborgenheit des Brotes gegenwärtig ist80, nimmt er dennoch einen derart großen Raum ein, dass Foucauld ganz befreit wird von dem Bestreben, sich selbst einen Sinn geben zu müssen. Schon in der frühen Zeit seines Ordenslebens macht Foucauld diese tiefgreifende Erfahrung. Er schreibt in Briefen an seine Cousine Marie von einem tiefen Frieden, der ihm seit einiger Zeit zuteil wird und der ihn einen unerwarteten Trost erfahren lässt: „Mir hat er, meiner großen Schwäche wegen, nur Frieden geschenkt…einen ganz unerwarteten Frieden“81. In seiner Demut angesichts der Größe Gottes kann sich Foucauld nur klein und unscheinbar machen, gleichzeitig aber weiß er sich unendlich beschenkt und geliebt. Hier erfährt er sich so als immer schon wert- und sinnvoll, ohne sich als dies beweisen zu müssen. Demütig kann letztlich nur jemand sein, der schon von etwas anderem außerhalb seiner selbst erfüllt ist, sich also nicht selbst füllen muss, sich nicht selbst den Sinn des eigenen Daseins geben muss.
1.2.1.2 Gehorsam: Christusförmige Leibwerdung
In den Jahren seiner Zugehörigkeit zum Orden der Trappisten lässt sich der Aspekt des Gehorsams besonders gut veranschaulichen. Als Bruder Marie-Albéric steht Charles de Foucauld in einer Verbindlichkeit, wie sie der eigentlich so freiheitsliebende und selbstbestimmte Franzose bisher kaum erlebt hat. Selbst das Militär vermochte ihm nicht eine dauernde Fügsamkeit abzuverlangen, nun aber hat er sich freiwillig an eine Gemeinschaft gebunden, für die der Gehorsam eine tragende Rolle im ständigen Miteinander hat. Und mehr als nur einmal gesteht Foucauld, wie schwer es ihm oftmals fällt zu gehorchen. Exemplarisch zeigt sich dies vor allem an seinem Widerstreben, dem Wunsch seines Ordensoberen, er möge doch Theologie studieren und Priester werden, nachzukommen. Es widerstrebt ihm deshalb, weil er darin ein Leben in der Erfüllung des „Nazaret-Ideals“ gefährdet sieht, kommen doch dem Priester Gnadengaben zu, die ihn eben nicht in die Verborgenheit von Nazareth stellen, sondern in die Öffentlichkeit des geistlichen und weltlichen Lebens82. Dennoch weiß er um seine Gehorsamspflicht, welche noch dazu von seinem beständigen Seelenführer Huvelin bekräftigt wird, denn dieser rät ihm dazu, dem Wunsch seines Ordensoberen Folge zu leisten.
Daneben beginnt in Syrien Foucaulds Vorstellung von der Gründung eines eigenen Ordens, in welchem das verborgene Leben Jesu in Nazareth wahrhaftig gelebt werden kann bzw. immer konkreter werden kann. Immer stärker wird für ihn das Gefühl, seinen Platz – den letzten Platz – bei den Trappisten nicht finden zu können. Auch hier lautet Huvelins Rat, keine voreiligen Entschlüsse zu fassen und Geduld zu haben, bevor er seinem Schützling nach langer Zeit schließlich doch die Erlaubnis erteilt, den Orden der Trappisten im Einverständnis mit den Ordensoberen zu verlassen83. Auch wird von seiner Priesterweihe vorerst abgesehen. Zunächst wird Foucauld für zwei Jahre nach Rom zum Theologiestudium geschickt und damit sein Gehorsam auf eine lange Probe gestellt. Und als eine solche deutet er ihn auch: Im Gehorsam entscheidet sich die Liebe für Gott. Letztendlich ist Gehorsam nichts anderes als eine notwendige Konsequenz der vollkommenen Hingabe. Aufgrund der Liebe zu dem, der sich ganz hingegeben hat, schafft es Foucauld, sich selbst völlig zurückzunehmen, vorbehaltlos zu gehorchen. Der Gehorsam hat sich allein nach der je größeren Liebe zu richten; und in dem Wissen um das eigene Geliebtsein und um das Wohlwollen Gottes ist es nur selbstverständlich, sich seinem Willen, der sich besonders im Rat der Seelenführer kundtut, zu fügen: „Wer jederzeit vollkommenen Gehorsam leistet, hat auch jederzeit die vollkommene Liebe. Wer jeden Augenblick vollkommen gehorcht, tut jeden Augenblick das Vollkommenste, denn das Vollkommenste ist das, was aus der vollkommenen Liebe stammt“84. Schlussendlich ist der Gehorsam eine Antwort auf das Geschenk der allgegenwärtigen Nähe des menschgewordenen Jesus im eucharistischen Brot und wird dadurch zur äußeren, sichtbaren Form der inneren Haltung der Demut. In der Anbetung, dem in die Gegenwart Gottes gerufen Sein, erfährt sich Foucauld als unbedingt geliebt; geliebt werden heißt aber auch, dass es jemanden gibt, der es gut mit einem meint und so ist es für Charles de Foucauld nur natürlich, diesem Jemand zu gehorchen. Gehorsam kann demnach nur in der Symbiose mit der Demut funktionieren und gründet in ein und derselben Erfahrung innerhalb der eucharistischen Anbetung. Der inkarnatorisch in die Hostie hinabsteigende Sohn des trinitarischen Gottes erfüllt in vollkommenem Gehorsam den Willen des Vaters. Wie also die eucharistische Gestalt des Erlösers den Gehorsam des Sohnes gegenüber dem Vater ausdrückt, so ist für Foucauld der Gehorsam die christusförmige Leibwerdung des Glaubens. Im Gehorsam gibt sich Foucauld dem hin, von dem er alles empfängt; ganz so wie der empfangende Sohn sich dem Vater schenkt. Foucauld kann in seiner nicht nur spirituellen, sondern zugleich leibhaften Hingabe an den Willen Gottes am Geheimnis der Inkarnation partizipieren. Letztendlich ist der Gehorsam ein weiterer Schritt Foucaulds hin zur Verähnlichung mit dem eucharistischen Christus.
1.2.2 Hausknecht bei den Klarissen in Nazareth (1897-1900)
Nachdem Charles de Foucauld am 25. Januar 1897 von Dom Wyart die Erlaubnis erteilt bekommt, die Trappisten verlassen zu dürfen, fällt seine Wahl auf das schon lange ersehnte verborgene Leben von Nazareth. Nazareth, das bedeutet das unscheinbare, einfache und arme Leben eines Zimmermanns. Unerkannt und geprägt von schlichter Handarbeit, fern von jeder Selbstdarstellung und den Würden eines geachteten Standes. Ein solches niedriges Dasein wird von nun an von Foucauld mit aller Kraft verfolgt. Und er verfolgt es nicht nur für sich selbst, sondern für eine Gemeinschaft von Brüdern, für deren Zusammenleben er konkrete Vorstellungen entwickelt, die er in selbstverfassten Regeln festhält. Er orientiert sich dabei zwar an der Regel des heiligen Benedikt, doch will er bewusst auf jedweden intellektuellen Anspruch verzichten und gestaltet daher das Leben der Brüder äußerst einfach, damit es sich in seinen geistlichen Formen als einladend für jedermann darstellt. Die „Einsiedler vom Heiligsten Herzen“ sollen in kleinen Gruppen das Los der Armen teilen, in ihrer Lebensgestalt wirklich arm, brüderlich und unterschiedslos offen für alle sein85.
Foucauld hat den Wunsch, Hausknecht in einem Kloster im Orient zu werden; und so reist er ins Heilige Land, um bei den Klarissen in Nazareth den Ort zu finden, der ihm zur Verwirklichung seines „Nazaret-Ideals“ angemessen erscheint. Dort nennt er sich von nun an Bruder Karl und verrichtet vor allem anstehende Haus- und Gärtnerarbeiten. Er weigert sich, ein geräumiges Gärtnerhaus der Klosteranlage in Anspruch zu nehmen und wohnt stattdessen im Geräteschuppen des Gartens der Schwestern. Seine Kleidung ist ärmlich, er geht fast immer barfüßig und schläft auf dem harten Steinboden seiner Behausung. Zugleich stammen aus dieser Zeit viele seiner handschriftlich verfassten Betrachtungen über die Heilige Schrift, die Aufschluss darüber geben, wie lebendig das Evangelium im täglichen Leben des Bruders war.
Als Charles de Foucauld kurz vor seiner Abreise ins Heilige Land von seinen einfachen Gelübden bei den Trappisten dispensiert wurde, hatte er noch am selben Tag zwei eigene Gelübde abgelegt: das der Keuschheit und das der Armut.
Sein Leben bei den Klarissen in Nazareth zeigt in besonderer Weise, wie sehr der ehemalige Lebemann zum Verzicht fähig wurde und wie radikal arm er sich zu machen vermochte. In Nazareth verwirklicht Foucauld zusehends die Kleinheit und Niedrigkeit Jesu gleichsam in und an sich selbst. Sogar seine Gestalt verkörpert nun vollends seine innere Haltung; denn sie zeigt einen schmächtigen und kleinen Charles de Foucauld. Mit Freuden und Dankbarkeit nimmt er alle Leiden und Erniedrigungen auf sich, um seinem Jesus immer ähnlicher zu werden. Der Satz „kleiner, immer kleiner“ wird zum Leitfaden seiner gelebten Nachfolge.
1.2.2.1 Armut: Vorbereitung auf die ewige Kommunion
Foucaulds Wunsch, zusammen mit Jesus den „letzten Platz“ einzunehmen, gewinnt in seiner Zeit bei den Klarissen eine fassbare und sichere Gestalt. Es ist in besonderer Weise die gewählte Armut, der Verzicht auf alle Annehmlichkeiten und Anerkennungen, die von seiner Liebe zum Herrn sprechen. Foucauld, der ehemals bis zu 4000 Francs monatlich ausgab86, versteht es mit einem Mal, sich völlig frei von allen materiellen Bedürfnissen zu machen. Das Begehren nach Genuss und luxuriösem Glanz ist ihm fremd geworden, sogar das Notwendige wird von ihm nach Möglichkeit abgewiesen.
Auch hier stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen dieser gelebten Armut und der eucharistischen Anbetung gibt. Erhält Charles de Foucauld im Akt der Anbetung den Ruf zur radikalen Armut? Ist in der Anbetung des Mönches ein Erkennen zugrundegelegt, das ihm die äußerste Armut abverlangt? In einer Betrachtung über Lk 12,34 schreibt er: „Hüten wir uns, unser Herz an irgend etwas Geschaffenes, materielle oder geistige Güter, Leib oder Seele zu hängen…Machen wir unser Herz leer, leer von allem, was nicht das Eine ist…Nichts soll unser Schatz sein außer Gott!“87. Dieser Satz macht anschaulich, um was es Foucauld eigentlich geht: Die Armut muss eine ganzheitliche sein. Es genügt nicht, auf finanziellen Besitz zu verzichten oder dauerndes Fasten zu üben. Das Herz muss wirklich leer werden, leer von allem, das der Fülle Gottes im Wege stehen würde88. Diese Fülle aber – das „Eine“ – ist nicht bloß ein abstrakter philosophischer Begriff, sondern eine Wirklichkeit, der Foucauld im eucharistischen Brot wahrhaftig begegnet. Foucauld weiß nicht nur um die allen Raum umfassende Bedeutung des Begriffes Gott, sondern er erfährt dessen Fülle als real gegenwärtig in der heiligen Eucharistie: „Aber die beste, die wahre Unendlichkeit, der wahre Friede ist zu Füßen des göttlichen Tabernakels. Dort ist unser ganzes Gut, nicht nur bildlich, sondern in Wirklichkeit; unsere Liebe, unser Leben, unser Alles, unser Friede, unsere Seligkeit; dort ist unser ganzes Herz und unsre ganze Seele, unsre Zeit und unsre Ewigkeit, unser Alles“89.
Das Außergewöhnliche jedoch ist, dass Charles die in der Eucharistie anwesende Fülle Gottes aus der Erniedrigung des Gottessohnes heraus sieht. Das Allerheiligste offenbart den hinabgestiegenen Jesus, der in der Armut eines Zimmermannes aus Nazareth unter den Menschen gelebt hat und sich aus Liebe zu ihnen vollkommen hingegeben hat. In der Unscheinbarkeit des Brotes erkennt er auch dessen Armut, die die Gefahr birgt, dass man jenes Brot, das das Heil der Welt ist, zu schnell übersieht. Foucaulds gelebte Armut kann mitunter als ein – wenn nicht sogar als das – Zeichen seiner Erfahrung des hinabgestiegenen Sohnes angesehen werden. Vor dem Allerheiligsten erkennt er die reale Gegenwart Jesu Christi und – und das ist der Schlüssel seiner Wahl – er erfährt die ihm geschenkte Liebe des Gottessohnes. Diese Liebe aber will mit aller Kraft erwidert werden, und wieder ist es die Gleichgestaltung mit dem Geliebten, die notwendig aus der bejahenden Antwort auf die Liebe Jesu folgt: „Armut! Die Armut von ganzem Herzen umarmen. Der Reichtum ist nicht nur ein lästiges Gepäckstück, sondern auch eine Gefahr: er läßt sich schwer mit der vollkommenen Liebe zu Gott, zu Jesus vereinen, weil er der Nachahmung Jesu gerade entgegengesetzt ist“90. Foucauld bringt diesen Verzicht auf, weil er sich letztendlich nicht arm weiß. In der Entsagung des Reichtums der Welt steckt ein Ja zur Liebe Gottes, die allen endlichen Reichtum übertrifft. So kann Foucauld schon während seiner irdischen Geschichte in der eucharistischen Anbetung teilhaben an der ihn nach dem Tode erwartenden Fülle Gottes, die allein genügt. Die Anbetung bringt ihn schon jetzt antizipativ in die versprochene endgültige Nähe Gottes. Man könnte mit Heidegger sagen, es beginnt ein Vorlauf auf den Tod, den Foucauld äußerlich vorwegnimmt, indem er sich schon jetzt allen irdischen Gütern entzieht, sich vollkommen arm und leer macht, um wie im Tod mit nichts als leeren Händen vor Gott zu stehen. Der Tod kann so als die letzte, vollkommene und ewige Kommunion bezeichnet werden, in dem das Bei-Gott-Sein des Anbetenden seine unbedingte und äußerste Form annimmt. Stets bereit sein zu sterben und stets bereit sein zu kommunizieren – das Angebot Gottes zu bejahen –, ist ein und dasselbe. Dass diese vorläufige Teilnahme, der vollkommene Verzicht, immer nur rudimentär bleiben wird, ist Charles de Foucauld bewusst, ist er doch zum Beispiel nicht in der Lage, alle Geschenke der Nonnen abzulehnen. Daher ist die wirkliche Armut, auf die es ankommt, die Armut des Herzens. Diese verwirklicht sich zwar in der konkreten, materiellen und also äußerlich sichtbaren Armut, doch bleibt sie immer nur eine Folge der eigentlichen Armut des Herzens: „Armut. Im Geist auf alles verzichten, im Herzen von allem losgelöst sein, arm im Geist sein, leer von aller Anhänglichkeit, all das ist unerlässlich, wenn man Jünger Jesu sein will…Materiell auf alles verzichten, materiell arm sein, das ist der notwendige Ausgangspunkt sowohl für die Armut im Geiste als auch für die Nachfolge Christi“91.
Dieser Schwerpunkt auf der Armut des Herzens bewirkt ebenfalls, dass Foucauld nicht dahin geht, die Armut zu verherrlichen oder gar als Anspruch an alle Menschen zu universalisieren92. Im Gegenteil: Gerade in der eucharistischen Erfahrung des alle Menschen liebenden Jesus Christus wird Foucauld die Erkenntnis zuteil, dass aus diesem Geschenk nicht nur die Gottesliebe, sondern auch die Nächstenliebe folgen muss. Eine Nächstenliebe, die verwirklicht werden will, die die Liebe Gottes und seine Sorge um die Menschen auch mittels der Hilfe materieller Güter sichtbar macht. Diese Konsequenz der liebenden Sorge um die Mitmenschen wird Foucauld vor allem in seiner späteren Zeit bei den Tuareg zum Anspruch werden und dazu führen, dass er sich selbst auch in jeglicher Aktion, in allem Tun, leer machen wird; damit er fähig wird, sich selbst aufzuopfern für seinen Nächsten.
Charles de Foucauld genügt der Reichtum, den er im Tabernakel vorfindet93. Ihm gegenüber werden alle anderen Güter bedeutungslos und verzichtbar. In ihm findet er alles, was er braucht: die ungeheure Fülle Gottes, die Gnade seiner Nähe. Dieser Reichtum, mit dem er sich unendlich beschenkt weiß, befähigt ihn zur materiellen Armut: „Laßt uns nicht Sättigung in den Dingen dieser Welt suchen, weder in materiellen Gütern noch in sinnlich wahrnehmbaren, noch in geistigen Gütern: nicht in irgendeinem Geschöpf noch in irgend etwas, was nicht Gott ist. Je leerer wir sind von allem, was nicht Gott ist, um so mehr können wir von Gott erfüllt und gesättigt werden“94.
1.2.2.2 Erniedrigung: Befreiung vom Wahn der Autonomie
Ein Moment, an dem Foucaulds konsequente Nachahmung Jesu besonders deutlich wird, ist sein Bestreben nach beständiger Selbsterniedrigung. Die Selbsterniedrigung ist im Gegensatz zur Haltung der Demut ein Geschehen. Dennoch ist sie auf engste Weise mit ihr verknüpft: Sowie zur Demut die bewusste Zurücknahme des eigenen Ichs gehört, so ist es auch für ein Leben in Niedrigkeit unerlässlich, sich selbst ganz und gar zu befreien von dem Wunsch, durch große Taten, durch „ein großes Leben“ Selbstbestätigung zu finden. In der Selbsterniedrigung Foucaulds kommt ein weiteres Mal zum Ausdruck, wie wenig er sich für sich selbst engagiert und um wieviel mehr für denjenigen, von dem er alles empfängt. Foucaulds Selbsterniedrigung, die er durch schwere körperliche Arbeit und durch den bedingungslosen Verzicht auf Annehmlichkeiten, wie etwa gute Schuhe, robuste Kleidung, ein weiches Lager etc., erwirkt, darf nicht als masochistische Neigung verdächtigt werden. Foucauld versteht seine Erniedrigung nicht als Bestrafung seiner Sünden. Motivierendes Moment ist allein die radikale Nachahmung Jesu; dessen, der selbst so sehr gelitten hat und dennoch nicht aufgehört hat, die Menschen zu lieben: „Das alles hast Du aus Liebe erduldet, mein Gott, uns zuliebe, um uns zu heiligen, um uns durch den Anblick Deiner unerhörten Liebe zum Lieben zu bringen, uns durch Dein Beispiel zu bewegen, daß wir aus Liebe Leiden auf uns nehmen“95.
Charles de Foucauld versteht es, Widrigkeiten und Leiden derart hinzunehmen, dass er sie nicht nur geduldig ertragen kann, sondern auch als direkten Beweis seiner Liebe zu Christus aktiv (mit)vollziehen kann. So erzählt Kurt Benesch in seinem biographischen Roman über Charles de Foucauld, dass es sich nicht selten begab, dass Bruder Karl in den Straßen von Nazareth von einigen Halbwüchsigen ausgelacht und verspottet wurde. Obwohl Foucauld um diese Ungerechtigkeit weiß, ist er gleichzeitig voller Freude, dem Herrn in seiner Nachfolge so nahe zu kommen, dass er, wie er, öffentlich gedemütigt und erniedrigt wird96. Auszuhalten, was Jesus zu ertragen hatte, zu empfinden wie dieser, ist für ihn die angemessene Antwort auf die geschenkte Liebe Gottes. Zugleich schämt er sich jedoch auch schon für die empfundene Freude, weiß er doch, dass sie die Vollkommenheit des Kleinseins schmälert.
Man wird vorsichtig sagen können, Foucauld habe es regelrecht darauf angelegt, Demütigung und Erniedrigung von außen zu empfangen, spricht er doch davon, das Leid suchen zu müssen. Dieses Suchen geschieht jedoch einzig aus dem Motiv der liebenden Nachahmung heraus: „Nicht nur stets danach verlangen, sondern sie in dieser Welt stets suchen, denn sie bilden einen Teil der Ähnlichkeit mit Jesus, um die wir ständig bemüht sind (denn solche Ähnlichkeit ist ein natürliches Bedürfnis der Liebe und eine Bedingung der Vollkommenheit auf Erden)“97.
In keiner Weise sucht er nach Bestätigung seiner selbst oder dessen, was er tut. Alles, woran ihm gelegen ist, ist, wie der Herr in Nazareth unerkannt zu bleiben. Aus diesem Grund verrichtet er im Kloster der Klarissen bewusst und ausschließlich die niedrigsten Arbeiten. Darin lässt sich erneut der alles entscheidende Wille Foucaulds wiedererkennen: Diese gewöhnlichen Arbeiten nehmen ihm nämlich keinen Ruhm weg, sondern ermöglichen ihm die fortdauernde Betrachtung und das ununterbrochene Gebet, das ständige Bei-Gott-sein. Sie geben ihm letztendlich etwas, das in seinen Augen weitaus mehr Wert hat als jede bezahlte Leistung.
Auch hier ist es die Zeit vor dem Tabernakel, die ihn davon abhält, etwas Großes durch eigenes Machen für sich selbst herzustellen. Das Größte, was er je besitzen wird, befindet sich unmittelbar vor ihm: das eucharistische Brot. Die Größe des Lebens, den Wert eines jeden Lebens gibt man sich selbst so wenig wie das Leben selbst. Nichts vermag einem unbedeutenden Menschenleben Größe zu geben außer Gott. In der Wirklichkeit der Eucharistie, in welcher der Wille Gottes, den Menschen unwiderruflich anzunehmen, erfahrbar wird, zeigt sich für Foucauld zugleich die Nichtigkeit menschlicher Anstrengung. Das Einzige, was dem Menschen Zukunft geben kann, ist die geschenkte Liebe des hinabgestiegenen Sohnes. Und hier beginnt der aktive, initiative Teil des Menschen innerhalb der Beziehung mit Gott: „Wer absteigt, ahmt mich nach[…] wer absteigt, wandelt auf meinem Weg und deshalb in der Wahrheit, und er befindet sich am besten Platz, um das Leben zu gewinnen und es den andern zu geben“98. In der eucharistischen Anbetung nimmt Charles de Foucauld den Anspruch wahr, der mit diesem ungeheuren Geschenk einhergeht. Eine erwidernde Liebe, die logischerweise dazu führen muss, die Art Gottes, in der er sich dem Menschen offenbart hat, nachzuahmen. Dann nur kann die dargebotene Liebe Gottes wirklich an ihr Ziel kommen. Denn nur wer sich selbst ganz zurücknimmt, wer sich leer macht und erniedrigt, das heißt nichts für sich selbst, für das eigene Ego, den eigenen Stolz oder das eigene Lob zurückbehält, nur der kann sich von dieser Liebe selbst bestimmen lassen. Die Erniedrigung verliert somit ihren Schrecken und wird wünschenswert, weil sie frei macht, Christus in sich aufzunehmen. Charles de Foucauld kann sich klein und niedrig machen, weil ihm in der eucharistischen Anbetung der erniedrigte, verkannte Jesus Christus begegnet, er gleichzeitig aber darum weiß, dass gerade die unüberbietbare Erniedrigung am Kreuz das in der Liebe mitgegebene Heil zur Folge hat. Es ist die Größe des Leidens Jesu, die Foucauld eben auch zugleich die Größe seiner Liebe und ihres endgültigen Triumphes zeigt. Das Leiden Christi wird somit nicht von ihm angeprangert, sondern angenommen als Zeichen seiner Liebe und seines Gehorsams zum Vater, und im eigenen Leiden mitvollzogen. Die Erniedrigung und das Leiden Jesu stehen für ihn daher an der richtigen Stelle und haben ihren Grund: Die Liebe Jesu und sein Leiden bedingen sich insofern, als das Leiden Jesu zum direkten Ausdruck seiner Liebe wird. Aus diesem Verständnis heraus deutet Foucauld sein eigenes Leiden und das der Menschheit99. Das aktiv getragene Leid und die eigene Erniedrigung bieten eine Möglichkeit, die Liebe zu Gott auszudrücken, sie an sich wirklich werden zu lassen100. In diesem Kontext tritt dann ebenfalls Foucaulds Wunsch nach dem Opfer seines Lebens, dem Märtyrertod, in Erscheinung. Denn er weiß, dass diese letzte Form der Hingabe die größte ist, die er zu geben imstande ist.
Charles de Foucauld will sich sein Heil nicht verdienen. Das Heil, die Liebe Gottes ist von Anfang an ungeschuldet und vor aller Gegenliebe der Menschen. Das wird ihm in aller Deutlichkeit im Dasein Jesu Christi in der heiligen Eucharistie bewusst. Dort schenkt sich Gott dem Menschen immer schon, ohne eine Antwort erhalten zu haben. Dies macht es aber nur um so notwendiger, dem daraus entstehenden Anspruch gerecht zu werden101.
1.2.3 Marabut in der saharischen Wüste (1901-1916)
Nachdem die Klarissen-Äbtissin von Jerusalem Charles de Foucauld davon überzeugt hatte, dass es seinen Ordensgründungsplänen förderlich sei, Priester zu werden, ist für ihn klar, dass er die Nachfolge Jesu nur vervollkommnen kann, wenn er das Messopfer darbringen und die Sakramente spenden kann. Foucauld kehrt 1900 nach Frankreich zurück, um die Priesterweihe zu empfangen. Während der Vorbereitungsmonate reift in ihm der Plan, das verborgene Leben Nazareths in Nordafrika zu führen, in der Absicht, Jesus all denen, die ihn nicht kennen, bekannt zu machen. Nach seiner Priesterweihe siedelt er über nach Beni-Abbès, einer kleinen Oasen- und Garnisonsstadt am Rande der Sahara nahe der marokkanischen Grenze; er errichtet dort eine weitläufige Eremitage in der festen Hoffnung, in Zukunft nicht mehr allein zu sein.
Hier entdeckt Foucauld nun die zweite Verwirklichungsform von Nazareth: Der Tag ist zwar noch geprägt von ausgedehnten Gebetszeiten, die er vor dem Allerheiligsten kniend verbringt, aber mehr und mehr öffnet sich Charles de Foucauld der saharischen Bevölkerung. Er kann angesichts vieler Missstände, für die er die französische Regierung in der Verantwortung sieht, nicht mehr schweigen und lässt sein Ideal der Nachfolge zunehmend in die Aktion münden. Leidenschaftlich richtet sich Foucauld gegen die geduldete Sklaverei und schreibt mehrere Briefe an das Parlament in Paris. „Man muß sagen, oder durch einen Zuständigen sagen lassen: «non licet», «vae vobis hypocritae», ihr setzt auf eure Briefmarken und überallhin die Worte «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Menschenrechte» und schmiedet die Ketten der Sklaven; ihr verurteilt Banknotenfälscher zur Galeere und erlaubt, dass Kinder ihren Eltern geraubt und öffentlich verkauft werden; ihr bestraft den Diebstahl eines Huhnes und gestattet den eines Menschen“102. Nach einiger Zeit kann er die ersten Erfolge verzeichnen, als die Kommandanten der Oasen erste Maßnahmen gegen die Sklaverei ergreifen. Doch er hat nicht nur die einheimische Bevölkerung im Blick: Auch die stationierten französischen Soldaten in Beni-Abbès können sich seiner Hilfe sicher sein und trotz seines Einsiedlerdaseins zeigt er sich häufig gesellig und gesprächsbereit. Der Andere, sein Mitmensch, begegnet Foucauld mehr und mehr als derjenige, in dem ihm Jesus konkret begegnet.
Zunehmend reift in ihm der Wunsch, in der afrikanischen Wüste auch missionarisch tätig zu sein, wobei er besonders den marokkanischen Teil der Sahara ins Auge fasst. Entgegen der allgemeinen Auffassung ist er der festen Überzeugung, der Islam sei durchaus geeignet, die Frohe Botschaft Jesu zu vernehmen103.
Charles de Foucauld muss jedoch den Plan, Marokko zu missionieren, wenig später wieder fallen lassen; denn immer noch hatten sich keine Brüder eingefunden, die bereit waren, das strenge Leben von Bruder Karl zu teilen. Zudem wurde das Gebiet um Beni-Abbès vermehrt von schweren Unruhen heimgesucht, die viele Soldaten das Leben kosteten. Sein Freund, Oberst Laperrine, will in den Süden der Sahara vorstoßen und macht ihm den Hoggar, das Land der Tuareg, schmackhaft. Foucauld ist fasziniert von dieser Idee und begibt sich mit auf die beschwerliche Reise. Zwar kehrt er noch einige Male nach Beni-Abbès zurück, doch beginnt er, von 1901 an, verstärkt dort zu wirken.
Bei den Tuareg findet das Nazareth-Ideal eine weitere Verwirklichungsstufe: Zwar bleibt der kontemplative Grundzug erhalten – viele Stunden verbringt Charles de Foucauld weiterhin vor dem Allerheiligsten – doch wird er mehr und mehr das, was heute eher Entwicklungshelfer genannt werden könnte104. Seine Achtung und Offenheit gegenüber dem so fremden Volk ist enorm und seine Hinwendung zum Nächsten findet in seinem Verhältnis zu ihm ihren einzigartigen Ausdruck. So ist er zum Beispiel als politischer und ökonomischer Berater des „Königs“ der Tuareg und der französischen Kolonialoffiziere tätig. Er begeistert sich für alle Techniken, wie z.B. Eisenbahn oder Telegraphie, die der Entwicklung der Sahara förderlich sein könnten. Er gibt Ratschläge in Dingen der Landwirtschaft, Medizin und Textilverarbeitung. Er durchleidet mit ihnen eine große Hungersnot, und er kämpft weiterhin auch hier mit vollstem Herzen gegen die Sklaverei; vor allem aber lernt er die Sprache und die literarische Tradition der Tuareg kennen und arbeitet bis zum Letzten an einem großen Wörterbuch Französisch-Tuareg (Tamaschek), das erst nach seinem Tode veröffentlicht wird und bis heute das einzige in seiner Qualität ist105. Er übersetzt die Evangelien in das Tamaschek und lebt, obwohl allein, konsequent die Nachfolge Jesu Christi. Trotz der völlig anderen Kultur um ihn herum bleibt er dem Christentum verbunden und dem Allerheiligsten ganz nah.
Zweimal reist er in dieser Zeit nach Frankreich, um für seine Gemeinschaft zu werben, doch er ist nicht erfolgreich und bleibt bis zu seinem Tod 1916 allein.
1.2.3.1 Mission: Sich aussetzen mit dem in der Hostie ausgesetzten Christus
Der Aspekt der Mission, die Charles de Foucauld zu späterer Zeit im Hoggar noch ebenso intensiv verfolgt wie in Beni-Abbès, hebt einen wichtigen Akzent innerhalb seiner Theologie der eucharistischen Anbetung hervor. Seine Methode, die Botschaft Jesu zu den Menschen zu bringen, ist, trotz seines Wissens um das gute Mittel eines Gespräches über Gott106, weniger eine der großen Worte oder der Predigten, sondern vielmehr ein gelebtes Beispiel der Liebe Gottes. In seinen vielen Briefen erwähnt er immer wieder, wieviele Besucher sich ohne Unterlass in seiner Hütte einfinden. Foucauld schickt keinen einzigen von ihnen weg, sondern ist allein darauf bedacht, den Menschen durch seine eigene Gegenwart die Liebe Jesu nahe zu bringen. Bis zum Schluss ist es sein größter Wunsch, Menschen aus der Sahara zum christlichen Glauben zu bekehren107. Wenngleich er bis auf eine alte blinde Frau, ein kleines Kind und seinen Gehilfen Paul Embarek niemanden taufen kann, so verliert er doch niemals den innigen Willen dazu. Charles de Foucaulds Art, in den Menschen etwas zu rühren, ist keine fordernde, donnernde oder zwingende. Es ist ein geduldiges Warten, währenddessen er nichts anderes tut als an seiner ganzen Existenz das Leben und die Liebe Jesu Christi zu demonstrieren, in der Hoffnung, den Menschen dadurch etwas von der Botschaft des Evangeliums mitzuteilen: „Es handelt sich um die Verkündigung des Evangeliums, nicht durch Worte, sondern durch die Gegenwart des heiligsten Sakramentes, durch Darbringung des göttlichen Opfers, Gebet, Buße, Ausübung der evangelischen Tugenden, Liebe“108.
Foucauld betreibt Theologie innerhalb eines Apostolates durch gütige Gegenwart: Indem er durch sein eigenes Sein, sein eigenes Leben das Wesen Gottes zum Ausdruck, zur Sprache bringen will, sagt er den Menschen etwas über diesen Gott. Dies zeigt sich besonders in der Ansicht Foucaulds, die schon für seine eigene Bekehrung ausschlaggebend war: „Wenn man mich sieht, muß man sagen: ‚Weil dieser Mann gut ist, muß auch seine Religion gut sein‘“109. Mittels einer Art des Für-die-Menschen-da-seins will Foucauld Mission betreiben, und er legt ausschließlich sie als die Art und Weise fest, mit der auch seine erhoffte Gemeinschaft „der kleinen Brüder“ unter der islamischen Bevölkerung Nordafrikas leben soll, deren Einsiedeleien er aus diesem Grund verstreut gelegen plant.
Alles, was Foucauld sein will, ist sichtbares Zeichen und Werkzeug des Heils im Sinne der Kirche. Darum geht er als Priester dorthin, wo diese kaum mehr hinreicht, um Gottes Gegenwart weiterzutragen, um den Raum der Wirksamkeit Christi bis in den letzten Winkel der Wüste zu vergrößern. Der Grund ist wiederum in der Erfahrung Foucaulds des unüberbietbar nah und wirklich vorhandenen Jesus in der heiligen Hostie zu suchen. Er versteht seinen Auftrag, Gott zu den Menschen zu bringen, sehr konkret und räumlich: Der Gedanke der riesigen Wüste ohne eucharistische Gegenwart ist ihm unerträglich110: „[…]baut eure Stätten der Einkehr mitten unter denen, die Mich nicht kennen; tragt Mich in ihre Mitte, indem ihr dort einen Altar, einen Tabernakel errichtet, und bringt das Evangelium hin, nicht mit dem Munde, sondern mit dem Beispiel, nicht indem ihr es verkündigt, sondern indem ihr es lebt“111. Daher trägt er das Allerheiligste mit der Überzeugung in die Wüste hinein, dass die eucharistische Präsenz Christi dieses Land und seine Bewohner heiligt112. Charles de Foucauld missioniert die Wüste, indem er einfach dort ist und dafür Sorge trägt, dass die Heilige Messe gefeiert wird und Christi Gegenwart durch das Allerheiligste gesichert ist113. Dies wird unter anderem darin offensichtlich, wie sehr Charles de Foucauld darunter leidet, über eine lange Zeit hinweg keine Heilige Messe feiern zu können, da kein Ministrant vorhanden ist. Als Bischof Guérin ihm die Erlaubnis erteilt, alleine die Heilige Messe feiern zu dürfen, ist er überglücklich.
Die Wüste wird für Foucauld der vorrangige Ort des vertrauten Umgangs mit Gott114. In ihrer geologischen Kargheit lenkt sie den Blick des Herzens auf den eucharistischen Christus und die in ihr lebenden Menschen. Sie erhält als Ort eine Symbolgestalt115. Masse und Anonymität existieren hier nicht und dem einzelnen Antlitz kann nicht aus dem Weg gegangen werden. Dadurch wird sowohl die Not als auch die Freundschaft des Mitmenschen zu einer Begegnung mit Christus.
Das Tun des Bruders Karl, die Offenheit für die Einheimischen und die Soldaten, ergibt sich notwendigerweise aus der Gegenwart des Allerheiligsten: Die Liebe Jesu gilt allen Menschen, und Foucauld macht sich zu ihrem Verkünder. Durch einfaches, stilles Apostolat will er die Frohe Botschaft verkünden und zwar denen, die am verlassensten sind und die am weitesten von Jesus entfernt sind. Deren räumliche Entfernung von Christus bricht er ganz konkret durch das Hineintragen der Gegenwart Jesu im eucharistischen Brot in das Gebiet der Wüste. Ihre innerliche Entfernung versucht er sekundär – auch durch sein eigenes Beispiel – zu brechen, indem er sich den Menschen aussetzt wie Christus in der Monstranz sich der Welt aussetzt. Dementsprechend versteht Foucauld seine eigene sowie die göttliche Sendung der Kirche; und in seinem priesterlichen Dasein will er für die Menschen der Sahara ganz zur Kirche werden, indem er sich in der radikalen Nachahmung Jesu zu dessen Werkzeug des Heils macht116. Ebendiesen Gedanken legt er auch der Existenz seiner Gemeinschaft der Kleinen Brüder (und auch Schwestern) vom heiligsten Herzen Jesu zugrunde. Sie sollen dorthin gehen, wo niemand etwas von Jesus weiß, das Allerheiligste dorthin tragen und dessen Heiligkeit durch unablässige Anbetung sichtbar machen117. In diesem Sinne will er Kirche da sein lassen, will er missionieren, nicht anhand zu zählender Taufen, sondern als Gegenwärtig-machen der Liebe Christi.
1.2.3.2 Nächstenliebe: Inklusion in die Selbstverschenkung des eucharistischen Christus
Schon unmittelbar nach seiner Bekehrung hatte Charles de Foucauld das biblische Wort von der Selbstidentifikation Jesu mit dem Geringsten seiner Brüder zum Mittelpunkt seiner ganzen Existenz und schließlich auch seiner Ordensgründung gemacht. So bestand Foucaulds innigstes Bestreben ausschließlich darin, sich in allem dem in Jesus von Nazareth inkarnierten Gottessohn gleich zu machen und selbst zum Geringsten zu werden. Dieser Entschluss beruhte vor allem in der eucharistischen Frömmigkeit Foucaulds und in der Erfahrung, dass ihm in der Heiligen Eucharistie der erniedrigte und sich klein-machende Jesus begegnet. Unscheinbar wie ein alltägliches Stück Brot geht die Liebe Gottes verborgene Wege: „Wenn man jemand liebt, ist man tatsächlich sehr wirklich in ihm, man ist in ihm durch die Liebe, man lebt in ihm durch die Liebe, man lebt nicht mehr in sich, denn man hängt nicht mehr am eigenen «Ich», man ist von sich losgelöst, außer sich; man lebt nicht mehr in sich selbst, man ist in dem, den man liebt, man lebt von seinem Leben, lebt in ihm“118.
In der nordafrikanischen Wüste wird Charles mehr und mehr die Unerlässlichkeit bewusst, sich für die Anderen zum Geschenk dieser Liebe zu machen. Das eigene Ich soll so sehr in den Hintergrund treten, die Gleichheit mit Jesus Christus soll so vollkommen sein, dass in der Person des Charles de Foucauld nur mehr die Liebe Jesu sichtbar wird. Das Fundament dieser Spiritualität ist Foucaulds Glaube an die reale Gegenwart Jesu in der Eucharistie. In der Anbetung, dem ganz Bei-Gott-sein, tritt alles andere derart zurück, dass die einzig angemessene Art, sich zu dieser Nähe in Beziehung zu setzen, diejenige ist, sich selbst liebend zu schenken. Anbetung wird somit neben dem Erkennen des liebenden Wesens Gottes zu einem Akt der tätigen Liebe. Charles de Foucauld spricht von seiner Verähnlichung mit dem Geliebten119. Wenn man Jesus unendlich liebt, kann man gar nichts anderes wollen, außer es dem Geliebten gleich zu tun, sich selbst und sein eigenes egoistisches Wollen zu vergessen und zu verleugnen, um in sich nichts als die Fülle und Liebe des Geliebten zu tragen. Es gilt, Christus mit seiner ganzen Existenz in allen Momenten des Lebens nachzufolgen: „Das vollkommene Leben besteht darin, Christus innerlich und äußerlich nachzufolgen; innerlich, indem wir unsre Seele der Seinen ähnlich werden lassen, äußerlich, indem wir eine der drei Arten von Leben führen, die er uns als Beispiel gegeben hat“120. Die Gleichförmigkeit umfasst also jedes Denken und Tun. Indem Foucauld sich selbst ganz und gar aufgibt und in den Gott eingestaltet, der sich ihm in der Eucharistie aussetzt, kann er die liebevolle Beziehung Gottes zu seiner Schöpfung verleiblichen, kann er – wie die Kirche – Werkzeug Gottes werden.
Charles de Foucaulds Nachfolge Jesu in Armut und Gehorsam macht in allen Momenten seines Lebens konkret und sichtbar, was in der Anbetung für ihn Wirklichkeit ist: das Hineinversenken in die Liebe Gottes. Auf diese Weise eignet er sich das „klein, immer kleiner“ an; indem er im eucharistischen Brot das kleine, verborgene Dasein Jesu schaut.
In der Wüste wird das kontemplative Leben Charles de Foucaulds immer öfter unterbrochen von tätiger Nächstenliebe. Die Verborgenheit des Nazareth-Ideals tritt zunehmend in den Hintergrund, denn als christlicher Marabut121 gehört ihm die Aufmerksamkeit der Wüstenbewohner. Zwar verbringt Charles de Foucauld, wann immer möglich, viele Stunden vor dem Allerheiligsten, aber meistens wird er von den Menschen um ihn herum gefordert und beansprucht. Keinen von ihnen will er abweisen. Wie vorhergehend schon erwähnt, erkennt Foucauld angesichts der eucharistischen Wirklichkeit Jesu Christi die Notwendigkeit, die zuteil gewordene Liebe nicht für sich selbst zu behalten, sondern an die Menschen weiterzugeben. Bestimmte, einschneidende Erlebnisse erscheinen Foucauld wie Sinnoffenbarungen122, und viele seiner Aufzeichnungen geben Zeugnis von seinen Erfahrungen, in denen ihm der konkrete Mitmensch als der Anspruch des in der Monstranz ausgesetzten Christus begegnet.
Vor dem Allerheiligsten kniend offenbart sich ihm der Jesus, der sein Leben am Kreuz hingegeben hat für die Vielen, für das Heil eines jeden Menschen. Weil er sich in die Lebenshingabe Jesu für die Vielen versenkt, drängt es Foucauld in die Nachfolge radikaler Proexistenz123. Er will sich mit Jesus zur Hostie gestalten lassen für die Menschen, die sich bei ihm einfinden124. Der Nächste begegnet Foucauld somit als der ganz Andere, als ein von Gott Gerufener und Gewollter und dadurch als unhintergehbarer Anspruch. Wenn Gott das Heil eines jeden Menschen will und er sich in der heiligen Eucharistie einem jeden Menschen schenkt, wie sehr steht man dann in der Pflicht, dem Nächsten zu eben diesem Heil zu verhelfen?125 Wie wichtig ist es dann, den Menschen die Eucharistie zu bringen und ihnen durch das eigene Leben und das gütige Handeln an ihnen die Liebe Gottes zu erkennen zu geben? Foucauld erkennt im Nächsten eine Gegenwärtigkeit Christi wie in der Hostie selbst. Von nun an verbringt er die Stunden vor dem eucharistischen Brot vor allem, um nicht mehr nur sich, sondern stellvertretend auch die Menschen seiner Umgebung vor Gott hinzutragen. Der Akt der Liebe innerhalb der Anbetung verbleibt nicht mehr nur zwischen dem Du Gottes und dem Ich des Anbetenden: das Geschehen der Liebe dringt nach außen, lässt die Menschen daran teilhaben, indem Foucauld sich ihnen bis zum Letzten zuwendet und sie hineinnimmt in eine Beziehung zum eucharistischen Christus: „So weit sollen wir alle Menschen lieben, daß wir durch die Liebe in ihnen leben und nicht in uns, daß wir eins sind mit ihnen durch die Liebe, nicht um ihretwillen, sondern um Gottes willen, «daß sie eins seien in Uns», daß unsere Liebe zu Gott uns so sehr mit allen Menschen verbinde“126.
Charles de Foucauld bemüht sich besonders um jene, die er am weitesten von Christus entfernt glaubt; doch schließt er letztendlich niemanden von seiner Hilfe aus. Durch das Leermachen seiner selbst durch die Zurücknahme des eigenen Ego, das Streben nach Gleichförmigkeit mit Jesus und durch die Hingabe an den Nächsten wird Foucauld mit Leib und Seele ein Zeichen der Liebe Christi und dessen Werkzeug zur Rettung der Menschen127. Allein durch seine Gegenwart, durch sein Sich-Aussetzen in der Weise des eucharistischen Christus will er den Tuareg ein Zeugnis der christlichen Offenbarung sein: „Das Beispiel ist das einzige äußere Werk, durch welches man Seelen beeinflussen kann, die sich Christus gegenüber vollkommen ablehnend verhalten“128.
Indem Foucauld für sich „den letzten Platz“ wählt, kann er den Tuareg anders als die französischen Kolonialherren auf Augenhöhe begegnen, kann er ein wirkliches Miteinander mit den Tuareg leben und sich einen Zugang zu ihrer Kultur verschaffen129. Nur an diesem letzten Platz wird für Charles de Foucauld wirkliche und vor allem wirksame Nächstenliebe möglich, die europäischem Überlegenheitsdenken keinen Raum mehr lässt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch seine Haltung zum Mitleiden mit den Menschen: Das Mitleid mit dem Nächsten ist ebenfalls imstande, die Liebe zu Gott auszudrücken, an sich wirklich zu machen und auf diese Weise die Liebe Gottes für die Menschen an sich sichtbar, spürbar und erfahrbar zu machen. Mitleid ist für Foucauld nicht das distanzierte Mitleiden, sondern das aktive Mittragen, das gemeinsame Aushalten und Hoffen auf den Herrn.
Mit dieser inneren Haltung, die auf Foucaulds eucharistischer Frömmigkeit beruht, kann er den Tuareg trotz aller scheinbaren Verschiedenheit wirklich zum Nächsten werden. Die Erfahrung des Reichtums des Tabernakels begründet seine Hinwendung zu den Armen der Welt und die Bekämpfung ihrer materiellen Armut: Indem Foucauld sich selbst zu den Armen trägt, trägt er den Reichtum des Tabernakels zu ihnen. Indem er sich selbst ganz klein macht, um Jesus Raum zu geben, kann er Jesus veranschaulichen.
48 Besonders die Verfolgung und Ermordung armenischer Christen, die Foucauld in Akbès hautnah miterlebt, bewegen ihn erstmals zu dem Gedanken, dass das kontemplative Leben sein Glaubwürdigkeitskriterium im konkreten Einsatz für Unterdrückte und Leidende findet.
49 In einem späteren an Guérin, den Apostolischen Präfekten der Sahara, gerichteten Brief schreibt er: „Von halb vier bis halb sechs Anbetung: das ist, nach der Messe und der Nacht, der beste Teil des Tages: die Arbeit ist getan, und ich darf nur noch Jesus anschauen…Es ist eine Stunde voll Süße“. FOUCAULD, Schriften, 383.
50 FOUCAULD, Schriften, 136.
51 Vgl. FOUCAULD, Schriften, 130.
52 Foucauld schreibt in seinen Betrachtungen über das Evangelium (Lk 4,42): „Das immerwährende Gebet genügt nicht: wie der Herr uns hier lehrt, muß es in jedem Leben, selbst in einem Leben, das in sehr heiliger Weise dem Dienst am Nächsten gewidmet ist, bestimmte Zeiten der Sammlung, des Stillschweigens, der einsamen Betrachtung zu Gottes Füßen geben…Dies ist eine Pflicht der Ehrfurcht dem Schöpfer gegenüber, der Liebe gegenüber unserm Geliebten,[…].“ FOUCAULD, Schriften, 135.
53 FOUCAULD, Platz, 21.
54 FOUCAULD, Schriften, 116. Zuvor schreibt er an dieser Stelle: „Welcher Art diese verschiedensten Gebete sein mögen, ob stumm oder gesungen, ob ohne tiefes Denken oder stark reflektiv, was ihnen ihren eigentlichen Wert gibt, ist die Liebe, mit der sie verrichtet werden.“
55 Vgl. FOUCAULD, Schriften, 132.
56 Vgl. FOUCAULD, Aufzeichnungen, 22.
57 Vgl. SIX, Foucauld, 19.
58 Später versteht Charles de Foucauld diese Langeweile, die er damals empfand, als Gnade, die ihn auf die Begegnung mit Gott vorbereiten sollte. Vgl. SIX, Foucauld, 24.
59 Laut Six war dieser Entschluss weniger aus Liebe zu Mimi entsprungen, sondern hatte seinen Grund in seinem Stolz und seiner ausgeprägten Freiheitsliebe, die Charles nicht angetastet wissen wollte. Vgl. SIX, Foucauld, 25.
60 Bis zu diesem Zeitpunkt scheinen Foucaulds Aktionen alle noch stets von dem Wunsch angetrieben zu sein, ruhmreich zu werden, v.a. in den Augen seiner Familie will er sich groß machen und damit rehabilitieren. Vgl. SIX, Foucauld, 28f.
61 In einem Brief an Henry de Castries von 1901 schreibt er von seiner damals empfundenen Faszination vom Islam, den er aber dennoch nicht als die Wahrheit erkannte. Vgl. FOUCAULD, Schriften, 362.
62 In seinen Betrachtungen von 1897 erfahren wir, dass Charles sich damals sagte, eine Religion, an die eine solch intelligente Frau glaubt, könne vielleicht doch kein Unsinn sein. Vgl. SIX, Foucauld, 46f.
63 Foucauld genießt „die Einsamkeit in der Gesellschaft“ geliebter Menschen. Ein Ausdruck, der nach Six ein Schlüssel zu Charles de Foucaulds Wesen ist: Einsamkeit ja, aber nur im Umgeben-sein von Liebe. Vgl. SIX, Foucauld, 31.
64 FOUCAULD, Schriften, 363. Bekenntnis aus seinem Brief an Henry de Castries von 1901.
65 FOUCAULD, Schriften, 363.
66 Das, was Foucauld noch vom Glauben abhielt, war sein im Agnostizismus verhaftetes Denken – so Six. Demnach konnte ihm nur konkretes Tun den Glauben wiedergeben. Vgl. SIX, Foucauld, 52.
67 Vgl. SIX, Foucauld, 66.
68 Siehe dazu SIX, Foucauld, 79-85.
69 Die Trappisten sind zu dieser Zeit einer der strengsten und ärmlichsten Orden.
70 Vgl. SIX, Foucauld, 207f.
71 Vgl. FOUCAULD, Schriften, 346.
72 Vgl. SIX, Foucauld, 84.
73 Die hier grundgelegten Auszüge der Predigt Huvelins sind entnommen aus: SIX, Foucauld, 60.
74 Vgl. SIX, Foucauld, 84.
75 Vgl. SIX, Foucauld, 86.
76 In einer Betrachtung über Mt 18,4 schreibt Foucauld über den an den Menschen gerichteten Anspruch: „Jesus macht die himmlische Seligkeit hier abhängig von der Demut, vom tatsächlichen Sich-klein-machen, davon, daß man den letzten Platz einnimmt und gehorcht“. FOUCAULD, Schriften, 148.
77 FOUCAULD, Schriften, 205.
78 Hierin sieht er auch einen Grund für die Wahrheit des Christentums.
79 „Da Du immer bei uns bist in der heiligen Eucharistie, wollen wir immer bei ihr sein, ihr Gesellschaft leisten vor dem Tabernakel, keine dieser Minuten durch unsere Schuld verlieren: Gott ist da, was sollten wir anderswo suchen? Der Geliebte, unser Alles, ist da; Er lädt uns ein, Ihm Gesellschaft zu leisten, und wir sollten nicht dorthin eilen, wir sollten auch nur einen dieser Augenblicke, die wir zu seinen Füßen weilen dürfen, anderswo verbringen?“ FOUCAULD, Schriften, 463.
80 Auch hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Verborgenheit nicht die Verhüllung Gottes meint, sondern die unüberbietbare Selbstoffenbarung Gottes. Was im Verborgenen geschieht, beinhaltet trotzdem die ganze Fülle des trinitarischen Gottes.
81 FOCAULD, Schriften, 396. Siehe dazu auch SIX, Foucauld, 85f.
82 Vgl. Zitat Foucaulds in SIX, Foucauld, 102: „Wenn man mir über das Studium spricht, so werde ich darlegen, daß ich ein sehr starkes Verlangen verspüre, bis zum Hals im Getreide und Holz zu bleiben, und daß ich einen ausgesprochenen Widerwillen habe gegen alles, was mich von jenem letzten Platz vertreiben könnte, den ich in der Erniedrigung gesucht habe, in die ich mich in der Nachfolge unseres Herrn immer tiefer versenken will.“
83 Jean-Francois Six hat sehr schön herausgearbeitet, dass es all die Zeit über nur die Gehorsamspflicht Foucaulds gegenüber Huvelin und seinem Ordensoberen war, die ihn davon abhielt, seinem drängenden Wunsch, das „Nazaret-Ideal“ ohne die Bindung an den Orden der Trappisten zu leben, nachzukommen. Vgl. SIX, Foucauld, 121-130.
84 FOUCAULD, Schriften, 176.
85 Für Näheres zu seiner Regel, ihrer Entstehung und ihren verschiedenen Entwürfen siehe SIX, Foucauld, 194-202.
86 Die Freigebigkeit, mit der Foucauld zeitweise sein Geld verschleuderte, weist möglicherweise darauf hin, dass er schon immer wenig Anhänglichkeit an dieses Gut zeigte.
87 FOUCAULD, Schriften, 139.
88 „Je größere Leere wir in uns schaffen, um so mehr erfüllt uns Gott mit Gnade… je ärmer wir an Geschaffenem sind, um so reicher werden wir an Göttlichem[…]und nach dem Maß unseres Leerseins von allem, was nicht Er ist, gibt Er sich uns völlig, erfüllt Er uns ganz, eint sich vollständig mit uns, läßt sich in unserer Seele nieder und nimmt Wohnung darin“. FOUCAULD, Schriften, 147.
89 FOUCAULD, Platz, 85. Aus einem Brief an Marie de Bondy.
90 FOUCAULD, Schriften, 142.
91 FOUCAULD, Schriften, 143f.
92 Zwar schreibt er an anderer Stelle: „Mein Gott, ich weiß nicht, wie manche Menschen es ertragen können, Dich arm zu sehen und gerne reich zu bleiben, sich so viel größer zu sehen als ihren Meister, ihren Geliebten, die Dir nicht in allem ähnlich sein wollen,[…].“ FOUCAULD, Schriften, 301. Doch kann diese Aussage m.E. nur als aufrichtiges Unverständnis Foucaulds gedeutet werden, ohne eine Universalisierungstendenz nahezulegen.
93 Siehe dazu auch seinen Kommentar zur Bitte des Vater Unser „Gib uns heute unser tägliches Brot“ in FOUCAULD, Schriften, 311f.
94 FOUCAULD, Schriften, 184.
95 FOUCAULD, Schriften, 206.
96 Vgl. BENESCH, Spur, 201.
97 FOUCAULD, Schriften, 201. An einer anderen Stelle schreibt er dazu: „Laßt uns das Leiden umarmen, es mit Lobgesang aufnehmen aus Liebe zu Jesus, nach seinem Beispiel; laßt uns alles Leid, das uns treffen wird, Ihm darbringen. Doch damit wollen wir uns noch nicht zufriedengeben: suchen wir das Leid, um dem Geliebten ähnlich zu sein, Ihm nachzufolgen, sein Schicksal zu teilen; töten wir uns freiwillig und so weitgehend wie möglich ab“. FOUCAULD, Schriften, 212.
98 FOUCAULD, Platz, 17.
99 Folgender Ausspruch Foucaulds macht deutlich, welche Haltung ihn zur geduldigen Annahme allen Leidens befähigt: „Welches ist denn dieser Friede, den die Welt nicht gibt? Es ist der Friede, den Deine Liebe verleiht; der Friede der Welt ist der Friede abseits von Leiden, Feindschaften, Verfolgungen und Drangsalen; Dein Friede bedeutet Gleichmut in Leiden, in Feindschaft, in Verfolgung, in Drangsal, in allen schmerzlichen Erfahrungen des Übels, es ist der tiefe und überfließende Friede der Seele, die Dich liebt inmitten all dieser Übel“. FOUCAULD, Platz, 78.
100 In seinen Betrachtungen über die Passion findet sich folgender Satz: „Du hast gelitten, um uns zu heiligen, um uns dahin zu bringen, Dich freiwillig zu lieben: denn Liebe ist das mächtigste Mittel, um geliebt zu werden… und für den leiden, den man liebt, ist unwiderleglichster Beweis der Liebe… je größer die Leiden, um so überzeugender ist der Beweis, um so tiefer die bewiesene Liebe“. FOUCAULD, Schriften, 204.
101 Foucauld drückt dies folgendermaßen aus: „Was wir auch tun mögen, unser Liebesbeweis wird immer hinter dem Beweis, den Jesus uns gegeben hat, zurückstehen, weil unsere Leiden niemals den seinen gleich sein können, weil wir nur etwas zurückgeben und nicht als erste geben, weil es der geschuldete Beweis eines armen, bedürftigen Geschöpfes ist und nicht der grundlose, ungeschuldete Beweis des im höchsten Grade liebenswerten und vollkommenen Schöpfers“. FOUCAULD, Schriften, 205.
102 FOUCAULD, Schriften, 318.
103 Vgl. SIX, Leben, 93.
104 Vgl. GRESHAKE, Spiritualität, 140f.
105 Wie wichtig ihre Sprache für die Tuareg ist, erwähnt Foucauld in einem Brief an Livinhac: „die Tuareg haben viel Nationalstolz, legen großen Wert auf ihre Sprache und machen sich eine Ehre daraus, nur diese zu sprechen. Sie hassen die Araber und die arabische Sprache, haben aber Sympathie für jeden, der ihre Sprache spricht… Ihre Sprache nicht zu sprechen, hieße vom ersten Augenblick an ihre Antipathie erwecken; sie zu sprechen ist beinahe der Schlüssel zu ihren Herzen“. FOUCAULD, Schriften, 345f.
106 Siehe dazu auch: SIX, Leben, 93-96.
107 Wie überzeugt er von dieser allgemeinen Pflicht der Christen ist, wird sehr anschaulich in einem Brief an Louis Massignon, den er während seiner Zeit im Hoggar verfasst. Siehe: SIX, Abenteurer, 141-144.
108 FOUCAULD, Platz, 36.
109 Zitat entnommen aus SIX, Foucauld, 299.
110 In einem Brief an Castries: „Wir sind hier einige Mönche, die ihr «Vater Unser» nicht sagen können, ohne mit Schmerz an das weite Marokko zu denken, wo so viele Seelen leben, ohne «Gott zu heiligen, zu seinem Reich zu gehören, seinen Willen zu erfüllen und das göttliche Brot der heiligen Eucharistie zu kennen»“. FOUCAULD, Platz, 35.
111 FOUCAULD, Platz, 38. Diese Worte legt Foucauld Jesus in den Mund.
112 Vgl. GRESHAKE, Spiritualität, 140. Foucauld selbst vergleicht dieses verborgene Hintragen Jesu mit dem Besuch der schwangeren Maria im Hause der Elisabeth.
113 In einem Brief an Huvelin: „Ich kann jeden Tag das heilige Meßopfer feiern: die heilige Hostie ergreift Besitz von ihrem Eigentum… Ich übersetze die vier Evangelien in die Tuaregsprache… Aus allen Kräften suche ich den armen, verirrten Brüdern zu beweisen, daß unsere Religion ganz Liebe, ganz Brüderlichkeit, daß ihr Wahrzeichen ein Herz ist“. FOUCAULD, Schriften, 373.
114 Vgl. GRESHAKE, Spiritualität, 148.
115 Vgl. GRESHAKE, Spiritualität, 154.
116 Zum Fest der Heimsuchung Marias bei Elisabeth schreibt er die Bitte: „O meine Mutter, gib, daß wir unserer Sendung treu sind, dieser so schönen Sendung, mitten unter die armen, im Todesschatten liegenden Seelen den göttlichen Erlöser in Treue zu tragen, mitten unter sie die heilige Eucharistie zu bringen, den Gottesdienst zu feiern und ihnen das Leben Jesu durch unser Leben zu zeigen; denn unser Leben soll ein vollkommenes Abbild des seinen sein. Gib, daß wir dieser göttlichen Sendung treu sind!“ FOUCAULD, Schriften, 240.
117 Als Aufgabe seiner zwei kleinen Familien, der Kleinen Brüder und Schwestern vom heiligsten Herzen Jesu, bestimmt er: „kleine klösterliche Bruderschaften von etwa zwanzig Brüdern oder Schwestern, in denen man[…]das verborgene Leben Jesu in Nazareth möglichst getreu nachahmt in Liebe, Anbetung, Hinopferung[…]wo das bei Tag und Nacht ausgesetzte Allerheiligste beständig angebetet wird; wo man in entlegenen Gegenden der ungläubigen Länder lebt, um Jesus dahin zu tragen, wo Er am wenigsten ist, um mit Ihm seine verlorensten und verlassensten Schafe zu suchen“. FOUCAULD, Schriften, 278.
118 FOUCAULD, Schriften, 162.
119 „Die ersten wie die letzten Akte und Wirkungen der Liebe[…]sind Nachahmung und Beschauung. Vom ersten Augenblick der Liebe an ahmt man nach, beschaut man: Nachahmung und Beschauung sind naturnotwendig Bestandteile der Liebe. Denn die Liebe strebt zur Einheit, zur Verwandlung des Liebenden in den Geliebten, zur Vereinigung des Liebenden mit dem Geliebten. Nachahmung ist Einung, Einswerden eines Wesens mit einem anderen durch Ähnlichkeit. Beschauung ist Einung und Einswerden durch Erkennen und Anblick“. FOUCAULD, Schriften, 164.
120 FOUCAULD, Platz, 48.
121 Im Islam die Bezeichnung für einen Heiligen. Die Einheimischen gaben Charles de Foucauld diesen Titel.
122 So zum Beispiel schon während seiner Zeit bei den Trappisten, als er bei einem sterbenden Armenier Wache halten muss. Siehe dazu HOFFMANN-HERREROS, Foucauld, 52. Anschaulich erzählt wird dieses Ereignis auch bei BENESCH, Spur, 162-167.
123 Vgl. GRESHAKE, Spiritualität, 138.
124 „In diesem Licht erkennt man sonnenklar, daß die geringste Mehrung der Liebe unter den Gotteskindern tausendmal mehr wert ist, tausend- und abertausendmal wichtiger ist als alle materiellen Güter der Welt.“ FOUCAULD, Schriften, 156.
125 „Vergessen wir uns zunächst für unsern Herrn und dann, Seinem Beispiel folgend, für Seine Kinder, für die Kinder, die «Er bis ans Ende geliebt hat» und die wir ebenfalls «bis ans Ende lieben» müssen, um Jesu willen“. FOUCAULD, Platz, 81.
126 FOUCAULD, Schriften, 162.
127 Beachtenswert ist dazu auch ein Brief an Louis Massignon in SIX, Abenteurer, 47. Dort heißt es unter anderem: „Die Aufgabe unseres Lebens besteht darin, Seelen zu retten, für ihr Heil zu arbeiten, ‚ihnen zu dienen und unser Leben hinzugeben‘, um sie zu retten nach dem Vorbild des göttlichen Bräutigams.“
128 FOUCAULD, Platz, 40.
129 Wie sehr Foucauld gerade auch auf seine ärmliche Erscheinung und eben nicht auf eine Form von Autorität setzt, belegt folgender Ausspruch von ihm: „Ich lache immer, zeige meine häßlichen Zähne. Dies Lachen versetzt den Nachbarn in gute Laune… es bringt die Menschen einander näher, hilft ihnen sich besser zu verstehen, heitert manchmal ein düsteres Gemüt auf; es ist eine Tat der Nächstenliebe.“ FOUCAULD, Platz, 41.