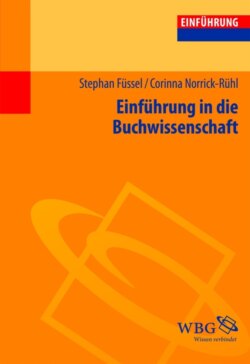Читать книгу Einführung in die Buchwissenschaft - Stephan Fussel - Страница 7
I. Hinführung:
Buchwissenschaft zwischen Historischer
Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft
ОглавлениеDie aktuelle Situation des Buchhandels
„Die Buchbranche erlebt in Deutschland derzeit einen herausfordernden Wandel mit weitreichender Perspektive“ konstatierte Mitte 2013 der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Alexander Skipis bei der Vorstellung der aktuellen Wirtschaftszahlen und der jüngsten Studie zum E-Book-Markt (Börsenverein des deutschen Buchhandels 2013a). Die digitalen Veränderungen beschäftigen die Branche weltweit bereits seit 15 Jahren. Nun aber hat sich der E-Book-Umsatz in Deutschland im Jahr 2012 verdreifacht und wird bis 2015 etwa bei 15 % Marktanteil, in einzelnen Bereichen, wie dem wissenschaftlichen Buchmarkt, auch deutlich höher liegen. Während zahlreiche Verlage versuchen, sich auf neue Geschäftsmodelle einzurichten, scheint das stationäre Sortiment der große Verlierer dieses Umbruchs zu werden. Das Sortiment muss nun versuchen, zum Beispiel über Onlineportale und praktikable Geschäftsmodelle selbst am E-Book-Umsatz (sowohl an den Readern als auch an den elektronischen Texten) zu partizipieren. So könnte der Buchhandel von seiner hohen Beratungskompetenz und mit seinem Engagement für das Lesen und für die Bücher, egal ob in gedruckter oder elektronischer Form, weiterhin am Markt profitieren.
Der Umbruch der Gegenwart macht auch deutlich, dass nationale Märkte und einzelne Marktsegmente nicht mehr allein betrachtet werden können. Der Markt in den deutschsprachigen Ländern ist direkt abhängig von den weltweiten Umsatzentwicklungen und neuen Anbietern von Information sowie von den kulturellen Veränderungen im gesellschaftlichen Umgang mit dem Medium Buch. Ebenso müssen die Vertriebsmodelle von Buch, Zeitung und Zeitschrift nun stärker als bisher gemeinsam in den Blick genommen und optimiert werden. Nur dann kann es gelingen, nach zwei Jahrzehnten einer „kostenfrei-Mentalität“ im Netz an den entscheidenden Stellen Bezahlschranken einzurichten, die es für Verlage und Redaktionen ermöglichen, personalintensive Recherchen und die Qualität der Inhalte mit ökonomisch akzeptablen Ergebnissen zu sichern. Andere aktuelle Fragen befassen sich mit der neuen Partnerschaft von Bibliotheken und Verlagen bei dem Open Access-Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen. Gelingt es zum Beispiel der Selbstorganisation der Wissenschaft, die hohen Standards der Verlagslektorate mit Peer-Review-Verfahren o.Ä. aufrechtzuerhalten?
Verlage als Vermittler
Die große Bedeutung und Verantwortung von Verlagen als Anreger und Vermittler wissenschaftlicher Erkenntnisse wird gerade durch das Sterben der letzten großen Lexikonverlage in Deutschland wie dem Bibliographischen Institut und Brockhaus überdeutlich. Zwar wurde der Markenname Brockhaus von Bertelsmanns Abteilung Wissen Media erworben, 2013 aber bekannt gegeben, dass die Redaktion aufgelöst und künftig weder ein Printprodukt noch ein eigenes elektronisches Lexikon erarbeitet werden wird. Der Buchhandel hatte zwei Jahrhunderte lang – auf eigene Kosten – dafür gesorgt, dass Qualitätslexika in unterschiedlichen Preissegmenten für ein breites Publikum zur Verfügung standen. Bisher verstanden sich Verleger als Bewahrer und Vermittler von Wissen und Information, die Redaktionen unterhielten, welche wiederum nach kritischer Sichtung und Bündelung der Fakten verlässliche Lexika publizierten. Muss diese wichtige Aufgabe nun zum Beispiel von wissenschaftlichen Akademien als Langzeitprojekt- und damit von der Gesellschaft finanziert – übernommen werden, wenn man sich nicht auf die recht unterschiedlich fachkundigen Autoren einer im Netz verfügbaren freien Enzyklopädie verlassen möchte?
Diese und zahlreiche andere aktuelle Fragen des Medienumbruchs machen deutlich, welche wichtige kulturelle und ökonomische Rolle der Buchhandel bisher eingenommen hat und wie er über Jahrhunderte als Garant für Wissen und Bildung für jedermann gelten konnte. Wenn man Johannes Gutenberg (um 1400–1468) als den Vater der Massenkommunikation ansieht, so sind seine Erfindungen und Entwicklungen im Bereich von Satz, Druck, Lektorat und Vertrieb diejenigen Parameter, die den freien und ungehinderten Zugang zu Wissen und Bildung für jedermann in den letzten 550 Jahren garantierten. Eine kritische Reflexion seine Erbes könnte das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist, diesen freien Zugang auch unter veränderten technischen Bedingungen als eine zentrale kulturelle und gesellschaftliche Aufgabe weiter zu sichern.
Aufgaben der Buchwissenschaft
Die Buchwissenschaft als eine eigenständige akademische Disziplin in Deutschland untersucht genau diese kulturelle und ökonomische Rolle des Buches und des Handels in Geschichte, Gegenwart und Zukunft (Füssel 1997a, 261–263). Sie bedient sich daher notwendigerweise aus dem Methodenrepertoire der Literatur- und der Geschichtswissenschaft, der angewandten Sozialforschung, der Ökonomie und der Rechtswissenschaft. Die Buchwissenschaft ist eine durch ihren Untersuchungsgegenstand definierte Wissenschaft, aufgefächert durch die unterschiedlichen gesamtkulturellen Fragestellungen, die an diesen Gegenstand herangetragen werden.
Zielgruppe
Die vorliegende Einführung möchte bei der Wahl eines möglichen Studienfaches behilflich sein, beziehungsweise ganz konkret für Bachelorstudierende buchwissenschaftlicher Studiengänge Hintergrundinformationen bieten, die es ermöglichen, die Rolle und Bedeutung dieses Faches wissenschaftsgeschichtlich herzuleiten und in zentrale, ausgewählte Fragestellungen einzuführen sowie erste methodische Hinweise zu geben. In dieser Einführung in der bewährten Reihe der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft ist nicht daran gedacht, alle Facetten dieser vielschichtigen Disziplin bereits umfassend vorzustellen oder gar zu beantworten. Dazu stehen für den wissenschaftlichen Bereich ein breit angelegtes Handbuch (Buchwissenschaft in Deutschland, vgl. Rautenberg 2013a), fundierte Lexika (Lexikon des gesamten Buchwesens, 2. Überarb. Auflage) oder bei einzelnen Fragen im akademischen Unterricht hervorragende Spezialpublikationen zur Verfügung (vgl. zum Beispiel Verlagswirtschaft, von Lucius 2013a). Dieser Band wendet sich explizit an Studienanfänger der Buchwissenschaft oder der historischen sowie literatur- und medienwissenschaftlichen Nachbarfächer, die sich über wichtige Aspekte interdisziplinärer buchwissenschaftlicher Arbeitsfelder und Methoden informieren möchten. Zu verschiedenen Methoden finden sich fünf „Methodenwissen“-Kästen in diesem Buch, die auf einen Blick Grundlagen vermitteln. Literatur- und Linkverzeichnis sowie das Verzeichnis von weiteren nützlichen Adressen sollen helfen, einen Einstieg in das Fach zu erleichtern.
Historische Buchforschung
Die Leistung der Buchwissenschaft der letzten 65 Jahre in den deutschsprachigen Ländern liegt vor allem im Bereich der historischen Buchforschung, wobei grundlegende Untersuchungen zur Materialität der Kommunikation, zur Gutenberg- und Frühdruckforschung, zur Technikgeschichte, zum Zusammenhang zwischen Buch- und Bibliotheksgeschichte, aber auch zur Verlagsgeschichte und zur Buchhandelsgeschichte erschienen sind sowie in der „hervorragenden Einzelforschung wie der erfolgreichen praxisnahen Lehre“ (Schüller-Zwierlein 2010). Aus den Anfängen einer Hilfswissenschaft für die Geschichts- und Literaturwissenschaft entstanden, dann im Rahmen einer „Buchkunde“ zur Ausbildung von Bibliothekaren weiter entwickelt, wurden nach 1947 eigene Professuren in Mainz, München, Erlangen und Leipzig eingerichtet. Wissenschaftliche Gesellschaften begleiteten diese Entwicklung mit Tagungen und eigenen Publikationen, so u.a. die Historische Kommission des Börsenvereins, der Wolfenbütteler Arbeitskreis für Geschichte des Buchwesens oder die Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz. Buchwissenschaftliche Forschungen werden u.a. seit 1926 in dem weltweit führenden, fünfsprachigen Gutenberg-Jahrbuch im internationalen Kontext, im Archiv für Geschichte des Buchwesens seit 1957, im Leipziger Jahrbuch seit 1991, in den Mainzer Studien zur Buchwissenschaft seit 1994 oder neuerdings im Jahrbuch Kodex der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft (IBG) München präsentiert.
Wissenschaftsgeschichte
Diese Einführung geht den Weg, erstmals eine Wissenschaftsgeschichte der Buchwissenschaft (in Kapitel II) seit den Anfängen des Buchdrucks im 15. Jahrhundert aufzuzeigen, indem sie die Aussagen der Zeitgenossen über die Bedeutung des Buchdrucks kritisch reflektiert, die Bewertung des Buchdrucks in Enzyklopädien, Bibliografien und Selbstzeugnissen des Buchhandels analysiert und frühe buchwissenschaftliche Gesellschaften und institutionelle Einrichtungen vorstellt. Auf diese Weise ist es möglich, gleichzeitig eine kurze Einführung in wichtige Etappen der Buchgeschichte seit Gutenberg zu geben.
Eine erste grundlegende Auflistung der Fragestellung „Was ist Geschichte des Buchwesens?“ hatte 1976 – zeitgleich zur Gründung des Wolfenbütteler Arbeitskreises – der Direktor der Herzog August Bibliothek und Göttinger Germanist Paul Raabe vorgestellt (vgl. Raabe 1976 sowie Raabe 1984). Ein erstes praktikables Modell des Kommunikationskreislaufes des Buchs – und damit der unterschiedlichen Facetten seiner Erforschung – erstellte der renommierte Buchhistoriker und Gutenberg-Preisträger Robert Darnton (damals Princeton, heute Harvard Library, Cambridge, Massachusetts) im Jahr 1982 (vgl. Darnton 1982); sein Modell wurde und wird vielfältig diskutiert und – bedingt durch die technische Entwicklung – fortgeschrieben (vgl. Darnton 2005 und beispielsweise van der Weel 2001 sowie aktuell Murray/Squires 2013). Von einer reinen Modellanalyse zur Methodendiskussion ist es ein weiter Weg, den das Fach aber mit hohem Problembewusstsein seit zwanzig Jahren aufgeschlossen und kreativ geht und sich damit im wissenschaftlichen Diskurs als anschlussfähig erwiesen hat.
Sozialgeschichte
Sozialgeschichtliche Grundfragen nach dem „Sitz im Leben“ der Literatur kennzeichneten bereits die „Literärgeschichte“ im 18. Jahrhundert (siehe unten Kapitel II.2). Im Zuge einer sozialgeschichtlichen Betrachtung der Literatur in den Jahren nach 1968 fanden buchwissenschaftliche Fragestellungen häufiger als zuvor in literaturwissenschaftlichen Diskursen (und zum Beispiel in Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart oder in der Deutschen Literatur – eine Sozialgeschichte von Horst A. Glaser bei Rowohlt; vgl. auch Methodenwissen Sozialgeschichte auf S. 61–62) Berücksichtigung. In den 1970er Jahren wurden kurzzeitig Überlegungen einer eigenständigen „Bibliologie“ aus der Sowjetunion und aus Polen diskutiert, die aus einer gesellschaftswissenschaftlichen Perspektive die Rolle und die Bedeutung des Buchs zu analysieren suchte (vgl. Migon 1990). Vertreter der polnischen bibliologischen Schule in Deutschland war Alfred Świerk an der Universität Erlangen, nach dessen Theorie die Buchwissenschaft sich mit der „grafischen Materialisierung geistiger Inhalte, mit dem Ziel ihrer Erhaltung, Überlieferung und Verbreitung gemäß den Bedürfnissen und Erwartungen der Gesellschaft“ (Migon 1990, 8–9) beschäftigt. Wegen ihrer eindeutigen ideologischen Fixierung innerhalb der sozialistischen Staaten wurde diese Idee einer Bibliologie in den 1990er Jahren nicht weiter verfolgt.
Georg Jäger, München, griff aber im Kontext der Rolle des Buchs in der Gesellschaft die Frage auf, ob das Buchwesen nicht als „ein funktionelles gesellschaftliches System zu konzipieren sei“. Er nannte dies eine
vielversprechende wissenschaftstheoretische Option. Sie bietet Anschlussmöglichkeiten an die laufende Entwicklung der Systemtheorie sowie an die systemtheoretischen Modellierungen der Gesellschaft und einzelne ihrer Subsysteme. Ob es mithilfe der Systemtheorie gelingen wird, das Buch und den Buchhandel in all seinen Dimensionen (als technisches, kommunikatives, kulturelles und ökonomisches Phänomen) einheitlich zu modellieren, ist freilich eine offene Frage. (Jäger 1994, 276)
Historische Kulturwissenschaft
Die Mainzer Buchwissenschaft gab 1997 zu bedenken, ob nicht eine Historische Kulturwissenschaft nach dem Vorbild der französischen Schule der Annales mit ihrer sozialen Situierung des Buchmarktes und die anglo-amerikanischen Cultural Studies eine gute Orientierung für das Fach bieten könnten:
Eine den spezifischen Eigenschaften des Buches und seiner Rolle und Bedeutung in der Kultur und in der Gesellschaft gerecht werdende Fragestellung böte eine eindeutige kulturwissenschaftliche Perspektivierung, die sich als Wissenschaft vom Menschen und der von ihm gestalteten Welt begreift und die eine Integration der zersplitterten Wissenschaftsaspekte anstrebt, die Inhaltsanalyse und äußere Form, Biografie und Soziologie, Theologie und Philosophie, Handwerks- und Sozialgeschichte, rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte synthetisieren kann. Denn der Doppelcharakter des Buches als eines geistigen Wertes und als eines Handelsobjekts wird gerade dann genauer erfasst, wenn alle ideellen Strömungen einer Epoche ebenso berücksichtigt werden wie die zeitgenössischen ökonomischen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen. (Füssel 1997b, 63–64)
Auf ihren jeweiligen Gegenstand und auf den historischen Kontextbezogen, müsse die Buchwissenschaft die unterschiedlichen methodischen Zugänge der zu berücksichtigenden Nebenfächer heranziehen, sowie darüber hinaus die Wechselwirkung von Technikgeschichte und Geistesgeschichte in den Mittelpunkt der Untersuchungen stellen. Die Buchwissenschaft frage nicht nur, was (zum Beispiel) Gutenberg entwickelt habe, sondern in welchen Zusammenhängen er technikgeschichtlich stand, was von der Handschriftenära sinnvollerweise übernommen wurde, welche Leitgedanken seinen technischen Entwicklungen und auch der Auswahl der von ihm gedruckten Schriften zugrunde gelegen hätten. Es sei daher notwendig, ausgehend von der Materialität immer auch die geistigen Zusammenhänge, in diesem Kontext etwa des Humanismus oder Theologie, ebenso wie die rechtlichen Grundlagen und die wirtschaftlichen Faktoren zusammenzuführen (vgl. Füssel 1997b, 63–64; zu einigen Arbeitsfeldern der Buchwissenschaft als historische Kulturwissenschaft vgl. Kapitel III).
Buchwissenschaft als Medienwissenschaft
Der Medienumbruch der Gegenwart lässt die Buchwissenschaft mit ihrer Schwesterdisziplin, der Publizistik, und damit der Kommunikationswissenschaft immer stärker in einen methodischen Dialog treten. Hinzu kommt, dass das quantitativ-statistische Methodenrepertoire der Kommunikationswissenschaften und Methoden der empirischen Sozialforschung zunehmend auch in der Buchwissenschaft Anwendung finden (vgl. Methodenwissen Empirische Sozialforschung, S. 81–82). Ferner wird die ehemalige Trennung zwischen einer Individual- und einer Massenkommunikation heute differenzierter gesehen. Bereits bei der Analyse des frühen Buchdrucks werden nun – im Rahmen der Rezeptionsmöglichkeiten der Zeit – Aspekte der Massenkommunikation berücksichtigt. Beide Fächer untersuchen zum Beispiel die Wechselwirkung von frühen Flugblättern und -schriften als Vorstufe der periodischen Zeitung mit den zeitgleichen Buchpublikationen, die Herausbildung neuer Leser- und Käuferschichten, die Veränderungen der Leseprozesse, das Wechselverhältnis von Schulbildung und Lesefähigkeit etc.
Medienkonvergenz
Diese beispielhaft angeführten historischen Fragestellungen werden in der Gegenwart neu konfiguriert, da sich im Zeichen des Zusammenwachsens aller Medien nicht nur eine Konvergenz der Inhalte, sondern auch der Produktion und der Nutzung abzeichnet. Ein E-Book-Reader oder ein Tablet kombiniert künftig bisher statische Gattungen wie Zeitung, (Fach-)Zeitschrift, Sachbücher oder Belletristik mit Audio- und Videoinformation.
Da die Medienkonvergenz der Gegenwart nicht auf eine Addition der einzelnen Medien setzt, sondern im Gegenteil auf eine Verquickung von Text, Video- und Audioinformation zu einer eigenständigen neuen Einheit, müssen rechtliche und wirtschaftliche Aspekte sowie disziplinäre Fragestellungen neu diskutiert und zukunftsweisende methodische Überlegungen angestellt werden (vgl. Jenkins 2008). Der Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universität bietet dazu seit 2012 gemeinsame Methodenseminare an, die zu einer schon gelebten transdisziplinären Kooperation führen (vgl. Füssel 2012b).
Hybride Methodik
Die an dem Formalobjekt Buch orientierte Wissenschaft arbeitet mit einer hybriden Methodik: in ihren Kernfragen der historischen Buchforschung hat sie unter Anknüpfung an historische und literaturwissenschaftliche, rechtliche und ökonomische Methoden überzeugende Ergebnisse vorgelegt und ist dabei, mit medienwissenschaftlichen Methoden auch den Medienumbruch der Gegenwart kritisch zu reflektieren und jeweils fallbezogen in den unterschiedlichen Kontexten zu arbeiten.
Der weite Untersuchungsgegenstand und die breiten Fragestellungen ermöglichen es, den inzwischen jährlich über 200 Absolventen der Buchwissenschaft in Deutschland durch ausgewogene Studienpläne zwischen Wissenschaftlichkeit und Praxisorientierung eine gute Basis für Tätigkeiten in den unterschiedlichen Bereichen des Verlags, in Lektorat und Herstellung, Werbung, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit, in den Führungspositionen des Sortiments, in Redaktionen und Pressebüros, bei den Organisationen wie dem Börsenverein selbst, den Buchmessen, den Branchenjournalen, aber auch in Bibliotheken, Archiven und Museen sowie in der interdisziplinären Wissenschaft zu schaffen. Diese an den Interessen der Studierenden orientierte Einführung soll dazu das notwendige Rüstzeug und die wichtigste grundlegende Literatur und zentrale Fragestellungen vorstellen.