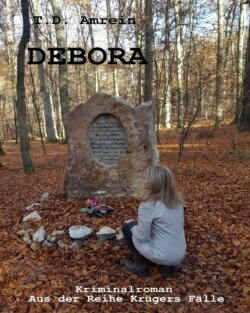Читать книгу DEBORA - T.D. Amrein - Страница 6
4. Kapitel
ОглавлениеCarmela bezog am Montag einen freien Tag. Sie hatte in den zwei letzten Nächten so wenig geschlafen, dass sie beim gemeinsamen Frühstück kaum die Augen offenhalten konnte. Debora kümmerte sich liebevoll um sie, schickte sie jedoch schließlich ins Bett zurück.
Sie schlief zwar ein, aber nach kurzer Zeit schreckte sie immer wieder hoch, weil sie von den Erlebnissen am Samstag träumte. Medikamente hatte sie bislang verweigert, sie dachte, auch so mit der Situation fertigzuwerden.
„Du hast ein klassisches Trauma“, hatte Debora gesagt. „Du brauchst eine Therapie.“
Noch bis letzten Samstag hätte Carmela ihr blindlings vertraut. Inzwischen quälte sie der Gedanke, ob Debora vielleicht doch diese Frau mit Absicht vom Dach gestoßen hatte. Aus blinder Eifersucht.
Carmela hatte sich noch nie Gedanken gemacht, wie lange sie mit Debora zusammenbleiben wollte. Solange es gut funktionierte, weshalb sollte sie sich eine Andere suchen. Oder sie verliebte sich spontan, wie sie es auch schon erlebt hatte. Wenn allerdings Debora schon mordete, bloß um eine mögliche Konkurrentin loszuwerden, was würde denn passieren, wenn sie verlassen wurde?
Vor allem irritierte sie, wie leicht Debora das alles wegsteckte. Sie hatte nur für einige Minuten die Fassung verloren, danach war sie wieder ganz normal.
Heute Morgen hatte sie ihr von einer Handtasche erzählt, die sie am Samstag im Elsass gesehen und unbedingt haben wollte.
Wie konnte sie, wenn sie an dieses Wochenende zurückdachte, auf eine Handtasche kommen?
Verdrängte sie das Geschehene einfach oder war es ihr egal? Oder noch schlimmer: hatte sie erreicht, was sie wollte?
***
Für Guerin begann der Montag mit Sichtung der ersten Ergebnisse der Spurensicherung, Claude kam schon bald darauf bei ihm vorbei, um ihm einen vorläufigen Bericht zu geben.
„Du hast also keine Wespenstiche gefunden“, wiederholte Guerin. „Was bedeutet, dass die Aussage dieser Frau Doktor nicht untermauert wird.“
„Aber es widerspricht ihr auch nicht direkt. Wespen können eine ängstliche Person in Panik versetzen, bevor sie tatsächlich gestochen wird“, wandte Claude ein.
„Ja natürlich“, erwiderte Guerin. „Trotzdem, es hätte meine Zweifel verkleinert.“
„Was lässt dich denn zweifeln?“, wollte Claude wissen.
„Schwierig zu erklären! Ihre Mimik oder besser gesagt ihre fehlende Mimik. Ich hatte bei der Befragung das Gefühl, mit einer Puppe zu sprechen. Ich habe sie mit Absicht provoziert, die Wut war ihr leicht anzumerken. Jedoch, ob sie gelogen hat, keine Ahnung?“
„Motiv?“, fragte Claude nach.
„Eifersucht!“
„Dafür hast du einen Anhaltspunkt, wenn du so schnell antwortest“, behauptete Claude.
„Ja“.
„Ich muss doch sehr bitten!“, sagte Claude.
Guerin lachte kurz auf. „Wenn du gerade dabei bist, mich zu verhören, wollte ich doch wissen, wie du es angehen würdest.“
Claude antwortete nicht, schüttelte nur den Kopf.
„Alle, außer ihrer Lebenspartnerin haben ausgesagt, dass Frau Werthemann intensiv, mit eben dieser geflirtet hat. Sie war auch die Einzige, die allein gekommen ist“, erklärte Guerin.
„Dann wäre es möglich, dass Frau Nagel das Wespennest gesehen und dann eiskalt die Gelegenheit ergriffen hat.“
„Genau so. Übrigens haben die Wespen sonst keinen gestört, allzu aggressiv können sie daher nicht gewesen sein“, fügte Guerin an.
Claude wirkte nachdenklich, schwieg jedoch.
„Da fällt mir gerade noch ein, was ich schon den ganzen Morgen nachsehen wollte.“ Guerin angelte nach einem dünnen Hefter, der am Rand seines nicht besonders gut aufgeräumten Schreibtisches lag. „Letzte Woche ist doch dieser Motorradfahrer reingekommen …“
Claude nickte. „Ja, ich weiß, welchen du meinst.“
„Der hatte ein Papier in der Tasche.“ Er schob ihm das in Folie eingelegte Blatt hin.
„Eine Rechnung“, stellte Claude emotionslos fest.
„Ja, aber von wem?“
„Von einem Piercingstudio. Stimmt, eine seiner Brustwarzen war offenbar frisch durchstochen und deshalb angeschwollen. Das habe ich doch in meinem Bericht so festgehalten. Also ist das keine große Neuigkeit oder worauf willst du hinaus?“ „Lies bitte den Briefkopf genauer!“
„Frau Dr. med. dent. Debora Nagel …
Ist doch kaum die Gleiche? Das wäre ja ein Riesenzufall!“, sagte Claude kopfschüttelnd.
„Das muss die Gleiche sein“, antwortete Guerin. „Keine zweite Zahnärztin in Basel mit diesem Namen. Basel ist keine Millionenstadt und der Name Nagel ist dort auch nicht gerade häufig.“
„Über deutsche Namen weiß ich natürlich nicht so genau Bescheid wie du“, gab Claude zu.
„Du hast auch keine Anzeichen für ein Fremdverschulden gefunden, wenn ich mich richtig erinnere?“
„Nein, da war gar nichts, nicht einmal Alkohol. Zumindest was die Standardtests hergeben, eine gezielte toxische Untersuchung war nicht vorgesehen“, antwortete Claude.
„Würdest du das dann bitte nachholen!“
„Ja natürlich. Dauert allerdings mindestens zwei Wochen, bis die Ergebnisse da sind“, gab Claude schulterzuckend zurück.
„Diesmal ist mir das egal! Bis ich die Dame gründlich durchleuchtet habe, werden sicher auch noch einige Wochen vergehen“, antwortete Guerin. „Ich muss mit Kommissar Gruber aus Basel sprechen. Bin gespannt, ob der etwas über sie hat.“
„Grüß ihn von mir!“
„Ja, mache ich bestimmt“, versprach Guerin.
***
Michélle traf am Dienstagmorgen auf der Ortsverwaltung von Hausen ein. Sieber hatte für sie eine Aufstellung mit den Personen, die sie befragen wollte, im Voraus bestellt. So dass sie diese nur noch abzuholen brauchte.
Die Liste umfasste alle Einwohner von Hausen mit den Jahrgängen vor 1932. Total achtzehn Namen, zusammen mit den Adressen.
Michélle hatte sich für die erste Befragung die beiden Ältesten mit Jahrgang 1905 und 1910 ausgesucht.
Von diesen Zeitzeugen erhoffte sich Michélle nicht nur Einzelheiten über die verschwundene Familie, sondern auch allgemeine Auskünfte über die damaligen Lebensumstände.
Helga Attinger wohnte im Altersheim am Ort, mit ihren fünfundachtzig Jahren war sie die Älteste der Auswahl. Nachdem Michélle ihr erklärt hatte, was sie von ihr wollte, verschwand das Lächeln auf dem Gesicht der Alten.
„Wie ich das Kriegsende erlebt habe!“, moserte sie. „Wozu brauchen Sie das denn?“
„Es interessiert mich einfach“, behauptete Michélle keck.
„So so, es interessiert Sie. Wie war doch gleich der Name?“
„Steinmann, Michélle.“
„Verheiratet?“
„Nein.“
Die Alte kicherte. „Ich hab auch keinen abgekriegt. Als ich noch ganz jung war, wollte ich keinen. Im Krieg waren dann kaum noch Männer da und danach war ich schließlich zu alt“, stellte sie ziemlich nüchtern fest.
„Ich habe einen festen Freund“, verteidigte sich Michélle.
„Aber er will dich nicht heiraten?“, bohrte die Alte.
„Das weiß ich nicht“, antwortete Michélle schon etwas verlegen. Dass die Alte schon zum du übergegangen war, irritierte sie, dazu der penetrant forschende Blick.
„Wieso weißt du das nicht? Merkst du das nicht? Es reicht ihm, dass du die Beine breitmachst wie die meisten. Sobald er dich überhat, sucht er sich das nächste Küken, das auf einen Ehemann hofft.“
Jetzt wurde Michélle richtig rot. „Wir kennen uns noch nicht so lange, aber er ist sehr nett“, versuchte sie.
„Was meinst du, wie oft ich das gesehen und erlebt habe, Mädchen. Die Männer sind immer gleich! Sobald du nachgegeben hast, ist der Reiz vorbei und du darfst noch die Lücke füllen, bis er eine Neue gefunden hat.“
Michélle wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Die Art, wie Helga mit ihr sprach, schockierte sie. Immerhin schien sie gewisse, eigene Erfahrungen gemacht zu haben.
Die ihr alle romantischen Illusionen ausgetrieben hatten?
Ein schwacher Schauer durchfuhr Michélle. War sie sich mit Eric wirklich so sicher?
Leiser Argwohn hatte sich auch schon mal eingeschlichen, wenn eine besonders hübsche Frau in der Nähe gewesen war. Das musste sie sich eingestehen.
„Ich sehe dir an, was du denkst“, fuhr Helga fort. „Stell ihm ein Ultimatum! Halt ihn dir vom Leib, bis er sich entschieden hat! Das ist der beste Rat, den ich dir geben kann.“
„Bitte, Frau Attinger!“, versuchte Michélle einen neuen Anlauf. „Ich werde über Ihren Rat nachdenken. Aber eigentlich wollte ich nicht über mich sprechen. Was haben Sie denn nun in der letzten Zeit des Krieges erlebt? Wie war Ihr Frühling 1945?“
Dass sie das Gespräch aufzeichnen wollte, hatte sie völlig vergessen. Aufmunternd lächelte sie die Alte an.
„Arbeitest du für die Zeitung?“, fragte Helga, anstelle einer Antwort.
Michélle seufzte. „Nein, ich bin Polizeibeamtin, wie ich doch am Anfang gesagt habe.“
„Nehmen die jetzt auch Frauen oder willst du nur angeben? Weshalb trägst du denn keine Uniform? Hast du einen Ausweis?“
Michélle dämmerte, dass das Gespräch kaum von Nutzen sein würde. Trotzdem kramte sie ihren Ausweis hervor und legte ihn vor der Alten hin.
„Wo habe ich nur meine Brille gelassen?“, jammerte Helga. Sie stand auf und begann zu suchen.
Michélle wartete geduldig.
„Weißt du, ich lege sie immer an den gleichen Platz. Aber dort ist sie nie, wenn ich sie brauche“, erklärte Helga, während sie mit den Händen über die Möbel tastete.
Plötzlich blieb sie stehen. „Wie war doch gleich der Name?“
„Michélle, Michélle Steinmann.“
„Hörst du, Michélle, ruf eine Schwester! Die wissen immer, wo die Brille ist.“
„Soll ich vielleicht helfen?“, fragte Michélle nach.
„Du willst doch nur sehen, was es bei mir zu holen gibt! Ich bin zwar alt, aber nicht so dumm, wie du denkst!“, giftete Helga zurück.
Michélle schluckte leer, die Alte tat ihr leid. Aber was sollte sie machen? Umständlich klaubte sie ihren Ausweis von der Glasplatte, die über das Tischtuch gelegt war.
„Du hast da etwas weggenommen! Ich habe es genau gesehen!“, hörte sie Helga sagen.
„Ich gehe jetzt und lasse Sie in Ruhe“, versuchte sie, die Alte zu beruhigen.
„Du bleibst da, bis die Polizei kommt!“, rief Helga jetzt laut. „So eine wie du, die muss man einsperren!“
Michélle versuchte, rückwärts zur Tür zu gelangen, was Helga offenbar erwartet hatte. Sie war schneller als Michélle auf dem Flur, wo sie laut um Hilfe zu rufen begann.
Michélle blieb stehen, wartete ab. Auf den ersten Blick hatte Helga doch noch ganz klar gewirkt. Aber jetzt verschlimmerte sich ihr Zustand so schnell, dass wohl nur noch das Personal des Heimes helfen konnte.
„Inzwischen schleppte Helga eine Schwester in ihr Zimmer. „Da ist sie!“, rief sie triumphierend. „Die französische Vagabundin, die meine Sachen gestohlen hat!“
Die Schwester zuckte nur mit den Schultern und lächelte Michélle dabei an.
„Halt sie fest!“, verlangte Helga. „Sie muss alles zurückgeben.“
„Weißt du denn, wer sie ist?“, fragte die Schwester.
„Sie heißt Michélle“, flüsterte Helga. „Sie denkt, ich merke es nicht, wenn sie stiehlt. Aber ich habe es gesehen. Französinnen kann man nicht vertrauen, weißt du“, versuchte sie, die Schwester zu überzeugen.
Diese antwortete ganz ruhig. „Helga, das ist doch keine Französin. Sie spricht doch unseren Dialekt und arbeitet bei der Freiburger Polizei.“
„Meinst du?“, sagte Helga zögernd. „Aber warum stiehlt sie dann?“
„Sie ist nicht so eine, glaub mir Helga. Sie ist nett!“, versicherte die Schwester.
„Ich bin so müde“, jammerte Helga plötzlich. „Bringst du mich zu Bett?“
Auf dem Flur wollte die Schwester dann doch noch wissen, was geschehen war.
Michélle versuchte, es zu erklären: „Am Anfang war sie ganz normal. Dann plötzlich ist sie wie umgekippt. Ich habe ihr nur ein paar Fragen gestellt, wie abgemacht.“
„Manchmal hat sie solche Momente, so schlimm war es bisher allerdings noch nie. Normalerweise kommt sie gut allein zurecht“, antwortete die Schwester. „Ich denke, dass sie sich morgen nicht mehr an Sie erinnert, also machen Sie sich keine Sorgen. Ein Arzt wird sie noch untersuchen. Wir geben jedoch so lange wie möglich keine Medikamente. Bis es dann einfach nicht mehr geht, ohne.“
Michélle fühlte sich trotzdem irgendwie schuldig. Beim Abschied wünschte sie alles Gute für Frau Attinger. Die Schwester nahm es lächelnd zur Kenntnis.
Helga schmunzelte inzwischen zufrieden unter ihrer Decke. Die würde bestimmt nicht wiederkommen. Ausgerechnet so ein unerfahrenes Küken wollte sie ausfragen. Die wusste doch nichts vom echten Leben. Wie es sich anfühlte, von verschwitzen französischen Soldaten überall angefasst zu werden. Tagelang in Todesangst auf einem Dachboden auszuharren. Wenige Meter neben einem plätschernden Brunnen fast zu verdursten, weil sich unten eine Gruppe Besatzer eingenistet hatte.
Ihr Mann und ihr Vater waren zwar inzwischen tot. Trotzdem würde sie beide schützen bis zum Ende. Sie hatten während des Krieges heimlich geheiratet. Ihr Vater hatte ihm damals einen guten Posten bei der Gestapo verschafft, wo er selbst in leitender Position angestellt gewesen war.
Nach der Niederlage lebten sie als entfernte Verwandte zusammen. Er mit falscher Identität, sie hatte einfach ihren Mädchennamen behalten. Unter den zahlreichen, aus dem Osten Vertriebenen, die sich hier in der Gegend niedergelassen hatten, fiel ein Einzelner mit unklarer Herkunft kaum auf.
Außer, dass sie ab und zu gefragt wurden, weshalb sie nicht heirateten, war das Leben fast normal gewesen. Dass sie deshalb keine Kinder haben durften, darüber war Helga jedoch heimlich froh gewesen. Eine der wenigen Lügen, die sie ihm zugemutet hatte.
Ansonsten hatte sie ihm alles gegeben, was er wollte. Sie hatte ihn sogar verwöhnt, so gut, wie es gegangen war. Kinder hätten da bloß gestört.