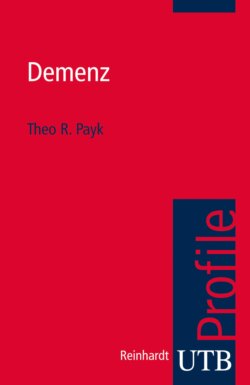Читать книгу Demenz - Theo R. Payk - Страница 7
ОглавлениеEinführung
Nicht nur die überfüllten Wartezimmer der Arztpraxen und die langen Wartezeiten auf einen psychiatrischen oder psychologischen Untersuchungstermin signalisieren eine stete Zunahme geistig-seelischer Probleme während der letzten Jahrzehnte. Auch die Aufschlüsselungen der Krankenkassen und Sozialversicherungen lassen ein kontinuierliches Anwachsen psychischer Störungen in den Industrieländern erkennen; von sämtlichen Erkrankungen sind sie neben Infektionen und orthopädischen Beschwerden im Laufe der letzten zehn Jahre nach und nach auf die obersten Ränge aller Krankheiten gerückt. Während der letzten 20 Jahre war ein Zuwachs von rund 30 % dieserart Behandlungsfälle zu verzeichnen, einhergehend mit einer Verdoppelung der Gesamtkosten innerhalb der letzten fünf Jahre, die derzeit in Deutschland um 1.6 Milliarden Euro jährlich liegen. Die meisten vorzeitigen Berentungen erfolgen wegen psychischer Leiden, in Deutschland jährlich rund 50.000 Mal.
Während Psychosen und verwandte Störungen auf einem konstanten Häufigkeitsniveau verblieben sind, haben – neben Depressionen und Angstkrankheiten – alle möglichen Formen geistiger Beeinträchtigungen unter dem Oberbegriff „Demenz“ deutlich zugenommen. Abgesehen von den damit verbundenen volkswirtschaftlichen Belastungen, geht jede Demenzerkrankung nicht nur für den Betroffenen, sondern meist auch für die Angehörigen und nächsten Bezugspersonen mit erheblichen Belastungen und Einschränkungen einher.
Ausreichende Kenntnisse über die Art und den Verlauf einer Demenz helfen, den Kranken besser zu verstehen und angemessen mit ihm umzugehen. Dem damit verbundenen Lern- und Aufklärungsbedarf von direkt und indirekt Betroffenen soll im Folgenden Rechnung getragen werden, indem über die verschiedenen Arten und Formen demenzieller Krankheitsbilder informiert wird.
Dargestellt werden die typischen Erkrankungsbilder unter Einbeziehung von drei exemplarischen Krankheitsfällen. Genauer beschrieben werden Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben sowie Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit, die als Symptome einer beginnenden Demenz in Frage kommen, außerdem die gängigen Untersuchungsmethoden, die zur Diagnose führen. In diesem Zusammenhang werden die aktuellen Hypothesen zu den Entstehungsrisiken und -ursachen 8skizziert bzw. die mehrdimensionalen Krankheitsmodelle reflektiert. Schließlich wird das Repertoire der modernen, allgemein-medizinischen, psychiatrisch-psychologischen und psychosozial-pflegerischen Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen erläutert und begründet. Abschließend wird auf rechtliche Fragen eingegangen.
Alles in allem sollen diese Informationen dabei helfen, den Krankheitsprozess differenziert wahrzunehmen, sinnvoll einzuordnen und realistisch zu bewerten. Mögen sie Mut machen, nicht vor den hohen körperlichen und seelischen Anforderungen zu kapitulieren, die eine Demenz an alle Beteiligten stellt, sondern die veränderte Lebenssituation so erträglich wie möglich zu gestalten. Fachlich Interessierte und beruflich engagierte Angehörige pflegender, helfender und heilender Professionen werden eher Zugang zu den wissenschaftlichen Grundlagen der verschiedenen Demenzkrankheiten finden.
Vorkommen
An einer Demenz gleich welcher Art erkrankt sind in Deutschland – bei einem Gefälle von Ost nach West – etwa 1.2 Millionen Menschen mit weiter steigender Tendenz, was jährliche Neuerkrankungen von ca. 280.000 bzw. ein Nettozuwachs von ca. 35.000 Personen pro Jahr bedeutet. Dass deutlich mehr als die Häfte der Betroffenen Frauen sind, wird in erster Linie mit deren höherer Lebenserwartung erklärt. Zwei bis drei Prozent der Demenzen entfallen auf Personen unter 65 Jahren.
Wegen ihres meist unmerklichen Beginns wird die Krankheit anfangs oft nicht erkannt bzw. ihre Symptome werden als Ausdruck seniler Verschrobenheiten gedeutet und bestenfalls als altersbedingte Marotten belächelt. Im Gegensatz zu vielen anderen psychischen Störungen bilden sich die meisten Demenzerkrankungen jedoch nicht zurück, sondern führen zu einer fortschreitenden Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit, begleitet von einer Veränderung der gesamten Persönlichkeit – für jeden Einzelnen eine menschliche Tragödie. Trotz intensiver Forschungen zur Entstehung und Behandlung demenzieller Krankheitsprozesse gibt es bislang für die Betroffenen keine Heilung, allerdings etliche Hilfsmittel zu deren Linderung und zu einem Management des Leidens.
Anders als der Großteil schwererer geistig-seelischer Erkrankungen tritt eine Demenz überwiegend im fortgeschrittenen Lebensalter auf, dann allerdings mit zunehmender, steil ansteigender Häufigkeit. Liegt 9die Erkrankungswahrscheinlichkeit in den Industriestaaten mit 65 Jahren um etwa 1.5 %, steigt sie ab dann kontinuierlich an: Zehn Jahre später sind etwa 6–8 % der Menschen betroffen, mit 85 Jahren etwa ein Viertel der Bevölkerung, ab dem neunten Lebensjahrzehnt zeigt jeder Zweite Symptome einer Demenz.
Merksatz
Die Wahrscheinlichkeit, an einer fortschreitenden Demenz zu erkranken, steigt mit dem Älterwerden rapide an. Derzeit gibt es in Deutschland ca. 1.2 Millionen Demenzkranke verschiedener Ursachen mit jährlichen Nettozuwachsraten um ca. 35.000.
Bestandsaufnahme
Die Bezeichnung „Demenz“, für die auch volkstümliche Ausdrücke wie „Altersschwachsinn“, „Senilität“, „Hirnverkalkung“ oder „Zerebralsklerose“ gebräuchlich sind, entstammt dem lateinischen Begriff „de mente“, was soviel bedeutet wie „von Sinnen“. Mit ihm wurden ursprünglich allgemein psychische Ausnahmezustände wie „Wahnsinn“ oder „Tollheit“ bezeichnet. Erst mit der Renaissance änderte sich die Bedeutung von „Dementia“. So hob der Baseler Stadtarzt und Medizinprofessor Felix Platter (1536–1614) als Hauptmerkmal der demenziellen „Verblödung“ die Vergesslichkeit („Oblivio“) hervor. Er beschrieb in diesem Zusammenhang Greise, die nicht nur ihre frühere geistige Beweglichkeit verloren hatten, sondern auch die Fähigkeit, Neues aufzunehmen. Als Ursachen vermutete Platter erbliche Gründe, Hirnschädigungen oder „Alterseinwirkungen“.
Der berühmte Pariser Psychiater Jean Etienne Dominique Esquirol (1772–1840) zählte als besondere Demenz-Merkmale Einschränkungen des Gedankenreichtums, der Wahrnehmungsfähigkeit und der Gedächtnisleistungen auf. Sein Lehrer Philippe Pinel (1745–1826), der große Reformer des Irrenwesens am Pariser Hôpital Salpêtrière, nannte den Demenzkranken einen „arm gewordenen Reichen … geschwächt an Empfindung, Intellekt und Willen“. In der Folgezeit wurde erstmals ein Zusammenhang zwischen einer Demenz und einer progressiven Paralyse als Spätfolge einer Syphilis-Erkrankung vermutet, deren Verursachung durch Bakterien vom Typ der Spirochäte erst zu Beginn des
20. Jahrhunderts nachgewiesen werden konnte. Diese Demenzform, 10gekennzeichnet durch eine hochgradige geistige Zerrüttung und ein jahrelanges körperliches Siechtum, war neben der alkoholbedingten Demenz gefürchtet, weil sie meist schon während der ersten Lebenshälfte auftritt und damals nicht zu heilen war.
Schon von den altgriechischen Ärzten im 5. Jahrhundert v. Chr., sodann vor allem vom „Vater der Medizin“, Hippokrates (um 460–370 v. Chr.), wurde das Gehirn als Sitz der Seele angesehen. Aus dieser Tradition heraus brachten die byzantinischen und arabischen Ärzte der ersten Jahrhunderte n. Chr. geistigen Abbau und Persönlichkeitsveränderungen mit einem altersbedingten Hirnschwund in Zusammenhang. Jedoch gelang erst dem Münchener Psychiater Alois Alzheimer (1864–1915) im Jahr 1906 die genauere hirnpathologische Aufklärung der später nach ihm benannten Krankheit.
Die heute weitaus häufigeren Formen der Alzheimerdemenz und der durch mangelhafte Hirndurchblutung bedingten Demenz als Erkrankungen der zweiten Lebenshälfte wurden damals nur selten beobachtet, da die durchschnittliche Lebenserwartung in Europa im Vergleich zu heute etwa ein Drittel niedriger war. Das 60. Lebensjahr erreichten noch im 19. Jahrhundert allenfalls 10 % der Bevölkerung – bei einer voraussichtlichen Lebensdauer von 35 bis höchstens 40(!) Jahren. Heute liegt die Quote etwa vier Mal so hoch; in Deutschland beträgt die statistische Lebenserwartung inzwischen 82.4 Jahre für Frauen und 77.2 Jahre für Männer. Pflegebedürftig sind ca. 2.4 Millionen Personen.
Seit 1936 in England erstmals die Altersgrenze von 100 Jahren überschritten wurde, hat die Anzahl Hundertjähriger dank verbesserter sozioökonomischer Lebensbedingungen und enormer medizinischer Fortschritte kontinuierlich zugenommen. In Deutschland gibt es derzeit rund 22 Millionen Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Ab diesem Alter wächst die Quote der Demenzkranken, von denen die meisten zur Gruppe der Alzheimerpatienten gehören, drastisch an.
In der Grundsatzerklärung der Vereinten Nationen (der sog. Wiener Deklaration) von 1982 wurden folgende Lebensziele für alte Menschen formuliert:
• Unabhängigkeit,
• Mitbestimmung,
• Pflege,
• Selbstverwirklichung und
• Würde.
11
Die 2008 paraphierte, europäische Charta der Grundrechte im sog. Vertrag von Lissabon hebt in Artikel 25 Würde, Gleichstellung und Unabhängigkeit alter Menschen mit Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben besonders hervor. Vor dem Hintergrund dieser Leitlinien wird angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung in den westlichen Industrieländern der Pflegeaufwand für Demenzkranke in Zukunft zu den wichtigsten gesundheitspolitischen und volkswirtschaftlichen Problemen gehören. Die statistischen Daten sind alarmierend: Schon jetzt sind sieben von zehn Heimbewohner demenzkrank. In Deutschland werden die direkten und indirekten Kosten zur Behandlung und Betreuung der Demenzkranken – davon fast zwei Drittel Alzheimer-Patienten – derzeit mit rund 5,7 Milliarden Euro jährlich beziffert.
Europaweit ist vorerst mit einer Nettozunahme um jährlich 150.000 bis 200.000 Patienten zu rechnen. Auf Drängen des Europäischen Parlaments soll der Kampf gegen Alzheimer-Demenz, an der in Europa etwa sieben Millionen Personen leiden, in der europäischen Gesundheitspolitik in Zukunft Vorrang bekommen.
Die Zahl wird wahrscheinlich weiterhin ansteigen, falls im Frühstadium durch medizinische Einwirkungen keine nachhaltige Unterbrechung des Krankheitsprozesses oder gar dessen Umkehr erreicht wird. Bis zum Jahr 2050 werden in Deutschland bzw. Europa schätzungsweise doppelt so viele Menschen wie heute an Demenz erkrankt sein. Pessimistische Schätzungen gehen sogar von noch größeren Zuwächsen für den Fall aus, dass durch präventive, d. h. krankheitsvorbeugende Maßnahmen, wie z. B. eine gesunde Lebensweise, keine Trendwende gelingt.
Die Forschung läuft auf Hochtouren. Und ähnlich wie bei der AIDS-Forschung drängt die Zeit. Auch wenn fast monatlich von Fortschritten (aber auch enttäuschten Hoffnungen) berichtet wird, bedeutet das nicht, dass in absehbarer Zeit ein Heilmittel verfügbar sein wird.
Eine Demenz ist in erster Linie durch einschneidende, erst irritierende und ärgerliche, bald frustrierende, dann schmerzliche kognitive Einbußen gekennzeichnet, d. h. durch Beeinträchtigungen im Bereich von Wahrnehmen und Erkennen, Erfassen und Begreifen, Verstehen und Denken, Behalten und Erinnern, Vorstellen und Planen. Schon der irische Schriftsteller Jonathan Swift (1667–1745) schildert in dem bekannten Roman „Gullivers Reisen“ solche Symptome: So hört der Protagonist Lemuel Gulliver während seines Besuches der Insel Luggnagg von den unsterblichen „Struldbrugs“, die ab dem 80. Lebensjahr als Tote betrachtet werden. Sie vergessen im hohen Alter alle möglichen Bezeichnungen und Namen und können kein Gespräch mehr führen.
12
Nach heutigem Stand der Wissenschaft gibt es für den typischen Demenzkranken keinen Weg mehr zurück in die Normalität, in den Alltag von routinierten Gepflogenheiten und vertrauten Gewohnheiten, erst recht keine Weiterentwicklung in kreativ-schöpferisches Neuland. Schritt für Schritt und unaufhaltsam vermindern sich die wichtigsten Potenziale des Verstandes: Konzentration, Aufmerksamkeit, Interesse, Neugier, Anteilnahme, Verständnis, Gedächtnis und Orientierung.
Während von anderen psychischen Krankheiten Betroffene sich meist nur eine Zeit lang in eine verfremdete, vielleicht beängstigende oder bedrückende Erfahrungswelt verirren, ehe sie wieder in ihren normalen Lebensrhythmus zurückfinden, gerät der Demente in eine sich immer stärker verengende geistige Sackgasse. Anders als bei anderen psychischen Erkrankungen ist er mit dem verhängnisvollen Fortschreiten der Demenz auch immer weniger in der Lage zu begreifen, welch schweres Schicksal ihm zuteil wurde. Ohne Aussicht auf eine Umkehr verarmt und verkümmert das reiche Kapital, das eine Persönlichkeit in all ihren Facetten ausmacht. Der einst womöglich intellektuell brillante, tatkräftige und erfolgreiche Mensch entwickelt sich quasi zurück zum hilflosen Säugling, der am Ende rundum gepflegt werden muss.
Demenzpatienten verlieren unwiderruflich die Welt, ehe sie ihr selbst verloren gehen. Diesen schrittweisen Abschied menschenwürdig zu begleiten, ist eine hochrangige Aufgabe einer humanen Zivilgesellschaft – wie überhaupt der Umgang mit den Schwächsten ihrer Mitglieder, den Kindern, Alten, Kranken und Leidenden.
Merksatz
Die Zunahme demenzieller Störungen während der letzten Jahrzehnte ist unverkennbar. Bis zum Jahr 2050 wird sich deren Anzahl voraussichtlich nochmals verdoppeln, was enorme gesundheitspolitische Anstrengungen und einschneidende gesellschaftliche Anpassungen erforderlich machen wird. In Europa werden dann ca. 15 Millionen Demenzkranke leben.
Literatur
Füsgen, I. (2001): Demenz. 4. Aufl. Urban & Vogel, München
Kastner, U., Löbach, R. (2007): Handbuch Demenz. Urban & Fischer, München
Mahlberg, R., Gutzmann, H. (2009): Demenzerkrankungen. Deutscher Ärzte-
verlag, Berlin
13