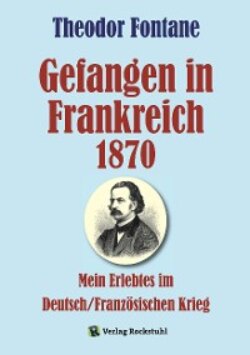Читать книгу Gefangen in Frankreich 1870 - Theodor Fontane, Theodor Fontane - Страница 5
Domremy*.
Оглавление(* Geburtsort der Jeanne d’Arc, der „Jungfrau von Orleans“)
Am 2. Oktober war ich in Toul. Ich kam von Nancy. Nancy ist eine Residenz, Toul ist ein Nest. Es machte den Eindruck auf mich wie Spandau vor dreißig Jahren. Die Kathedrale ist bewunderungswürdig, das Innere einer zweiten Kirche (St. Jean, wenn ich nicht irre) von fast noch größerer Schönheit; aber von dem Augenblick an, wo man mit diesen mittelalterlichen Bauten fertig ist, ist man es mit Toul überhaupt.
In zwei Stunden hatt’ ich diese Sehenswürdigkeiten hinter mir, und dennoch war ich gezwungen, zwei Tage an dieser Stelle auszuhalten. Dies hatte darin seinen Grund, daß unmittelbar südlich von Toul das Jeanne-d’Arc-Land gelegen ist, und daß es, dank dem Kriege und den Requisitionen, unmöglich war, in der ganzen Stadt einen Wagen aufzutreiben. Die Partie selber aufzugeben schien mir untunlich: ich hätte jede Mühe und jeden Preis daran gesetzt. Endlich am Nachmittage des zweiten Tages, hieß es: Madame Grosjean hat noch einen Wagen. Ich atmete auf. In einem schattigen Hinterhause, dicht neben der Kathedrale, fand ich die genannte Dame, die bei zurückgeschlagenen Gardinen in einem großen Himmelbett saß. Sie war krank, abgezehrt, hatte aber die klaren, klugen Augen, die man so oft bei hektischen Personen findet, und die nie eines Eindrucks verfehlen. Wir unterhandelten in Gegenwart zweier Gevatterinnen, die mindestens ebenso gesund waren wie Madam Grosjean krank. Das Geschäftliche arrangierte sich leicht; nur ein Übelstand blieb, an dem auch jetzt noch die Partie zu scheitern drohte: das einzige vorhandene Gefährt, ein char à banc (Wagen mit Seitenbank), war nämlich zerbrochen, und Mr. Jacques, Schmied und Stellmacher, hatte erklärt, überbürdet mit Arbeit, die Reparatur nicht machen, keinesfalls aber den Wagen abholen lassen zu können. In diesen letzten Worten schimmerte doch noch eine Hoffnung. Ich eilte also auf die Straße, engagierte zwei Artilleristen vom Regiment „Feldzeugmeister“, spannte mich selbst mit vor, und im Trabe jagten wir nun mit der leichten Kalesche über das holprige Pflaster hin, in den Arbeitshof des Mr. Jacques hinein. Dieser war ein Hüne, also gutmütig, wie alle starken Leute. Meine Beredsamkeit in Etappenfranzösisch amüsierte ihn ersichtlich, und wir schieden als gute Freunde, nachdem er versprochen hatte, bis Sonnenuntergang die Reparatur machen zu wollen. Er hielt auch Wort.
In der Dämmerstunde klopfte es an meine Tür. Ein Blaukittel trat ein, teilte mir mit, daß er der „Knecht“ der Madame Grosjean sei, und daß wir am andern Morgen 7 Uhr fahren würden. Soweit war alles gut. Aber der Blaukittel selbst flößte mir wenig Vertrauen ein, am wenigsten, als er schließlich versicherte, die Partie sei in einem Tage nicht zu machen, wir würden nach Vaucouleurs fahren, von dort nach Domremy und von Domremy wieder zurück nach Vaucouleurs, aber mehr sei nicht zu leisten; in Vaucouleurs müßten wir übernachten. Er berief sich dabei auf einen russischen Grafen, mit dem er vor Jahresfrist dieselbe Partie gemacht habe, und begleitete seine Rede, die mir aus nichts als aus den vollklingenden Worten „Kilometer“ und „quatre-vingt-douze“ (Zweiundneunzig) zu bestehen schien, mit den allerlebhaftesten Gesten. Ein starker Verdacht schoß mir durch den Kopf; wer indessen viel gereist ist weiß aus Erfahrung, daß auf solche Anwandlungen nicht allzuviel zu geben ist, und ich entließ ihn ohne weiteres mit einem kurzen: Eh bien, demain matin 7 heures. (Gut, morgen früh, um 7 Uhr.) Ich freute mich sehr auf diesen Ausflug. Das Mißtrauen, das so plötzlich in mir aufgestiegen war, galt mehr dem Blaukittel in Person als der Gesamtsituation, und dieser Person glaubte ich schlimmstenfalls Herr werden zu können. Ich lud meinen Lefaucheurrevolver und wickelte ihn derart in meine Reisedecke, daß ich durch einen Griff von rechts her in die nun muffartige Rolle hinein den Kolben packen und eine „Gefechtsstellung“ einnehmen konnte. Ich muß dies erwähnen, weil es zu einer späteren Stunde von Wichtigkeit für mich wurde. Daß ich den Revolver nicht mir führte, um etwa auf eigene Hand Frankreich mit Krieg zu überziehen, brauch’ ich wohl nicht erst zu versichern; man hat aber die Pflicht, sich gegen mauvais sujets und die Frechheiten des ersten besten Strolches zu schützen.
7 Uhr früh rasselte der Wagen über das Pflaster und hielt vor meinem Hotel. Ich war fertig; eine Viertelstunde später lag Toul hinter uns.
Bis Vaucouleurs sind drei Meilen. Von rechts her traten mächtige Weingelände, in der Mitte des Abhangs mit helleuchtenden Dörfern geschmückt, bis an die Straße heran; nach links hin dehnten sich Fruchtfelder, dahinter Bergzüge, oft in blauer Ferne verschwimmend. Es war eine entzückende Fahrt; die Chaussee bergansteigend und wieder sich senkend, dann und wann ein Flußstreifen, eine Wassermühle, dazu rund umher das Herbstlaub in hundert Farben schillernd. Ehe wir noch die erste große Biegung des Weges erreicht hatten, erfüllte sich, was sich immer zu erfüllen pflegt: ein Fußgänger stand am Wege und bat, aufsteigen zu dürfen. Der Kutscher stellte ihn mir als einen seiner „Freunde“ vor. Ich kann nicht sagen, daß er mir dadurch besonders empfohlen worden wäre, und ich rückte meine Reisedecke etwas unwillkürlich zurecht. Ich hatte aber unrecht. Der neue Fahrgast erwies sich als eine freundlicher, angenehmer Mann; plaudernd über Krieg und Frieden fuhren wir um 10 Uhr in Vaucouleurs hinein.
Ein reizender kleiner Ort. Der Kutscher hatte zwei Stunden dafür festgesetzt, Zeit genug, die alte Kapelle und das leidlich wohlerhaltene Schloß des „Ritters Baudricourt“, das die Stadt beherrscht, zu besuchen. Über diese Einnerungsstätte zu berichten, ist hier nicht der Ort. Um 12 Uhr weiter nach Domremy.
Domremy, das von den Bewohnern dortiger Gegend immer nur Dormy ausgesprochen wird, liegt noch dritthalb Meilen südlich von Vaucouleurs. Das Terrain verändert sich hier etwas und nimmt mehr und mehr den Charakter eines Degilees (Hohlweg, Engpaß) an. Die Höhenzüge zur Rechten bleiben dieselben; aber von gegenüber treten die Berge näher heran, während unmittelbar zur Linken ein breites Wiesental sich zieht, drin die Meuse fließt; das Ganze nicht ohne Reiz, aber ein wenig kahl und verbrannt, voll frappanter Ähnlichkeit mit dem Nuthetal, das sich von Potsdam aus, an Saarmund vorbei, bis hinauf an die alte sächsische Grenze zieht. Halben Weges erreicht man Burey en Vaux, das Dörfchen, wohin Jeanne d’Arc zu ihrem Oheim Durand Laxart ging, als sie im elterlichen Hause nicht länger wohlgelitten war; dann (zur Linken) ein mittelalterliches, halb schloßartiges Gehöft, bis endlich, bei einer Biegung des Weges, Domremy selbst mit einzelnen seiner blitzenden Dächer sichtbar wird. Nicht mit seiner Kirche. Es hat nur eine Kapelle, die, etwas tief gelegen, sich hinter Pappeln und anderem Bauwerk versteckt.
Die letzten zehn Minuten vor Einfahrt in das Dorf waren die schönsten. Es war, als ob die Reisegötter hier noch einmal den Zweck verfolgten, ein übriges für mich tun und die ganze Szene künstlerisch abrunden wollten. Ein Geistlicher in weißem Haar und breitkrämpigem Hut kam des Weges; wir grüßten einander. Ein Hirt folgte; strickend schritt er seiner Herde voraus. Durch die herbstlich klare Luft zogen Tausende von Sommerfäden, und auf meine neugierige Frage, welchen Namen diese weißen Fäden in Frankreich führten, antwortete mein Kutscher: les cheveux de la Ste. Vierge. (Die Haare der heiligen Jungfrau.) War es denkbar, unter glücklicherer Vorbedeutung in das Dorf der Jeanne d’Arc einzuziehen? Und doch täuschten alle diese Zeichen.
Um 3 Uhr etwa fuhren wir in die Hauptstraße von Domremy hinein. Es ist ein Dorf von mittlerer Größe, eher klein. Der Eindruck, trotz hellen Sonnenscheins und des weißen Anstrichs der Häuser, war ein düsterer; alles schien auf Verfall und Armut hinzudeuten. In der Mitte des Dorfes hielten wir vor einem rußigen, anscheinend herabgekommenen Gasthause, das in verwaschenen Buchstaben die Inschrift trug: Café de Jeanne d’Arc. Es war unheimlich. Ich hatte dieselbe, mich direkt ins Herz treffende Empfindung wie am Abend vorher, wo der Blaukittel mich besucht und seine Botschaft ausgerichtet hatte.
Ich eilte, mich diesem Eindruck zu entziehen; die geweihte Stätte, wo „la Pucelle“ („Die Jungfrau“) geboren wurde, schien mir der geeignetste Platz dazu. Ich brach also unverzüglich auf. Es waren nur 150 Schritt; in einem Stück Gartenland lag das ehrwürdige Gemäuer. Ich zog die Glocke an einem sauberen drahtgeflochtenen Gittertor, das den Garten von der Straße schied. Eine „Religieuse“ (Nonne) öffnete und machte die Führerin. Und siehe da, als ich erst in der Nische über der niederen Eingangstür das in Stein gemeißelte Bild der gewappneten Jungfrau, innerhalb des Hauses selbst aber den alten eichenen Wandschrank sah, der ihr jahrelang als Truhe gedient hatte, fiel alles Mißtrauen wieder von mir ab, und ich fühlte mich ganz dem Zauber dieser Stunde hingegeben. Ich machte meine Notizen, trat dann zurück in den Garten und versenkte mich noch einmal in den Anblick dieses in Geschichte und Dichtung gleich gefeierten Ortes. Konvolvulus rankte sich um die Stämme einiger Zypressen; Resedabeete füllten die Luft mit ihrem Duft, die Religieuse sprach leise freundlichen Worte; – alles war Poesie.
In unmittelbarer Nähe des Hauses „de la Pucelle“ liegt die Kapelle. Sie ist gotisch. Einige Glasfenster, namentlich eines, dessen bunte Scheiben das Wappen der Jeanne d’Arc ausweisen, deuten auf das fünfzehnte Jahrhundert zurück: das meiste aber ist modern. Ich verweilte wohl eine Viertelstunde an dieser Stelle, mir jedes Kleinste einprägend, und tat dann wieder vor das Portal der Kapelle, zu deren Linken sich eine Statue der Pucelle erhebt. Diese kniet im Gebet, preßt die linke Hand aufs Herz, während sie die rechte gen Himmel hebt; – eine wohlgemeinte, aber schwache Arbeit.
Ich klopfte eben mit meinem spanischen Rohr an der Statue umher, um mich zu vergewissern, ob es Bronze oder gebrannter Ton sei, als ich vom Café de Jeanne d’Arc her eine Gruppe von acht bis zwölf Männern auf mich zukommen sah, ziemlich eng geschlossen und untereinander flüsternd. Ich stutzte, ließ mich aber zunächst in meiner Untersuchung nicht stören und fragte, als sie heran waren, mit Unbefangenheit, aus welchem Material die Statue gemacht sei? Man antwortete ziemlich höflich: „Aus Bronze“, schnitt aber weitere kunsthistorische Fragen, zu denen ich Lust bezeugte, durch die Gegenfrage nach meinen Papieren ab. Ich überreichte ein rotes Portefeuille, in dem sich meine Legitimationspapiere befanden, selbstverständlich nur preußische. Man suchte sich darin zurechtzufinden, kam aber nicht weit und forderte mich nunmehr auf, zu besserer Feststellung sowohl meiner Person wie meiner Reiseberechtigung ihnen in das Wirtshaus zu folgen. Die ganze Szene, so peinlich sie war, hatte, der Gesamthaltung der Dorfbewohner nach, nicht gerade viel Bedrohliches gehabt und schien nach unserem Eintreten in das Wirtshaus, wo bald Wein und Reimser Biskuit herumgegeben wurden, ein immer helleres Licht gewinnen zu wollen. Ich machte alle Umstehenden, deren Zahl von Minute zu Minute wuchs, mit dem Inhalt meiner Legitimationspapiere bekannt und setzte ihnen offen den Zweck meiner Reise und dieser speziellen Exkursion nach Domremy auseinander, was alles wohl aufgenommen wurde. Aber der kleine Lichtstrahl der eben durchbrechen wollte, sollte bald wieder verschwinden. Ich war eben noch im besten Perorieren (erklären), als ein junger Bauer, der sich mit meinem Stock zu tun gemacht hatte, die Krücke aus der Stockscheide zog und mit einem „ah, un poignard“ („Sehr hier, ein Dolch“) die mir zuhörende Gesellschaft überraschte. Es durchfröstelte mich etwas, weil ich klar einsah, was jetzt notwendig kommen mußte. Ich faßte mich aber schnell, und zur Initiative greifend, die allein einem Schlimmeren vorbeugen konnte, sagte ich mit Ruhe: „Naturellement, messieurs, je suis armé.“ („Selbstverständlich bin ich bewaffnet, meine Herren.“) Ich sprach es so, daß man heraushören mußte: mit diesem Poignard allein ist es nicht getan. Man verstand mich auch sofort, und von mehreren Seiten hieß es jetzt: „Ah, ah! Sans doute un revolver“ („Ah, ohne Zweifel ein Revolver!“), während andere dazwischen riefen: „Où est-il? Où sont ses effets? Cherchez! Apportez!“ („Wo ist er? Wo sind seine Reisesachen? Bringt sie her!“) Man brachte alsbald meine Reisedecke und bestand seltsamerweise darauf, daß ich sie selber öffnen solle. Es war, als hätt’ ich sie mit Torpedos geladen. Ich konnte mich selbst in diesem Augenblick eines Lächelns nicht erwehren, löste die Riemen, wickelte die Decke auseinander und überreichte meinen Revolver. Er ging von Hand zu Hand; ich konnte wahrnehmen, daß er mit sehr verschiedenen Gefühlen betrachtet wurde.
Die Situation war bereits heikel genug; aber schlimme Momente kommen nie allein; so auch hier. In eben diesem Augenblick, wo die Stimmung gegen mich ziemlich hoch ging, drängte sich durch den dichten Haufen ein wüst aussehender Geselle, der, gedunsen und kurzhalsig, seiner apoplektischen Anlage zum Schlagfluß durch sechs Liter Wein täglich zu Hilfe zu kommen schien, stellte sich sperrbeinig vor mich hin, schlug mit der Faust auf seine Brust und erklärte mit lallender Zunge; „Je suis le maire“ („Ich bin der Bürgermeister“). Dies kam mir sehr ungelegen. Ich griff zu einem verzweifelten Mittel und sagte ihm unter Verbeugung, „daß ich erfreut sei, ihn zu sehen,“ was bei einzelnen (ich hatte also richtig gerechnet) sofort eine gewisse Heiterkeit zu meinen Gunsten erweckte und die Gebildeteren veranlaßte, die Dorfobrigkeit, die noch allerhand faselte, beiseite zu schieben. Dies war sehr wichtig für mich. Solch trunkener Imbecile (Tölpel), an dem alles, was Vernunft und Wahrheit ist, notwendig scheiern mußte, war das Schlimmste, was mir in solchem Moment begegnen konnte.
Einer aus dem Kreise der Minorität trat jetzt an mich heran und fragte ruhig, ob ich damit einverstanden sei, daß man mich nach Neufchateau auf die Souspräfektur führe. Ich mußte lächeln; ebenso hätte er mich fragen können, ob ich damit einverstanden sei, gehängt zu werden. Ich mußte eben tragen, was über mich beschlossen wurde.
Meine Einwilligung war kaum ausgesprochen, als man meinen Kutscher, der mich übrigens nicht verraten hatte, antrieb, seinen Braunen wieder einzuspannen. Ich bezahlte meine Zehrung; die Wirtin nahm das Geld und sah mich teilnahmsvoll an. Sie schien sagen zu wollen: die Welt ist toll geworden. Im Moment, wo ich auf dem Flur hinaustrat, legte ein hübsch aussehender, rotblonder Mann seine Hand auf meine Schulter und flüsterte mir zu: „Monsieur, encore un moment!“ („Einen Augenblick noch, mein Herr“) Er wies auf ein großes Hinterzimmer, in das er voranschritt; ich folgte. Als wir allein waren, zeigte er mir ein Papier, das an seine Spitze ein umstrahlendes Dreieck und in dem Dreieck, soviel ich ersehen konnte, einige hebräische Zeichen trug. „Connaissez-vous cela?“ („Kennen Sie das?“) Es schien mir ein Freimaurerpapier. Ich antwortete: „Nein“, hinzusetzend, daß ich die Bedeutung allerdings zu kennen glaubte. „Ah! c’est bon!“ („Gut.“) Er steckte sein Papier wieder ein, und ich war entlassen. Ob er wirklich meine Freilassung durchsetzen wollte, oder ob das Ganze umgekehrt nur eine Falle war, darüber kann ich bloß Vermutungen hegen. Das eine ist so gut möglich wie das andere.
Wir stiegen auf. Rechts der Kutscher, links ein Franktireur (Freischärler), ich eingeklemmt zwischen beiden; hinter uns, auf einem Strohbündel, lagen zwei Blusenmänner. Die Sonne war im Niedergehen, der Abend klar und schön; so ging es auf Neufchateau zu.