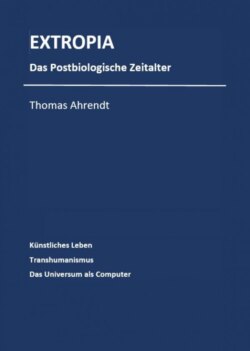Читать книгу Extropia - Thomas Ahrendt - Страница 3
Leben und Bewusstsein
ОглавлениеWas ist Leben: Leben lässt sich definieren als Besitz der Organisation von Materie und nicht als Besitz einer Materie, die organisiert ist. Bei der Definition von Leben braucht man sich nicht nur auf organische (Kohlenstoff) Chemie beschränken, ja nicht mal auf einen physikalisch aufgebauten Körper, solange die Prozesse, die Verhaltensweisen, die für Leben typisch sind, realisiert sind (Selbstreproduktion, Stoffwechsel, Wachstum, angepasste Reaktionen usw.) Nach der üblichen Vorstellung ist "Leben" ein zwar komplexer, aber vor allem ein carbaquistischer Prozess[1], der stark abhängig von der Materie bzw. dem Substrat ist. Wenn ich eine Kopie meines Gehirns mit derselben Struktur machen könnte, jedoch unter Verwendung anderer Materialien, würde die Kopie dann denken, dass sie gleich ich ist? Ist Materie die Grundlage von Bewusstsein, dann können Leben und Bewusstsein niemals von Fleisch und Blut, das heißt von der Biologie wegevolvieren und intelligente Computer sind unmöglich. Kohlenstoff- Leben kann dann nur solange existieren, wie die Bedingungen dafür günstig sind, solange also flüssiges Wasser und freie Energie verfügbar sind. Aber auch dann ist die Lebensdauer begrenzt, da es nur einen endlichen Vorrat an freier Energie hat. Die Quellen der freie Energie, auf die Leben für seinen Stoffwechsel angewiesen ist, werden durch die fortschreitende kosmische Expansion schließlich erschöpft sein. Sollte „Struktur” die Bewusstseinsgrundlage sein, dann kann Leben jede nur mögliche materielle Verkörperung annehmen, die für seine Zwecke optimal ist und dann sind intelligente Computer möglich (und in der Biologie können Skalengesetze angewandt werden).
Wenn aber analoge Prozesse auch auf anderen Systemen basieren können, scheint für Leben nicht die Substanz bzw. das Substrat entscheidend zu sein, sondern das Muster und Muster ist nur ein anderer Name für Information. Wobei Leben konkreter ein dynamisches Muster, ein Prozess ist. (Die ersten Lebewesen waren möglicherweise sich selbst kopierende Muster von Defekten in Metallkristallen, die auf Kohlenstoffmoleküle übertragen wurden.) Das Fortdauern lebender Muster beruht auf einer Wechselwirkung mit ihrer Umwelt, wodurch sich die in dem Muster codierte Information zwar ständig (leicht) verändert, aber diese Varianz wird durch das Feedback auf eine enge Bandbreite eingeschränkt. Neben Information ist Komplexität ein weiterer grundlegender Faktor für Leben; es ist abhängig von einem Maß an Komplexität. Jenseits dieser kritischen Masse können sich (Proto-)Lebensformen fortlaufend selbst reproduzieren, wobei sie nicht nur Ihresgleichen erschaffen, sondern sogar Ursprung für kompliziertere Objekte sein können (Evolution). Bestes Beispiel dafür ist die Entwicklung von der RNA-Welt über relativ einfache, einzellige Organismen zu so komplexen Lebewesen wie den Säugetieren und den Menschen (als vorläufigen Höhepunkt). Außerdem ist diese These das beste Gegenargument für den "Vitalismus". Trotzdem es die mystische Vis vitalis nicht gibt, die lebende von toter Materie trennt, existiert tatsächlich eine Art Lebenskraft in biologischen Systemen - eben Komplexität. Als 3. Faktor ist "Selbstorganisation" grundlegend mit der Entstehung des Lebens verbunden. Selbstorganisation muss als eine Kraft der Natur verstanden werden, die die Evolution unterstützt und das System so in Richtung einer größeren Komplexität schiebt. Leben will sich entwickeln , auch gegen scheinbar unüberwindliche Hindernisse. Verantwortlich dafür ist weder eine Lebenskraft noch Zauberei, sondern ein substantieller Kern der Natur, der selbst reproduzierende Objekte möglich, wenn nicht sogar unvermeidlich macht, wenn alle 3 Faktoren (Information, Komplexität, Selbstorganisation) ausreichend vorhanden sind. Leben wie wir es kennen, ist aus der Perspektive der Thermodynamik ein sogenanntes offenes System: Lebewesen tauschen mit ihrer Umwelt Materie (über Nahrung und Stoffwechselendprodukte) und Energie (über Stoffwechselprozesse und Schwitzen) aus. In weit entfernter Zukunft wird die Entropie soweit zugenommen und sich die nutzbare Energie derart verringert haben, dass Leben nicht mehr möglich sein wird. Ein Ausweg wäre nun, die kosmische Entropie in ihr Gegenteil umzukehren, also die Negentropie zu erhöhen (was Leben auf der Erde ja schon seit Gigajahren macht). Dabei stellt sich heraus, das die Evolution - in Verbindung mit der Selbstorganisation - entgegengesetzt zur Zunahme der Entropie im Universum verläuft; sie offensichtlich ein Gegenspieler des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik ist.
Hans Hass – Energontheorie und Theorie der Hyperzeller
Die vom Meeresforscher und theoretischen Wissenschaftler Hans Hass entwickelte Energontheorie besagt, dass sich Berufstätigkeit und Unternehmen des Menschen zwangsläufig nach den gleichen Gesetzen wie die biologische Evolution entfalten. Sie orientiert sich nicht an den materiellen Erscheinungen, sondern am Energetischen: an Abläufen, Leistungen und Wirkungen. Die Energontheorie betrachtet das, was der Materie zugrunde liegt und sich über sie entfaltet, die Energie. Hass betrachtet die Lebensentfaltung als eine Erscheinungsform der Energie. Die sich immer mehr steigernde Lebensentfaltung ist dabei nur möglich, wenn die entsprechenden Strukturen eine positive Energiebilanz haben, wenn sie also mehr Energie aufnehmen als sie verbrauchen. Diese „ernergieaufnehmenden Systeme“ bezeichnet er als „Energone“. 1971 fand sie in der Wirtschaftswissenschaft ihre erste Anwendung. Dort interessierte der neue Ansatz, Effizienz rechnerisch zu erfassen und zu einem neutralen Bewertungssystem zu gelangen. Während der Energontheorie die funktionelle und energetische Denkweise zugrunde liegt, befasst sich die Theorie der Hyperzeller mit der gleichen Thematik und gelangt zu denselben Schlussfolgerungen. Sie ist eine Weiterentwicklung der Evolutionstheorie nach Darwin. Genauso, wie sich nach der „Erfindung“ der Zelle aus den Einzellern vielzellige Lebewesen mit einer bestimmten inneren Organisation entwickelten, ist der Mensch Ausgangspunkt für eine neue Entwicklung, die über den Menschen hinweg weiter geht. Der Mensch vermag durch seine besonderen Fähigkeiten seinen Körper durch „künstlich“ gefertigte Hilfsmittel zu verbessern. Er entwickelt zusätzliche Organe, durch die er je nach Bedarf verschiedenste Leistungen erreichen oder effizienter durchführen kann. Diese zusätzlichen Organe reichen vom primitiven Steinzeitwerkzeug bis zum Rechenzentrum und zur Mondrakete. So kam es ausgehend vom Urmenschen zu einer weiteren, nicht minder gewaltigen Entfaltung von neuen Lebensformen, die sich in unserer Zeit immer schneller steigert. Diese Lebensformen fasst Hass unter dem Begriff Hyperzeller zusammen. Seine Theorie der Hyperzeller besagt, dass sich über den Menschen ein zweites Mai Leistungen auf noch effizientere Organe, die den Gesamtkörper direkt aus Umweltmaterial bilden, verlagerten, und dass all das, was man heute unter „soziokulturelle Entwicklung des Menschen“ zusammenfasst, den gleichen Gesetzmäßigkeiten der Evolution unterliegt. Die Theorie der Hyperzeller schließt also unmittelbar an Darwins Lehre an und befasst sich mit dem Evolutionsverlauf und seinen Gesetzmäßigkeiten, der über den Menschen hinweg seinen Weg nahm. Siehe auch: www.hans-hass.de
Während die Entropie die Ordnung auflöst, treibt im Gegensatz dazu die Evolution durch die Kraft der Selbstorganisation immer weiter in Richtung zunehmender Ordnung. Selbstorganisation im Widerstreit zu dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik lässt sich als wichtiges physikalisches Prinzip verstehen, vielleicht sogar als ein sehr wichtiges physikalisches Gesetz, das in umfassender Weise in die Physik eingebettet ist. "Komplexität" umfasst Physik und Mathematik, Informationstheorie, Informatik, Physiologie, Populationsgenetik und Spieltheorie. Leben und der Bottom-up-Ansatz: biologisches Leben ist ein Prozess und arbeitet sich von der Basis zur Spitze. Die Welt als Ganzes (= die ges. Biosphäre) – ist ein gigantisches natürliches System, das als gemeinschaftliches Resultat von vielen Milliarden biologischen FSMs entstand, die winzigen Regelwerken gehorchten. Um KL zu erschaffen o. um zu klären, was Leben ist, braucht man vieles, von der Chaostheorie bis hin zur Genetik und darüber hinaus eine besondere Sichtweise von der Natur des Lebens selbst. Theorien über den Ursprung des Lebens sind sehr zahlreich, wobei viele einerseits außerordentlich schwer zu widerlegen und andererseits nahezu unmöglich zu beweisen sind. Die Schwierigkeiten beginnen schon mit Unstimmigkeiten bezüglich der Zusammensetzung des Planeten und mit den atmosphärischen Bedingungen, die auf der Erde geherrscht haben, als sich das Leben entwickelte. Die Schwierigkeiten werden aber noch größer: Denn einige der Arbeitshypothesen, selbst wenn sie von sehr ernst zu nehmenden Wissenschaftlern vorgebracht werden, enthalten oft bizarre und recht unwahrscheinliche Teilaspekte. Zu den eher klügeren Theorien, die auch heute immer noch als möglich in Erwägung gezogen werden, gehören beispielsweise die von Graham Cairns-Smith, nach der das Leben zwischen sich bildenden Tonschichten entstand und sich dann im Akt einer genetischen Machtübernahme in biochemische Reaktionen verwandelte (wie wir sehen werden, hat diese Theorie gewisse Bedeutung für KL). Eine anderes Modell, das „Panspermie“-Modell besagt, dass das Leben von einem außerirdischen Keim ausgegangen ist, den ein weit entfernter, extraterrestrischer Vetter (Mars?) uns geschickt hat. All diese Theorien spiegeln das Paradoxon wider, mit dem der Ursprung des Lebens behaftet ist. Wie schon von feststellte, kann Leben nicht entstehen, wenn nicht eine gewisse Komplexität vorhanden ist. Sobald dieser entscheidende Grad von Komplexität erreicht ist, kann der Prozess der Evolution beginnen und komplexere Moleküle, schließlich sogar Lebewesen hervorbringen. Aber wie kommt diese notwendige Anfangskomplexität zustande?
Definitionen des Lebens
v. Neumann: Leben existiert in Form entstehender Informationsprozesse.
Kauffmann: Leben strebt aufgrund des Prinzips der Selbstorganisation danach, sich zu entwickeln.
Prigagone: Leben hat die Tendenz, sich knapp diesseits des Chaos anzusiedeln.
Ray: Leben ist ein symbiotischer Prozess, in dem tödliche Rivalen geradezu benötigt werden. Gleichgewicht ist eine Illusion. Ordnung entsteht aus einer unerbittlichen, unruhigen See. Selbst tödliche Schädigungen helfen dem System, sich auf ein höheres Komplexitätslevel zu erheben.
Diese Problematik veranlasste selbst geduldige Wissenschaftler dazu, die Untersuchungen über den Ursprung des Lebens in den Bereich der Pseudowissenschaften abzuschieben. Einige besonders konservative Biologen versuchten sogar, ziemlich weit hergeholte Erklärungen hervorzuzaubern, um damit die unendliche Unwahrscheinlichkeit der Entstehung des Lebens zu erklären. Sowohl den Theorien, die sich aus dem Miller-Urey-Experiment und dessen diversen Abwandlungen ergeben als auch der RNS-Welt-Theorie, nach der das frühe irdische Leben in einer RNS-Welt existierte, die aus selbstreplizierender RNS bestand und später durch DNS und Proteine ergänzt wurde, fehlt die Hauptkomponente für die Entstehung des Lebens, nämlich die Kraft der Selbstorganisation.
Hyperzyklustheorie
Hier kommt nun der vom deutsche Biochemiker Manfred Eigen entworfene sogenannte Hyperzyklus ins Spiel, ein zusammenhängendes Netzwerk von funktionell verpaarten selbstreplizierenden "Wesen", bei denen gewisse Verhaltensweisen entstehen, die mehr sind als nur die Summe ihrer Wechselwirkungen. Bei der Hyperzyklustheorie handelt es sich um wechselseitige Abhängigkeiten, bei der keine einzelne Reaktion die übrigen Funktionen des Zyklus ausführen kann. Stattdessen geht es um ein ausgewogenes Ökosystem. Mit dem Hyperzyklusmodell lässt sich zeigen, wie nackte RNA eine komplizierter Reaktionskette ausführen kann, die zu besser angepasste RNA-Moleküle und schließlich zu den typischen, hochentwickelten Funktionen der ribosomalen und Boten-RNA führt. Wenn sich Leben nicht nur aus einer RNS-Welt entwickelt haben soll, wie könnte dann frühes die Doppelfunktion von Replikation und Stoffwechsel unterstützt haben? Hier könnte ein Modell von Freeman Dyson weiterhelfen. Während sich bisherige Theorien über den Ursprung des Lebens entweder der Proteintheorie oder der Nukleinsäuretheorie zuordnen ließen, vermutete Dyson, dass die Entstehung des Lebens eine Kombination aus einem Replikationsprozess und einem Stoffwechselprozess war. Die Proteintheorie besagt, dass der durch Proteine angeregte Stoffwechsel zuerst dagewesen war, während die Nukleinsäuretheorie davon ausgeht, dass ein Replikator wie die RNS die erste Manifestation des Lebens war. Leben begann nach dem dualen, hyperzyklusähnlichen Kaufman-Modell mit einem autokatalytischen, selbstreplizierenden Haufen von Polymeren, deren Teile gemeinsam und gleichzeitig einen Stoffwechsel katalysieren. Im Gegensatz dazu brauchen Konkurrenzmodelle eine Kombination sehr vieler Voraussetzungen von sehr geringer Wahrscheinlichkeit, da ihnen selbstreproduzierende Systeme fehlen. Sie hängen von der Entstehung einer einzigen Molekülart ab, die dazu fähig ist, sich in komplexe Substanzen verwandeln zu können, um die Maschinerie des Lebens mit Energie versorgen zu können. Statt der systembedingten parallelen Reaktionen, die Kauffman vorschlug und die er als zwangsläufiges Resultat der Komplexität ansah, liefen diese Alternativen in den Konkurrenzmodellen als Folge von Vorgängen ab. Dazu war dann allerdings eine Reihe genau festgelegter Bedingungen notwendig, vergleichbar einem Roulettespiel, bei dem man immer wieder auf eine bestimmte Zahl setzt in der Erwartung, dass sie eigentlich jeden Moment fallen muss. Aber es gab auch noch ein weiteres offensichtliches Gegenargument: Wenn die Trefferchancen in dieser Theorie so unglaublich gering waren, warum gab es uns dann? Weil Leben entstehen will.
Sprunghafte Evolution
Nach neuerer Ansicht von Biologen verläuft die Evolution sprunghaft. Statt eines gleichmäßigen und kontinuierlichen Entwicklungsanstiegs wird dieser immer wieder von Stillstandsperioden unterbrochen, in denen die Arten eine Zeitlang relativ stabil und im Gleichgewicht bleiben. Diese Perioden nutzen sie, um sich der jeweiligen Umwelt anzupassen. Ein plötzlicher Umweltwechsel oder eine erfolgreiche Mutation erzeugen qualitative Sprünge in ihrer Tauglichkeit. Bei den Phänotypen der neuen Arten treten neue und physikalische Merkmale auf. Biologen bezeichnen diese von sprunghaften Schüben gekennzeichnete Entwicklung als „unterbrochenes Gleichgewicht“. „Epistatisch“ nennen Biologen Fälle, in denen eine ausgewogene Kombination verschiedener Gene für das Auftreten einer Eigenschaft benötigt wird. Dass eine beliebige Kombination von Genen beim Crossing-over oder durch eine Mutation in einer einzigen Generation zu einem neuartigen Genotyp führt, ist sehr selten bzw. unwahrscheinlich. Außerdem würde eine Paarung diese unwahrscheinliche Verkettung sofort wieder zerstören. Auch künstliche Organismen entwickelten sich nicht in einem gleichmäßigen, kontinuierlichen Prozess, sondern durch plötzliche Sprünge des unterbrochenen Gleichgewichts. Ihr Fortschritt besteht häufig aus langen Phasen relativen Stillstands, die durch kurze Perioden schnellen Fortschritts unterbrochen werden. Das deckte sich auch mit der Feststellung der Evolutionsbiologen. Doch bei der Untersuchung des Genotyps künstlicher Lebewesen stellte sich heraus, dass, während eine Population zu ruhen schien und ihr Phänotyp gleich blieb, sich in ihren genetischen Anlagen Änderungsprozesse vollzogen. Die plötzliche Zunahme der Tauglichkeit war kein unvorhergesehenes Ereignis; vielmehr schien die Population ihren nächsten Schritt schon in sich zu tragen. Der Genpool enthält bereits eine Reihe epistatischer Gene, die erst dann zum Einsatz kommen, wenn alle vorhanden sind. Bis dahin sind alle Allele für diese Gene rezessiv. (Zur Erinnerung: ein Allel stellt bestimmte Genvariationen dar. Z.B. sind Farbpigmente Allele des Gens für die Augenfarbe.) Während die dominanten Eigenschaften in der Population zum Ausdruck kommen, können sich rezessive Gene in ihr anhäufen, wobei ein rückgekoppeltes Netzwerk die parallele Entwicklung dieser Anordnung unterstützt. Erreicht die Anzahl der rezessiven Gene eine bestimmte Größe, verbreiten sie sich überall in der Population, wobei diejenigen Individuen, die alle diese Eigenschaften besitzen, aufgrund des epistatischen Effektes viel besser angepasst sind, so dass dieser Population ein Entwicklungssprung gelingt. Wird also dieser „magische“ Prozentsatz erreicht, dann gibt es plötzlich eine enorme, positive Rückkopplung und ruckzuck geht ihre Zahl nach oben, bis jeder sie hat. Dieser magische Prozentsatz lässt sich durch den Term 1/ℯ² quantisieren[2]. Wird bei Vorhandensein der entscheidenden Gene dieser Wert erreicht, steigt die Population plötzlich auf eine höhere Ebene. (Gilt das auch für die Intelligenz, für die „Wissenschaftlichkeit“ einer Gesellschaft? Hat das auch kulturelle Auswirkungen? Kann man sagen, dass, wenn die Anzahl der Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure 1/ℯ² erreicht, dass dann die gesamte Gesellschaft so wird?) Qualitative Sprünge in Richtung Anpassung, Komplexität und „Höherentwicklung“ werden nicht unbedingt durch drastische Umweltstörungen oder entscheidende Mutationen verursacht; vielmehr sind komplexe Zusammenhänge multipler Gene dafür verantwortlich.
Telische Wellen
Wie kann man Leben erkennen? An welchem Punkt lässt sich festlegen, ob eine Kreatur (z.B. ein menschlicher Embryo) lebendig ist? Kann man Fortschritte beim Verständnis und der Simulation des Verhaltens und der Simulation des Verhaltens von lebendigen Kreaturen machen, ohne sich in die verwickelten Zusammenhänge einer Definition von Leben einzulassen? Im Alltag ist die Beurteilung einfach: eine Katze lebt – ein Stein nicht. Aber eine Formalisierung dieser Unterscheidung ist schwierig, besonders wenn diese in empirischen Messungen verwendet werden soll. Leben zeichnet eine empirisch messbare, statistische Qualität aus. Leben ist ein Attribut, dass ein Organismus besitzt, wenn dieser Mitglied eines sich entwickelnden biologischen Systems von Organismen ist, die miteinander und mit der Umwelt wechselwirken. Leben ist also eine Eigenschaft, die mit der Umwelt interagiert. Wobei ein Organismus nur ein zeitweiliges Mitglied einer sich entwickelnden Biosphäre ist (aber nicht notwendigerweise in der Technosphäre, dort Unsterblichkeit möglich). Bei aller Komplexität, die „Lebendig-Sein“ assoziiert, gibt es dennoch 3 Hauptkriterien:
ein Informationen verarbeitender Apparat
die Fähigkeit, Funktionen über eine komplexe Struktur auszuführen
die Fähigkeit, diese Struktur innerhalb von Generationen spontan zu modifizieren und zu verbessern (und genau das ist Evolution)
Der Schlüssel für die Bewertung von Lebendig-Sein ist evolutionäre Aktivität, die sich über die Bewegung von vorteilhaften oder nützlichen Genen innerhalb des Genpools einer Art quantifizieren lässt. Diese Bewegungen vorteilhafter Gene werden auch als „telische Wellen“ bezeichnet, obwohl „Teleologie“ ein biologischer Negativbegriff ist, denn im Gegensatz zu Biologen glauben Teleologen, dass die Evolution in zielgerichteten Bahnen auf ein Endziel hin verläuft. (Die natürliche Biologie macht das vielleicht nicht, aber Technologie könnte es sehr wohl, weil sie bewusstseinsgesteuert ist.) In diesem Fall sind die telischen Wellen jedoch anders, nämlich im Rückblick zu verstehen, da die Gene rückblickend daran arbeiten, die Art zu verbessern, so dass man die genetischen Veränderungen im Nachhinein als zielgerichtet, als finalistisch deuten könnte. Allerdings gibt es für zukünftige KLs – wie auch für uns Menschen – sehr wohl die Möglichkeit einer zielgerichteten Entwicklung, anders als Populationen, deren Entwicklungen nur von evolutiven Kräften gesteuert wird. (Wir Menschen könnten uns das Ziel geben z.B. in 100 Jahren 105 Menschen auf dem Mars anzusiedeln oder in knapp 10 Megajahren die gesamte Galaxis zu kolonisieren. Zukünftige KL-Organismen werden so hoch entwickelt sein, dass sie selbst auf bestimmte Ziele, etwa die technologische Singularität oder den Omegapunkt, hinarbeiten.) In dem KL-Modell der mentalen Teleologie bilden telische Wellen nicht die Basis für das Überleben, sondern für eine psychologische Anpassung oder einen Lernvorgang. Dieses Modell ist nicht nur Richtschnur für Vergleiche künstlicher Lebensräume, sondern auch ein Bestimmungstest dafür, was lebt. Eine positive Aktivität ist ein Hinweis dafür, dass sich KL-Wesen kontinuierlich neue Verhaltensweisen oder psychologische Aktivitätsmuster einverleiben und angewöhnen. Die Präsenz telischer Wellen ist ein Beweis dafür, dass richtiges Leben in einem System vorhanden ist. Auf dies Weise ließen sich auch biologische Populationen vermessen, wenn es gelänge, die genetischen Bewegungen festzustellen.
[1] "Carbaquismus" setzt sich aus "Carbon" für Kohlenstoff und "Aqua" für Wasser zusammen und steht für die Vorstellung, Leben könne nur auf Kohlenstoffchemie und Wasser beruhen.
[2] ℯ ist die „Eulersche Zahl“, benannt nach dem Schweizer Mathematiker Leonhard Euler. Sie ist eine für die Wissenschaft und insbesondere für die Mathematik wichtige Zahl und liegt vielen Wachstums- bzw. Zerfallsprozessen in der Natur zugrunde, z.B. die Vermehrung einer Bakterienkolonie oder der radioaktive Zerfall. Die Zahl e ist "Basis des natürlichen Logarithmus".