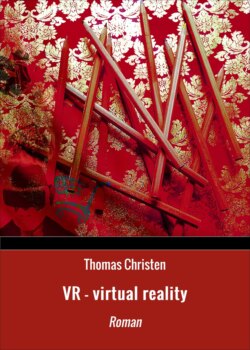Читать книгу VR - virtual reality - Thomas Christen - Страница 4
Freundlichkeit kann man kaufen und von weitem ist alles so klein
ОглавлениеFeinkost Mailen war eine Institution gewesen. Wie oft in meinem Leben hat mein Vater mir die Geschichte seines Vaters Emanuel erzählt, der Anfang der Fünfzigerjahre angeblich zweimal in seinen Goliath GV 800 gestiegen war, um für Wochen in die Gegend um Mailand und Bologna zu verschwinden, die Nächte neben seinem kleinen Koffer auf einer Matratze und unter einer Wolldecke im Stauraum des erst einmal noch leeren kleinen Busses verbringend, der dann irgendwann wieder vor dem Geschäft in der Hohestraße stand, voll beladen mit Kisten voller Sardinen, Kapern, Olivenöl, Reis, Nudeln, Käse, Wein und Panettone. Das Auspacken und Begutachten der Kisten und ihrer Inhalte hatte beide Male angeblich einem zeremoniellen Akt geglichen. Staunen, studieren, riechen, von dem, was auf den Etiketten stand, kaum etwas verstehen, aber in der prickelnden Vorahnung, wie sich alles in den Regalen ausmachen würde. ‚Wenn ich Ihnen noch etwas empfehlen darf, Frau Müller, frisch hereingekommen, eine Delikatesse.’ Die Geschichte wurde jedes Mal ein wenig umfangreicher, und ich habe jedes Detail geglaubt.
Den Reisen vorausgegangen, so hieß es, war ein umfangreicher Briefwechsel mit einem halben Dutzend Großhändlern und Erzeugern, die sich in den Jahren, die folgen sollten, zu treuen und zuverlässigen Geschäftspartnern von Feinkost Emanuel Mailen entwickeln sollten. La fonte di un'idea aziendale meravigliosa. Übersetzt hatte die Briefe damals angeblich der Ehemann einer Bekannten, und ich habe mir bei jeder Neuauflage der Erzählung vorgestellt, wie der Großvater durch das kleine Büro hinter dem Verkaufsraum auf und ab geht und mit blumigen Worten jenem Antonio Sätze und Höflichkeitsfloskeln in die Feder diktiert, die er niemals auf ihre Richtigkeit hin hätte kontrollieren können. ‚Das dolce vita’, dessen war er sich sicher, ,das dolce vita, bella Italia, der Duft und die Exotik des Mittelmeeres. Wer es sich leisten kann fährt nach Italien, meine Lieben. Warum sollte man nicht ein wenig davon zu uns holen? Damit lässt sich Geld verdienen. Ihr werdet es sehen.’
Wir haben es gesehen. Nun ja, ich selber habe es vielleicht am wenigsten gesehen. Dafür umso mehr geglaubt. Als mein Vater 1955 geboren wurde, war das Geschäft in weitem Umkreis bekannt, die treuen und betuchteren Kunden ließen anschreiben, und die Kinder, die ihre Mütter beim Einkauf begleiteten, bekamen regelmäßig eine kleine Süßigkeit aus dem großen Glas auf der Theke geschenkt. ‚Und, was sagt man?!’
Für meinen Großvater war das Geschäft sein Leben. Nicht, dass er meine Großmutter nicht geliebt hätte. Liebe nach den Maßstäben seiner Generation. Ich kenne keinerlei Geschichten oder Anekdoten, die von Zerwürfnissen oder Streitereien zwischen den beiden erzählen. Aber ohne es erklären zu können, ist das Bild, das ich von ihm habe, das Bild eines Mannes, für den rechtschaffen erworbener Erfolg, uneitle Schönheit und Seriösität das zu achtende und zu wertschätzende Maß aller Dinge waren. Ständig kreisten seine Gedanken um das Wohlergehen des Geschäftes. Und erst wenn diese Gedanken ein wenig zur Ruhe kamen, schien Raum in ihnen für die Familie und meine Großmutter zu entstehen. Als ich selber Jahrzehnte später meinen Eltern zum ersten Mal kundtat, dass ich Medien- und Gamedesign an der MD.H studieren wolle, war meinem Vater zwar die Verwunderung anzusehen, aber wenn er damals wirklich enttäuscht gewesen sein sollte, hat er es auf bemerkenswerte Weise verstanden, dieses Gefühl vor mir zu verbergen. Als ich ihm den Betrag nannte, der bis zum Ende des Studiums an Gebühren zusammenkommen würde, sah er mich nur eine Weile schweigend an. ‚Dann erwarte ich, dass Du nebenbei arbeiten gehst und dich für ein Stipendium bewirbst. Ersteres ist nicht verhandelbar, Julian. Sonst geht es nicht. Mit dem Stipendium müssen wir dann sehen’.
Für ihn selber wäre etwas anderes als der Eintritt in das väterliche Geschäft völlig undenkbar gewesen. Seine Lehre als Einzelhandelskaufmann stand nie außer Frage, und ich muss in diesem Zusammenhang erwähnen, dass man sich meinen Vater auch als wenig anderes als den über alle Maßen freundlichen und liebenswerten Herrn Feinkosthändler Mailen vorstellen kann. War mein Großvater vor allem geschäftstüchtig und korrekt, dann zeichnete sich mein Vater durch seine für mich manchmal überbordende Freundlichkeit und unerschöpflichen Ideenreichtum aus. Wenn meine Mutter manchmal meinte, man könne es mit Entgegenkommen und Verständnis auch übertreiben, dann war seine Reaktion ausnahmslos ein mildes Lächeln und die Entgegnung: ‚Bei mir kann man Freundlichkeit kaufen!’ Ich bin mir noch heute sicher, dass die wenigsten den tieferen Sinn und das damit verbundene Ziel dieser sechs einfachen Worte meines Vaters verstanden haben. Er erzählte gerne, wie mein Großvater angeblich im September des Jahres 1957 nach Köln gefahren ist, weil er sich unbedingt vor Ort ansehen wollte, wovon alle Zeitungen berichteten. Ein Herr Eklöh hatte nach amerikanischem Vorbild in der Rheinlandhalle auf 2000 qm einen sogenannten Supermarkt eröffnet. ‚Das funktioniert nie!’, soll er gesagt haben, ‚und das, was er an Personal einspart, klaut man ihm unter dem Hintern wieder weg.’ Als meine Großmutter vorsichtig eingeworfen haben soll, dass ein solcher Supermarkt aber vielleicht schlecht für das eigene Geschäft sei, soll er nur abgewinkt und geantwortet haben: ‚Papperlapapp, Hilde, du redest Unsinn!’
Wie alle weiß ich heute, dass meine Großmutter keinen Unsinn geredet hat. In den Jahren vor meiner Geburt öffneten in unmittelbarer Umgebung ein italienischer und ein türkischer Lebensmittelladen ihre Pforten, die es zwar heute nicht mehr gibt, aber dafür zehn andere im gleichen Stadtteil. Und als vor sechs Jahren der gigantische Kaufmarkt mit zwei Etagen in gerade mal fünfhundert Metern Entfernung seine Tore öffnete, waren die Tage von Feinkost Mailen gezählt. Jahre, in denen mein Vater eigene Rabattmarkenheftchen gestaltet, kostenlose Warenproben und Hauslieferungen angeboten hatte. Selbstverständlich hatte man die Weihnachtsgans vorbestellen und den Geschenkkorb individuell bestücken können. Zweimal im Vierteljahr waren für die Weinprobe am Samstagnachmittag Stehtische herangeschafft und mit weißen Hutten überzogen worden. Und mein Vater pries an, erklärte, lächelte und verkaufte Freundlichkeit. Er hat niemals nach einem Zeugnis gefragt. Wenn es in den Jahren um eine neue Einstellung ging, brühte er erst einmal Kaffee oder Tee auf, hängte seinen weißen Kittel an den Haken und erzählte dem Bewerber oder der Bewerberin kleine Geschichten. Irgendwann fragte er beiläufig nach Hobbys und Interessen, wieso man ausgerechnet bei ihm anfangen wolle, bis dann am Ende die Standardfrage kam: ‚Und was würden Sie machen, wenn Sie einen Diebstahl beobachten, oder wenn der Kunde Ihnen auf die rabiateste Art und Weise Unfreundlichkeiten und fadenscheinige Beschwerden an den Kopf wirft?’
‚Wir waren nie ein Tante-Emma-Laden. Und die Onkel-Mehmet-Läden haben mich nie gestört’, schimpfte er am Tag nach dem Verkauf, um dann fast eine Woche lang zu schweigen. Wenn ich mich heute erinnere, stelle ich fest, dass es für meinen Vater nie ein Problem darstellte, hier und da freiwillig zu schweigen. Es heißt, dass das Schicksal nichts nimmt, was es nicht gegeben hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich wahr ist.
Das meiste von all dem weiß ich nur aus Erzählungen. Und solange ich denken und zuhören kann stand Erzählen bei uns zuhause hoch im Kurs. Jeder meiner beiden Eltern hatte seine eigene Art, Erlebtes noch einmal wiederzubeleben, das Kleine groß und das Große klein zu erzählen, den Unannehmlichkeiten die Spitzen zu nehmen und dann doch manchmal aus der Maus den sprichwörtlichen Elefanten zu machen. Und an Phantasie hat es weder meiner Mutter noch meinem Vater gemangelt. Sie haben beide immer ihre Blumen gefunden. Jeder seine eigenen. Hier und da die gleichen. Und ab und an sogar dieselben. Für meine Mutter war diese Phantasie manchmal guter Geist und Dämon zugleich. Und für mich war sie als kleines Kind immer die Fahrkarte in andere Welten, wenn sie mir abends oder am Wochenende, je nachdem wer Zeit und Lust hatte, vorlasen. Jeder aus seinem höchst unterschiedlichen Kanon aus damals angesagten oder niemals unmodern werdenden Kinderbüchern. Oder aber, wenn es mein Vater war, aus dem Quell einer niemals versiegenden Erfindungsgabe.
Es ist seltsam, dass ich, wenn ich in den letzten Monaten an meine Eltern denke, immer zuerst an meinen Vater denke. Denken will. Diese Gedanken ähneln dann jedes Mal einem langen Umweg, einem unverzichtbaren, tiefen Atemzug bevor sich das Bild meiner Mutter unweigerlich in meine Gedanken zwängt. Bis mir die Luft weg bleibt und ich das Erinnern an einen völlig anderen Ort zwinge.
Meine Großmutter mütterlicherseits war Schauspielerin am Düsseldorfer Schauspielhaus. Es gibt alte Fotos und ein paar verstaubte Schachteln mit Programmheften, Briefen, Besetzungslisten und allerlei in die Jahre gekommenem Krimskrams, die meine Mutter mir ein- oder zweimal unter süffisantem Lächeln und der ein oder anderen despektierlichen Bemerkung gezeigt hat und deren Inhalt für meine Großmutter Elisabeth am Ende ohne Zweifel eine Ansammlung von verklärten Relikten aus einer Zeit wenig erfüllter Träume darstellte. Sie war wohl keine erfolgreiche Mimin, jemand, den man mit kleinen Nebenrollen besetzte, oftmals mit kaum ein paar Sätzen Text, was meine Großmutter mit den Jahren zermürbte und maßlos enttäuschte. Die verkannte und unterschätzte große Künstlerin.
Dass sie unter dem großen Gustav Gründgens arbeitete, war ein schwacher und eigenartiger Trost, denn obwohl man ihr nie die glanzvollen Rollen zuwies, war ihre Ehrfurcht und Bewunderung gegenüber dem bejubelten Mephisto unzerstörbar. Ich erinnere mich an die seltsame Mischung aus Melancholie und Abneigung, mit der meine Mutter immer wieder mal erzählte, wie meine Großmutter bei Festen lächelnd den Leitspruch ihres Bühnengottes deklamierte, ‚Berauscht euch, Freunde, singt und liebt und lacht, und lebt den schönsten Augenblick! Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück’, und der so wenig mit ihrem eigenen Lebensweg zu tun hatte, weil der Wein, den sie manchmal trank und die Geduld meines Großvaters so gänzlich andere Aufgaben zu erfüllen hatten.
Meine Mutter wollte nicht werden wie ihre Mutter. Und vielleicht war dieser Vorsatz genau der falsche Weg.
Als sie 1960 zur Welt kam, hängte meine Großmutter die Schauspielerei an den Nagel, versuchte mit mäßigem Erfolg eine gute Ehefrau und Mutter zu sein und besuchte bis zu ihrem Tod so gut wie keine Theatervorstellung mehr. Und als meine Mutter fünfundzwanzig Jahre später meinen Vater heiratete, hatte sie selber eine Ausbildung zur Sekretärin und ein paar wenig spektakuläre Jahre bei Löwensenf hinter sich, um ihren Beruf nach der Hochzeit aufzugeben und meinem Vater zwei Jahre lang bei Feinkost Mailen zu unterstützen. Bis zu meiner Geburt, von der an sich meine Mutter entschloss nur noch für die Familie da zu sein, ohne Zweifel in der festen Überzeugung, dass, wenn zwei das gleiche tun, dies noch lange nicht das gleiche ist.
In meinen zu oft stattfindenden Tagträumen stelle ich mir manchmal das Bild und den Augenblick vor, in dem mein Vater zum ersten Mal meine Mutter trifft. Mittlerweile sind es dermaßen detailliert ausgedachte filmische Sekunden, von denen ich weiß, dass sie nichts mit der wahren Vergangenheit zu tun haben, die meine Fantasie aber zu einem so einzigartigen und rätselhaften Mysterium zusammengebaut hat, weil ein solcher Moment und seine Folgen nicht das Geringste mit irgendetwas zu tun haben, was in meinem Leben ähnlich verlaufen wäre. In diesem kurzen Film finden Dinge statt, die ich nicht kenne und die ich trotzdem fühle, Dinge, die ich nicht verstehe und die dennoch Teil meiner selbst und vor allem Teil meiner Träumereien sind. Unvorstellbar und so erstrebenswert einfach.
Die hübsche Sekretärin, die nette junge Frau, die für ein paar Stunden auch die Rolle der Hostess am Löwensenf-Stand auf der ANUGA übernehmen muss und der überaus freundliche und charmante Feinkosthändler, den es aus beruflichem Interesse auf die Messe gezogen hat. ‚Eine Probe gefällig?’ ‚Aber gerne.’ ‚Diese beiden hier sind ganz neu. Probieren Sie! Sehr lecker!’ ‚Vielen herzlichen Dank.’ Ein Lächeln, das erwidert wird. Der Moment am Stand, der nur zu gerne in die Länge gezogen wird. Noch ein Lächeln. Vielleicht ein Prospekt, der gedankenverloren in der Innentasche des Jacketts verschwindet. Und irgendwann Fragen und Antworten, die so einfach zu stellen und zu geben sind, dass ich mich immer wieder über alle Maßen verstört frage, wohin diese Fragen und Antworten, diese Gelegenheiten und Situationen in den Jahrzehnten verschwunden sind und warum aus ehrlicher Leichtigkeit soviel bleierne Zwanghaftigkeit und absurde Verstellung werden konnte.
Ich rede von mir. Nur von mir. Ich weiß ja selber, dass es auch anders geht. Marie Wegener und Jens Große aus dem Team. Akuma und Ikem und ihre Freundinnen. Alles ganz cool und unverklemmt. Matze hat auch irgendetwas am laufen. Alles Beispiele, die als Beispiele nichts taugen. ‚Berauscht euch, Freunde, singt und liebt und lacht, und lebt den schönsten Augenblick!’ Ladet mich mal ein. Nein, ladet mich besser nicht ein. Dumme Fragen und wohlgemeinte Kommentare sind das Letzte, was ich brauche. Alles klar, nett gemeint ... Nein Danke. Außerdem habe ich sowieso keine Zeit mehr für Einladungen. Passt schon ...
Manchmal, selten, träume natürlich auch ich etwas. Mit selten meine ich, dass ich mich beim Aufwachen so gut wie nie an etwas erinnern kann. Bedenkt man, dass ich der Sohn eines Mannes bin, der sein Leben lang mit Lebensmitteln zu tun hatte und der selber der Sohn eines Mannes ist, der sein Leben lang mit Lebensmitteln sein Brot verdient hat, dann erscheint es mir schon reichlich absurd, dass ich mich an einen solchen Traum erinnere, den ich im Übrigen zwei- oder dreimal in irgendwelchen Varianten geträumt habe.
Ich bin ein Zwerg. Ein sehr kleiner Zwerg. Ich weiß das, weil das Dickicht aus weiß und rot blühenden Erbsenpflanzen, durch das ich mich schlage, hoch über meinen Kopf aufragt. Wenn ich an eine der Pflanzen stoße, und das passiert eigentlich unentwegt, dann platzen die Schoten auf und heraus rieseln winzige Klone meiner selbst. Kaum daumengroße Zwerge mit puterrotem Gesicht. Dann überquere ich einen Feldweg, auf dem mich um ein Haar ein riesiges Traktorrad überrollt, das einem Ungetüm gehört, das ich weder gehört noch gesehen habe, um im letzten Augenblick in das nächste Erbsenfeld zu flüchten. Wieder ein Himmel aus roten und weißen Blüten. Nur dass meine kleinen Spiegelbilder, die mir entgegen fallen, während ich durch den Erbsenurwald fuhrwerke, jetzt alle rosa Gesichter haben. Und irgendwann höre ich in der Ferne die Stimmen meiner Eltern, was mich völlig irritiert stehen bleiben lässt, weil meine Mutter mit der Stimme meines Vaters ruft und mein Vater mit der Stimme meiner Mutter. Im Traum weiß ich sowohl, dass das absoluter Unfug ist, weil ich beide ja nicht sehen kann, als auch dass es ganz sicher so ist. Ich weiß es einfach. Und dann wache ich auf und sehe als letztes eine rote, ein weiße und ein rosa Erbse in meiner Hand.
Ich habe noch nie jemand von diesen Träumen erzählt. Ich habe keine Lust auf mitleidige Blicke von einfühlsamen Leuten, die mich insgeheim für paranoid halten.
Die Stimmen meiner Eltern. Ich würde sie unter tausend anderen erkennen, weil ich mich ewig daran erinnern werde, wie sie klangen, sich verwandelten, wenn sie mir ihre so unterschiedlichen Geschichten erzählten. Und weil ich mich heute, im Nachhinein, manchmal frage, warum es eine Zeit gab, in der diese Stimmen auffallend wenig miteinander sprachen. Als kleines Kind registriert man das nicht sofort. Und wenn doch, dann wohl nur, wenn das Schweigen so laut und deutlich ist, dass ein kindliches Gemüt sich in seiner Fantasie die dunkelsten Gründe dafür ausmalt.
Als ich eingeschult wurde, hatte sich meine Mutter verändert. Sie war schweigsamer geworden, ernster und fahriger. Manchmal saß sie in Gedanken versunken am Küchentisch, auf dem Herd kochte irgendetwas vor sich hin, und starrte mit rot unterlaufenden Augen den Kaffeebecher an. Sie stand zunehmend später auf, lief manchmal noch im Morgenmantel herum, wenn ich aus der Schule kam, und ich weiß, dass ich sie zu Beginn meiner Schulzeit ein paar Mal wecken musste, um nicht zu spät zum Unterricht zu kommen. Diese Male dann ohne Frühstück. Und ich weiß auch, dass es Tage gegeben hat, an denen das Abendessen einfach ausgefallen ist, weil meine Mutter nichts vorbereitet hatte. Vieles passierte nur sporadisch und war, was mich anbelangte, kurze Zeit später vergessen. Puzzlesteine, die erst Jahre danach, und auch nur, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht ein Bild ergeben. Allerdings gab es jeden Monat Tage, an denen sie sich so hundeelend gefühlt haben muss, dass sie kaum das Schlafzimmer verlies.
Wenn mein Vater abends nach Hause kam, hängte er seinen Mantel an die Garderobe, schloss für ein paar Sekunden die Augen, und von da an erfüllte eine Aura von Aufmerksamkeit, Gleichmut und Nachsicht die Wohnung, die mir im Nachhinein damals auf eine unerklärbare Art als unheimlich vorgekommen sein muss. Hatte ich irgendetwas pexiert, war irgendetwas vorgefallen, musste ich irgendetwas beichten, es wurde zur Bagatelle erklärt. ‚Kommt nicht wieder vor, Julian. Wir beide wissen das!’
Er hat die Zeitschriften, die er meiner Mutter in dieser Zeit stapelweise vom Kiosk mitbrachte, wahrscheinlich gehasst. Er hat nie ein Wort darüber verloren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jemals eines dieser Blättchen, nachdem er sie meiner Mutter übergeben hatte, angefasst hat. Wenn sie sich, leergelesen, auf dem Wohnzimmertisch stapelten, hat er sie nicht einmal zum Altpapier gebracht. Das musste meine Mutter machen. Und eine Woche später wurden die neuen Ausgaben mit gleichen anderen bizarren Geschichten aus den Höllen und Paradiesen einer Parallelwelt, die meiner Mutter an ihren besonders schlimmen Tagen offensichtlich als perfektes Refugium dienten, kommentarlos neu geliefert.
Das Buch, aus dem mir meine Mutter in den vielen Jahren am häufigsten und liebsten vorlas, war Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Ich glaube, irgendwann konnte sie weite Passagen des Büchleins auswendig. Jede Figur bekam ihre eigene Stimme, und die des kleinen Prinzen war natürlich die beeindruckendste.
‚An einem Tag habe ich die Sonne dreiundvierzigmal untergehen sehen! Du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man die Sonnenuntergänge ...’
‚Am Tage mit den dreiundvierzigmal warst du also besonders traurig?’
Aber der kleine Prinz antwortete nicht, dieser allein mit der Gabe der herzlichen Einfalt und einem unerschütterlichem Vertrauen ausgestattete Sternenreisende, in dem meine Mutter wahlweise und sicherlich nie erklärbar und unbewusst entweder ihr eigenes Alter-Ego gesehen haben muss, oder aber den unerschütterlichen Freund oder Bruder, den jede liebende Mutter ihrem Sohn auf den Lebensweg wünscht. Ich habe keine Geschwister, und jedes Mal, wenn ich diese Jahre Revue passieren lasse, beschleicht mich der Eindruck, dass dieser Umstand der dunklere Teil der erträumten Pläne meiner Mutter war.
Und wenn der kleine Prinz Pause machte, übernahmen das kleine Gespenst, der Räuber Hotzenplotz und vor allem Alice aus dem Wunderland. ‚Wenn ich eine eigene Welt hätte, wäre alles Unsinn. Nichts wäre, was es ist, denn alles wäre, was es nicht ist. Und umgekehrt wäre das, was ist, nicht das, was es ist. Und was es nicht wäre, das wäre es. Seht ihr?’ Ob meine Mutter jemals ahnte, wie oft sie von sich selbst erzählte, ohne es zu wissen?
An den Tagen, an denen meine Mutter unauffindbar in ihrer Drangsal und ihrem stummen Leid versank, übernahm mein Vater. Er verstand sich nicht als Lückenbüßer oder Ersatz. Die von meiner Mutter ausgesuchten Bücher waren ihm alle bekannt, und ich denke, er schätzte sie sogar. Ich glaube, er sah es als Chance an, mir in diesen Momenten auch einmal eine ganz andere Zauberbrille aufzusetzen. Denn seine Geschichten und Erzählungen waren so ganz und gar anders als das, was meine Mutter aussuchte. Da gab es den Maulwurf, der wissen wollte wer ihm auf den Kopf gemacht hatte. Meine Mutter fand das Buch eine ‚seltsame Wahl’, und ihr wäre im Leben nicht eingefallen daraus vorzulesen. Mein Vater hingegen war der Meinung, dass man ‚darüber doch wohl reden müsse.’ Und ich fand den Maulwurf und seine Fragen außerordentlich interessant. Und äußerst witzig! Es gab Jim Knopf, Momo und das Sams, das meine Mutter irgendwie ‚reichlich albern und frech’ fand.
Aber alles wurde überstrahlt, wenn mein Vater eines der Bücher von Chris van Allsburg in die Hand nahm, einen Moment nachdachte und dann anfing zu erzählen. Es waren Geschichten, die in keinem Buch standen. In seinem Lieblingsbuch dieses Autors, und viele Jahre später auch meinem, stand nichts geschrieben. Es gab nur ganzseitige und absolut wunderbare, magisch anmutende Schwarzweißzeichnungen und eine Überschrift auf der gegenüberliegenden Seite. Die Geheimnisse von Harris Burdick. Und wenn mein Vater anfing, wurden diese Geheimnisse nach und nach von seiner Fantasie zum Leben erweckt. Ich weiß nicht, wie oft aus demselben Bild ein Märchen wurde, das etwas völlig anderes erzählte als beim vorangegangenen Mal. Und jede Geschichte, jedes Geheimnis begann in einem kleinen Lebensmittelgeschäft in einer weit entfernten Stadt.
Es war die Zeit, in der meine Eltern gemäß den unergründlichen Regeln einer stummen Absprache zwischen Eheleuten anfingen, jeder für sich Serien im Fernsehen zu schauen und das so zu organisieren, dass man sich nie in die Quere kam. Wenn meine Mutter Golden Girls schaute und nahezu alles, was die Figur der Rose Nylund sagte und tat positiv kommentierte, als aus den goldenen Mädchen Jahre später Desperate Housewives wurden, verkroch sich mein Vater in ein anderes Zimmer und las oder arbeitete. Im Gegenzug verschwand meine Mutter in der Küche, wenn mein Vater zu einer neuen Folge von Star Trek-The Next Generation ins Wohnzimmer kam. Viel später, im Jahr in dem ich Abitur machte und mein Vater mich längst mit seiner Vorliebe für SciFi infiziert hatte, saßen wir zu zweit vor dem Fernseher und schauten gebannt eine weitere Folge der Serie Lost. ‚Ich glaube nicht an Magie. Aber dieser Ort ist anders!’ Und meine Mutter schüttelte den Kopf und meinte: ‚Den verschwurbelten Kram versteht doch kein Mensch!’. Woraufhin mein Vater gelassen abwinkte und antwortete: ‚Regina, bitte! Ich sage ja auch nichts zu deinen alten Schachteln!’
Die Dämonen, die meine Mutter heimgesucht hatten, verschwanden mit den Jahren nach und nach. Ohne dass ich jemals wirklich erfahren habe, was sie ausmachte oder warum sie über sie hergefallen waren. Zu ihrem fünfzigsten Geburtstag schenkte mein Vater ihr eine zweiwöchige Reise nach Namibia. Auf die selbst gestaltete Geburtstagskarte hatte er einen alten, bärtigen Mann mit Schlapphut in einer Wüste gezeichnet, der aussah wie Herr Tur-Tur, der Scheinriese aus Jim Knopf. Und darunter stand: Geschichten erzählen nie die ganze Wahrheit. Denn von weitem ist alles so klein! Dein dich immer liebender Bernd.
Es gibt sie – es gibt sie nicht – es gibt sie ...
Er wird wieder – er wird nie wieder – er wird wieder ...
Es gibt sie nicht – es wird sie nie wieder geben ...