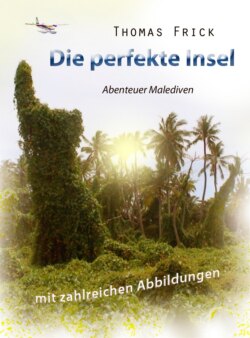Читать книгу Die perfekte Insel - Thomas Frick - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8. Mai 2007
ОглавлениеAm nächsten Morgen war Stefan schon los – ohne mich – zum Frühstück und ich hatte den Verdacht, er wollte sich so wenig wie möglich mit mir sehen lassen, aus Angst, geköpft zu werden. Diese Strafe, so hatte er erfahren, sieht die Scharia, die islamische Gesetzgebung, vor, wenn man als schwul entlarvt wird. Tatsächlich gab es hier nur ganz normale Hetero-Pärchen jeden Alters und einige glückliche Familien.
Am Büfett entdeckte ich einen Omelettemacher – ein Charakterkopf; er ähnelte Sammy Davis junior – mit riesiger weißer Papierkochmütze, wie ein Karnevalskoch, der machte mir ein Omelett mit herrlich vielen Zwiebeln und ich begann allmählich, mich wohlzufühlen. Aber Knoblauch hätte er nicht, sagte er streng, so etwas gäbe es ja wohl nur am Abend.
Ich haute mir den Wanst voll und folgte dann Stefan ins Internetcafé, aber am Tage war die Verbindung auch nicht besser. Das läge am Satelliteninternet und den Wolken, erklärte der junge Operator.
Ich wollte erst gar nicht, aber Stefan kaufte vorsichtshalber eine große Tube Sonnencreme mit einem betonartigen Schutzfaktor, der vermutlich im Iran auch zum Schutz gegen Atomraketen benutzt wird. Stefan ließ als Bewohner von Dubai den abgebrühten Sonnenbrand-Kenner heraushängen und warnte mich noch mehrmals davor, aufs Eincremen zu verzichten. Ich hingegen hielt das Zeug für schädlicher als die Sonne selbst und meinte, ein Hemd würde reichen.
Im Bungalow checkten wir die bisher gemachten Videoaufnahmen. Wir konnten die Kamera direkt an den Zimmerfernseher anschließen und obwohl er kein 16:9-Format darstellen konnte, also die Bilder auf ein seltsames Hochkantformat quetschte, sahen die ersten Versuche schon gar nicht mal so übel aus. Bereits auf der Hinfahrt waren wir an vielversprechenden Inseln vorbeigekommen, die zwar zum Teil bewohnt waren, aber zur Not schon als Drehort gepasst hätten. Nur eine brauchbare Inseltotale, also eine unverbaute kleine Insel mitten im Meer, hatten wir noch nicht gesehen. Und natürlich gab es eine Menge Details, die wir alle an einem einzigen Ort zu finden hofften: Palmen, die direkt ins Wasser reichten, Kokosnüsse, eine Sandbank, einen malerischen Strand, begehbare Wege und Lichtungen im Inneren, geheimnisvolle Tiere, am besten Haie, und all das natürlich in der besten Saison menschenleer, aber in der Nähe eines guten, aber billigen Hotels.
Dann verpackte ich die Kamera zusammen mit einem frischen Akku und einer leeren Kassette im nagelneuen Unterwassergehäuse. Ich war sehr gespannt, ob das funktionieren würde oder ob die Kamera etwa bei der erstbesten Gelegenheit absoff.
Wir machten uns mit unseren Schnorchelsachen und je zwei großen Wasserflaschen auf den Weg zum Boot, das bereits auf uns wartete. Die Besatzung sah aus wie durchschnittlich vierzehn und in der Mitte des Dhonis stand eine große Kühlbox, randvoll mit in Silberfolie verpacktem Essen.
Erst mal gab es eine Diskussion, denn anstelle der am Vortag mit der Rezeption vereinbarten drei Inseln sollten nur die ersten beiden angefahren werden. Ich argwöhnte Faulheit und Missmanagement und sah uns schon in einem Sumpf nicht eingehaltener Absprachen und Aufmüpfigkeit versinken. Stefan klärte das aber, ganz der coole Producer, und endlich ging es los.
Auf dem Vordeck des Dhonis lag ein kleines abgewetztes hölzernes Ruderboot, das zwar nicht so aussah, als ob es schwimmen könnte, dafür aber wie die perfekte Materialisierung der Nussschale, die mir beim Drehbuchschreiben als Transportmittel für unseren Postmann vorgeschwebt hatte. Wir engagierten es auf der Stelle.
Zwischen der Nachbar-Hotelinsel „Sun Island“ und einer nur für Einheimische zugänglichen Insel namens Fenfushi entdeckten wir im Vorbeifahren noch ein kleineres Inselchen, das bisher noch von niemandem erwähnt worden war, mir aber auf Anhieb sehr gut gefiel. Es hieß Tholofushi. Da wir dort aber keine Erlaubnis zum Landen hatten, tuckerten wir, ohne uns näher damit zu befassen, weiter; die ersten vierzig Minuten nach Bodofinolhu – immer parallel zu dem weiß schäumenden und bis hierher hörbaren Außenriff, das in einigen Kilometern Entfernung den ganzen Horizont entlang zu sehen war. Die Sonne feuerte fast senkrecht herab, wie im Kino, aber durch den Seewind war es angenehm kühl. Witzigerweise war ich es, der sich mit der dicken Sonnenpampe einschmierte. Stefan winkte gelangweilt ab: „Ja, später …“
Hinter Bodofinholu folgten ein paar Kilometer Sandbänke. Eine von ihnen krönte ein grüner Klecks aus Buschwerk, keine Palmen, aber immerhin unsere erste einsame Insel, auf die wir nun durften.
Wir lehnten eine Überfahrt mit der Nussschale heldenhaft ab und ließen uns samt Schnorchelzeug und Kamera zu Wasser. Ich hatte in diesem Jahr noch nicht angebadet und ließ mich mit einem Gefühl von leichter Aufregung ins Wasser gleiten. Es war warm, warm wie in einer Badewanne, aber es war immerhin nass. Das Gehäuse schien fürs Erste dichtzuhalten, aber ein anderes Problem wurde spätestens jetzt sehr deutlich: Die verdrehbare Videoausspiegelung des Camcorders wird klugerweise mit einem Spiegel so umgeleitet, dass man das Bild bequem von hinten durchs Unterwassergehäuse betrachten kann. So weit die Theorie, die für schummerige japanische Bergseen auch zutreffen mag, aber hoch über unseren Köpfen ballerte etwas, was man schon getrost als Äquatorsonne bezeichnen durfte. Und diese war so extrem hell, jedenfalls so viel heller als der ausgespiegelte Minimonitor, dass ich nichts sehen konnte, nicht einmal, ob die Kamera überhaupt an war, geschweige denn Einzelheiten des Displays.
Wenn ich das geblendete Auge direkt an das Gehäuse presste, war ein bisschen zu erkennen. Also hieß es: wassertreten, Taucherbrille abnehmen und nachgucken. Aha, die Kamera war im Standby-Modus. Also: einschalten, Brille aufsetzen und tauchen. Zum Abschalten die gleiche Prozedur. Oder hatte ich in meiner Aufregung einmal zu oft gedrückt?
Aber immerhin, ich machte die ersten Unterwasserbilder mit der neuen Technik – was allerdings noch nicht so viel einbrachte, denn außer Sand, abgestorbenem Korallenschrott und ein paar wenigen mehr oder minder bunten Fischlein war nichts Spektakuläres auszumachen. So schnorchelten wir voller Neugierde auf die Insel zu.
Irgendwann nach 200 Metern wurde es so flach, dass ich die Flossen ausziehen musste, sie unter den Arm klemmte und aufrecht und barfuß auf die Insel zu marschierte. Es piekte ganz unromantisch in die Sohlen und ich ging vorsichtig wie ein Storch, dachte an Seeigel und Steinfische. Bei Letzteren sagt man, man könnte nach einem Stich getrost weiterschwimmen. Ein Arzt lohne nicht, weil man eh nach zwanzig Minuten tot sei. Eventuell solle helfen, die Stelle mit über siebzig Grad heißem Wasser abzubrühen. Na immerhin, dreißig Grad waren es ja schon überall.
Stefan war wie immer schneller und nahm den weißen ebenso stacheligen Strand zuerst in Besitz. Viel zu sehen war nicht, außer einer Menge Müll, von Touristen dagelassen oder angeschwemmt.
Ein bisschen ratlos latschten wir herum und machten uns gegenseitig Mut. Klar, zur Not könnte man hier irgendetwas drehen, was wie eine einsame Tropeninsel aussehe, aber ohne Palme war das Ganze doch nur ein Haufen Sand und der Busch war viel zu klein für die Verfolgungen und anderen Handlungselemente.Ich knipste mit der Sony im Fotomodus ein paar Gipfelfotos und sah dabei vor greller Helligkeit nicht einmal, ob ich gerade im Tele- oder Weitwinkelbereich war.
Indessen hatte unsere Besatzung das Beiboot zu Wasser gelassen und zwei Jungs von der Crew stakten uns langsam entgegen. Mangels Ruder stießen sie sich mit einer weißen Stange ab. Als Stefan einstieg, war das halbe Ding schon voller Wasser. Ich jauchzte vor Entzücken, das schrottige Teil, das bei der kleinsten Bewegung abzusaufen drohte, war perfekt für den Film. Dieses Minischiffchen war so armselig, dass damit die Charakterisierung des Postmanns ganz von alleine funktionierte.
Wieder im Dhoni stürzten wir uns auf unsere Wasserflaschen. Ich sagte Stefan, dass sein Rücken schon ein bisschen rot sei. Und weiter ging es – die nächsten vierzig Minuten mit Volldampf zur Insel Huruelhi, die schon ganz klein am Horizont zu sehen war.
Je näher wir kamen, desto optimistischer wurden wir, denn hier sah es schon viel besser aus. Über einem langen hellen Traumstrand stand ein saftig grüner Wald aus Büschen und wunderschönen Kokospalmen. Ein vor Anker liegendes Boot störte uns zunächst nicht weiter, klar mussten wir damit rechnen, dass auch andere Leute hier unterwegs waren.
Wir ankerten, sprangen ins Wasser und schwammen an Land.Am Strand standen ein paar einsame weiße Sonnenschirme herum, aber zum Glück waren es transportable, die wir natürlich zum Drehen entfernen würden.
Von Nahem war die Insel noch schöner: ein perfekter weißer Strand, mehrere Palmengruppen und das Ganze nicht zu groß und nicht zu klein. Eine sandige Lücke in den Büschen führte zu einer Lichtung unter einer Gruppe von Palmen, unter denen ein Büfett aufgebaut war und ein paar Leute auf Romantik machten. Eine Art Bodyguard kam eilig auf uns zu und teilte uns unmissverständlich mit, diese Insel gehöre dem Hilton-Hotel und dass wir die Insel sofort verlassen müssten, wenn wir nicht zufällig Gäste seien.Wir hatten laut unserer Rezeption eine Erlaubnis, aber der gute Mann wusste natürlich nichts davon. Bevor ich anfangen konnte, zu diskutieren und auf unsere leider nur mündliche Genehmigung vom Holiday-Island-Management zu pochen, kam Stefan mir mit einem charmanten Lächeln zuvor. Er mimte vollstes Verständnis. Ober er sich als Ehrenmitglied des Hilton-Clubs – oder so ähnlich – mal am Strand umsehen dürfte? Vermutlich allein die Tatsache, dass er solche Wörter überhaupt kannte, ließ den Bodyguard strammstehen und er erlaubte uns einen ganz, ganz kurzen Blick aufs Paradies.Wir gönnten uns einen halbstündigen Spaziergang rund um die Insel und danach schnorchelten wir noch ausgiebig in den heiligen Gewässern.
Das Hausriff war ansehnlich, es gab keine großen oder seltenen Fische, aber immerhin eine Menge intakter Tischkorallen mit schönen Fischschwärmen, über die ich im Blindflug und ein wenig zu hektisch – mit der Kamera auf Dauerbetrieb – dahinplanschte, nie ganz sicher, ob sie tatsächlich an war.
Wegen der vorangegangenen Stürme und Regengüsse war das Wasser relativ trübe und es herrschte eine starke Strömung. Trotzdem tat es wieder einmal gut, nach Jahren über einem Korallengarten zu schweben. Es war wirklich schon verdammt lang her.
Auf der folgenden etwa 25 Kilometer langen Fahrt quer durch das Süd-Ari-Atoll zu einem Inselchen namens Dhehassanu Lonu Bui Huraa hatten wir dann ausgiebig Zeit, zu relaxen. Ich stürzte mich, inzwischen hungrig, auf die Lunchbox. Darin waren Melonen, bei denen mir schon vom Geruch schlecht wurde, kalte pappige Pommes frites mit Ketchup, der sich weigerte, die schützende Flasche zu verlassen, und etwas, was zunächst wie Hühnersandwich aussah und nach allem Möglichen roch.Ich aß es gierig und hatte das zweite Ding schon halb herunter, als ich merkte, dass es wohl doch Thunfisch enthielt. Dazu sei erwähnt, dass mich seit frühester Kindheit wenn nicht eine Fischallergie, doch zumindest eine ausgeprägte Aversion gegen alle Arten von Seafood plagt und ich jedes Mal die Farbe wechsle, wenn ich geräuchertem Aal, Seelachs, Shrimps, Seetang, ja, selbst Delfin in Dosen auch nur zu nahe komme.
Stefans Rücken war inzwischen krebsrot. Ich sagte es ihm und piekte ihn zur Untermalung noch einmal mit dem Finger an, aber es schien ihn, den sonnenerprobten Wüstensohn und Dubaianer, einfach nicht zu interessieren. Ich prophezeite ihm also eine unschöne Nacht.
Unermüdlich pflügte das Dhoni durch die Wellen. Die Besatzung traute sich nicht an die Lunchbox, vermutlich nicht, weil es ihnen nicht schmeckte, sondern weil sie einfach nicht durften. Wenigstens konnte Stefan ihnen ein paar von den Melonenstückchen verabreichen. Es war ein seltsames Bild: die drei braungebrannten einheimischen Skipper, dicht um das Steuerrad gedrängt, und in der vorderen Hälfte des Schiffes die beiden Weißen bzw. Roten, die eine irrsinnige Summe Geldes dafür ausgaben, sich menschenleere Inseln anzusehen, beim Anblick eines verranzten Miniruderbootes fast auf die Knie sanken und die tolle Kiste mit den Leckereien verschmähten.
Und dann kamen wir nach einer Stunde Fahrt zu der Insel mit dem langen Huraah-Namen und wollten gar nicht erst aussteigen, obwohl es sogar einen schicken langen Steg gab und Wellenbrecher sowie riesengroße Sonnenschirme, also richtig gemütlich, erschlossen, zivilisiert.
Stefan lief pro forma doch mal schnell die paar Meter zur Inselmitte und kehrte gleich kopfschüttelnd wieder um. Man hatte uns eine leere Insel nur mit ein paar Palmen versprochen, das Satellitenbild hatte es auch so gezeigt, aber die Zivilisation hatte bereits zugeschlagen. Das hier war ein totaler Reinfall.
Aber dennoch mussten wir, nur weil wir die mit viel Geld so schön hergerichtete Insel betreten hatten, noch zu einer daneben liegenden Hotelinsel fahren und die fällige Gebühr bezahlen. Von der Besprechung am Vortag hatte ich noch so etwas wie drei Dollar in Erinnerung, jetzt waren es auf einmal schon zehn.
Stefan reichte zwanzig herüber und wartete auf das Wechselgeld. Nein, selbstverständlich waren schon immer zehn Dollar pro Nase gemeint! Und da bewunderte ich mal wieder, wie wenig der sonst so Sparsame am Gelde hing und sich die Laune nicht verderben ließ. Er respektierte vermutlich die Geschäftstüchtigkeit der Insulaner.
Zurück im Bungalow sahen wir uns die Aufnahmen an, die – abgesehen vom Gewackel beim Ein- und Ausschalten – überraschend gut aussahen. Wir diskutierten verschiedene Möglichkeiten, die Kamera mit dem Unterwassergehäuse vernünftig einzusetzen, sodass man auch etwas sah und Kontrolle über sie hatte. Vielleicht half ein Tuch über dem Kopf? Ich erinnerte mich, dass unser Kameramann Guntram in der Wüste in Tunesien mit einem Tuch gearbeitet hatte. Ob das unter Wasser funktionierte, wollten wir beim nächsten Mal probieren.
Stefan hatte einen üblen Sonnenbrand, während ich nach wie vor käseweiß war, aber mit einem seltsamen expressionistischen roten Ausschlag auf dem Rücken, der unheimlicherweise die Form von Flügeln hatte. Zunächst befürchtete ich eine Allergie, doch im Spiegel gesehen kapierte ich: Dort, wo meine eigenen Hände mit dem Sonnenöl nicht hinkamen, war ich ebenso verbrannt wie Stefan. Da fehlten die liebevollen Hände meiner Lieblingsreisebegleiterin. Pech gehabt!Stefan fiel bald in Tiefschlaf – phänomenal, wie viel der schlafen kann – und ich schlich mich davon und drehte noch für ein Stündchen eine Runde um die Insel, betrachtete den Sonnenuntergang, grübelte über dieses und jenes, bis es dunkel war.
Beim Abendbrot entdeckte ich dann endlich neben dem Salatdressing eine große Schale mit gehacktem Knoblauch in Öl und machte das Zeug auf sämtliches Essen – außer natürlich auf die Kuchen, Puddings und Pasteten, die es in unerschöpflicher Vielfalt und jeden Tag wechselnd als Nachtisch gab.
Später saß ich noch stundenlang mit einem frisch gepressten Orangensaft und dem kleinen Jornada-Computer vor dem Restaurant am Ufer und schrieb die Ereignisse des ersten Tages auf. Hinter mir verwurstete eine Coverband alles, was einem lieb war, von Bob Marley bis zu den Doors und Pink Floyd. Es war entsetzlich, aber irgendwie passte es auch wieder.
Dann ging ich schlafen, bis mich ein Wackeln meines Bettes weckte.
Ich rief: „Stefan?“ – aber er rührte sich nicht. Ich hatte den Stoß ganz sicher nicht geträumt, dachte gleich an Erdbeben und Tsunamis und malte mir aus, was ich tun würde oder konnte, wenn plötzlich eine Lastwagenladung Wasser durch die Scheibe gedonnert käme. Vermutlich konnte ich gar nichts tun, außer sterben.
Ich dachte darüber nach, ob mir das recht wäre. Nein, wäre es nicht, jetzt wollte ich erst einmal einen anstrengenden und schönen Film machen. Wenn es mich jetzt erwischte, würde ich sicher spuken. Immerhin, dachte ich noch, wäre eine Ferieninsel im Indischen Ozean nicht der schlechteste Ort dafür.
Als ich nach einer halben Stunde des zum Fenster Starrens beinahe eingeschlafen war, schien plötzlich ein autostarker Scheinwerfer ins Fenster. Nun gibt es aber keine Autos auf der Insel und ich war wieder hellwach, dachte an Piratenüberfälle, Al Quaida und Tsunamispätwarnungskommandos. Ein seltsames stark beunruhigendes Geräusch, das wie ein heranrollender Schnellzug klang, ließ mich kerzengerade sitzen. Sollte ich mich anziehen und irgendwohin rennen? Sollte ich Stefan wecken?
Doch es waren nur der Regen auf dem Dach und ein bisschen Sturm und weiter passierte auch nichts. Und am nächsten Morgen sagte mir Stefan, er hätte nur mal kurz an meinem Bett gewackelt, wegen meines katastrophalen Schnarchens.