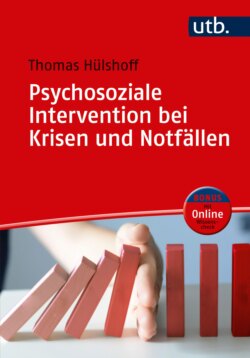Читать книгу Psychosoziale Intervention bei Krisen und Notfällen - Thomas Hülshoff - Страница 8
Оглавление1 Grundlagen
1.1 Notfälle und Krisen
1.1.1 Einführung
Dieses Buch wendet sich an Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Pädagogen und Pädagoginnen sowie Psychologen und Psychologinnen – also Menschen, die ihre berufliche Aufgabe darin sehen, Menschen zu begegnen, sie zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen. Dabei haben sie, je nach Profession, unterschiedliche Aufgaben und Ziele und bedienen sich auch unterschiedlicher Konzepte und Methoden. Und wenn – von speziellen Arbeitsfeldern, z. B. in Krisenzentren, einmal abgesehen – Notfallversorgung und Krisenintervention auch nicht den Hauptteil ihrer professionellen Tätigkeit ausmachen, so kommt es doch gelegentlich, manchmal auch häufiger, zu Situationen, in denen sie mit akuten Krisen ihrer Klienten oder sogar akuten Notfällen konfrontiert sind. Diese erfordern in der Regel eine schnelle Übersicht über die Gefahrenlage und die Gesamtsituation sowie zielgerichtete, schnelle Entscheidungen. Häufig erfordert eine Krisensituation auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dabei obliegen Sozialarbeitern und Pädagogen meist nicht akute Notfallmaßnahmen im engeren Sinne. Vielmehr geht es oft darum, eine Notfallsituation als solche zu erkennen, erste – mitunter lebensrettende – oder zumindest deeskalierende Schritte einzuleiten, gezielt adäquate Hilfe zu organisieren und daran anknüpfende Krisenerfahrungen wiederaufzunehmen und nachhaltige Hilfe anzubieten.
Von der Notfallversorgung zur Krisenhilfe
Aber wenn auch in der akuten, mitunter lebensgefährlichen Phase eines erfolgten Suizidversuchs, eines heftigen psychosebedingten Erregungszustandes oder einer Drogenintoxikation medizinische Hilfe im Vordergrund stehen mag – im Vorfeld haben Angehörige pädagogischer und psychosozialer Berufe die Aufgabe, Gefahren abzuwehren und schnellstmöglich Hilfe medizinischer Art zu organisieren. Wenn keine akute, lebensbedrohliche Gefährdung mehr besteht, gilt es, sehr schnell wieder pädagogische und psychosoziale Gegebenhei-ten zu berücksichtigen und auch auf dieser Ebene den Betroffenen zu helfen, die Krisensituation zu überwinden.
Drogenintoxikation
Hierzu ein Beispiel: Eine Heroinintoxikation sollte der Streetworker als solche erkennen (zunehmende Bewusstseinstrübung, stecknadelkopfgroße Pupillen etc.), sich der Gefahr einer tödlichen Atemlähmung bewusst sein, ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen und schnellstmögliche notfallmedizinische Hilfe holen. In dieser Phase ist die weitere Notfallhilfe – die Entgiftung – also wesentlich eine medizinische Aufgabe. Aber nicht nur: Spätestens nach der akuten lebensbedrohlichen Phase stellt sich bereits in der Klinik die Frage danach, wie es zu dieser Situation kam, ob der Betroffene etwas an seiner Situation ändern will und kann, und ob und wie er weitere Vergiftungen verhindern will usw. Hilfestellungen bei solchen Entscheidungen erfordern spezielles theoretisches Wissen und praktische Kompetenzen, je nach Situation und Vorgeschichte auch sozialer, pädagogischer oder psychologischer Art.
Methodisches Vorgehen
Auch sehr konkrete methodische Interventionen (Krisenintervention, Motivational Interviewing, Psychoedukation, Empowerment) können nötig und hilfreich sein.
Qualitativer Entzug
Bei der Entzugsbehandlung beispielsweise hat es sich gezeigt, dass ein qualitativer Entzug, der solche Fragestellungen aufgreift, ein bio-psychosoziales Krisenbild berücksichtigt und auf interdisziplinäre Zusammenarbeit zurückgreifen kann, einer rein biologisch-medizinischen Behandlung, was Nachhaltigkeit und Rückfallprophylaxe angeht, um ein Vielfaches überlegen ist. Auch im weiteren Verlauf, beispielsweise in der aufsuchenden Sozialarbeit, in pädagogischen Fördersituationen oder in weiterführender Psychotherapie, mag es sinnvoll sein, gelegentlich auf das damalige Krisengeschehen bzw. den Notfall einzugehen.
1.1.2 Was ist eine Krise?
Immer wieder werden wir im Laufe unseres Lebens vor neue und unbekannte Herausforderungen gestellt, mit besonderen Belastungen konfrontiert oder geraten in Situationen, die eine Veränderung bedeuten oder erfordern. Verstehen wir unter einer Krise die Verunsicherung und Ungewissheit, die mit solchen Herausforderungen einhergeht, dann gehören Krisen selbstverständlich zu unserem Leben.
Krisen gehören zum Leben
Auch die Erfahrung, dass bisherige Lösungsmuster nicht mehr weiterhelfen, man sich zutiefst verunsichert fühlt, zunächst keinen Ausweg aus der Situation sieht, körperliche und seelische Anspannung wahrnimmt und sich mitunter überfordert und ängstlich fühlt, ist eine normale, uns nur allzu gut bekannte Lebenserfahrung. Wie wir gleich noch sehen werden, gelingt es uns häufig, aus eigenen Kräften oder mithilfe unseres sozialen Umfeldes, beispielsweise der Familie, eine solche Krise zu meistern, aus dieser Herausforderung gestärkt hervorzugehen und ein neues Niveau – was Lebenserfahrung und Lösungsstrategien angeht – zu erreichen. Andererseits können die Herausforderungen so gewaltig und die Schwierigkeiten so überfordernd sein, dass eine Krise auch die Gefahr des Scheiterns beinhaltet – zum einen können fehlgeleitete „Selbstheilungsversuche“ oder dysfunktionale Lösungsstrategien in eine lebensbedrohliche Gefährdung münden – wie das beispielsweise bei Suizidalität, selbstverletzendem Verhalten oder Drogenmissbrauch der Fall sein kann. Zum anderen können chronisch überfordernde Krisensituationen auch zu körperlichen oder schweren seelischen Erkrankungen, beispielsweise Depressionen, führen. Was also macht eine Krise aus?
Der Begriff Krise kommt aus dem Griechischen (krinein: trennen, unterscheiden), bezeichnet eine entscheidende Wendung und bedeutet eine schwierige Situation, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Insofern sprechen wir von Krisen, wenn wir mit einem bis dato zumindest in dieser Ausprägung unbekannten Ereignis konfrontiert sind, das eine Entscheidung verlangt und ein Problem darstellt, für dessen Lösung wir keine hinlänglichen Erfahrungen und bewährten Lösungsstrategien (Coping-Strategien) haben oder zu haben meinen. Insofern führen solche Situationen zu erheblichen Unsicherheiten, Ängsten und Aufregungen, stellen andererseits aber auch eine Herausforderung dar, nach deren Meisterung wir uns (emotional, körperlich, seelisch und kognitiv) auf einem höheren Niveau befinden.
Krisen als Übergangsphänomen
Krisen sind typische Phänomene des Übergangs. Sie sind allgegenwärtig, kommen in jeder Lebenssituation vor und sind letztlich nicht zu vermeiden. In der Pubertät treten sie als phasentypische Übergangskrisen auf, beispielsweise, wenn der erste Samenerguss oder die erste Menstruation erlebt wird, eine besondere Abschlussprüfung ansteht, der Auszug aus dem Elternhaus zu bewerkstelligen ist usw. Darüber hinaus kann es durch außergewöhnliche, individuell auftretende oder gesellschaftlich bedingte Auslöser zu Krisensituationen kommen: Hierzu zählen beispielsweise gesellschaftlich bedingte, sich aber auch individuell auswirkende Arbeitslosigkeit, Krieg, Flucht und Vertreibung, Naturkatastrophen, soziale Verwerfungen und andere Traumata.
Zeitliche Begren zung von Krisen
Krisen sind zeitlich begrenzt. Der situative und emotionale Ausnahmezustand ist oft so unerträglich, dass wir auf jeden Fall dieser Situation zu entkommen versuchen – im günstigen Fall durch Inanspruchnahme von Hilfe, beispielsweise von Freunden, aber auch durch geschulte Krisenhelfer oder Therapeuten; im weniger günstigen Fall, in dem wir Einzelaspekte der Krise abwehren (beispielsweise eine drohende Krebserkrankung leugnen, uns mit Drogen betäuben, Gefahren nicht wahrhaben wollen etc.). Im ungünstigsten Fall können sich schwerwiegende Entwicklungsstörungen (psychosoziale Isolation und Rückzug, Schulabbruch, Karriereknick und dergleichen mehr), körperliche oder psychische Erkrankung (Psychosen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen etc.) oder gar akut lebensbedrohliche Situationen (z. B. Suizidalität) einstellen.
Psychosoziale Krise
Da der Krisenbegriff sehr vielgestaltig – um nicht zu sagen schwammig – ist, führt Sonneck (2002, zit. in Stein 2009, 22) den Begriff der „psychosozialen Krise“ ein. Nach Stein (2009, 23) sind psychosoziale Krisen dadurch charakterisiert, dass sie mit neuen Lebensumständen oder belastenden Ereignissen einhergehen, wesentliche Lebensziele in Frage stellen, zu befürchtetem oder tatsächlichem Versagen von Problembewältigungsmöglichkeiten führen, als bedrohlich erlebt werden und zu einem gestörten psychosozialen Gleichgewicht führen, das Selbstwertgefühl beeinträchtigen und als wichtige Weichenstellung für die Zukunft erlebt werden.
Unter einem Notfall soll im Folgenden eine Situation verstanden werden, in der sich eine Krise so zugespitzt hat, dass die akute Gefahr einer schweren seelischen oder körperlichen, möglicherweise sogar irreversiblen oder lebensbedrohlichen Gefährdung besteht. Auch die Gefährdung anderer (beispielsweise durch Gewalt im Rahmen akuter Erregungszustände) ist in diesem Sinne als Notfall zu betrachten.
Eine Notfallsituation erfordert unmittelbares Eingreifen zum Schutz des Betroffenen, manchmal auch des Umfeldes, und ist in der Regel von Angehörigen einer Berufsgruppe allein nicht zu meistern. Oft sind medizinische (psychiatrische oder notfall- bzw. intensivmedizinische) stationäre Maßnahmen erforderlich (Intensivstation, Entgiftungsstation, psychiatrische Klinik). In der Regel beschränkt sich die akute psychiatrische oder intensivmedizinische Behandlung darauf, den körperlichen oder seelischen Ausnahmezustand zu überwinden, körperliche wie seelische Abläufe zu stabilisieren und das Überleben zu ermöglichen. Hieran setzt im Folgenden die Krisenintervention sowie die Reintegration in das normale Umfeld an. Wo dies nicht ausreicht, sind möglicherweise psychotherapeutische Behandlungen, längerfristige pädagogische Förderungen oder sozial unterstützende Maßnahmen hilfreich.
1.1.3 Psychodynamik und psychisches Erleben
Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit
Eine Krise geht u. a. mit Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit, gesteigerter Anspannung, seelischer und sozialer Desorientierung sowie Verwirrung einher. Unter einem „Skotom“ versteht man das Phänomen, dass man quasi mit Scheuklappen in die Welt schaut und weder eigene Kräfte, noch Hilfsangebote oder Lösungsmöglichkeiten von außen wahrnehmen kann. Das Erleben, dass bisherige Kräfte und Lösungsmöglichkeiten nicht weiterhelfen, wird verallgemeinert – etwa in dem Sinne, dass man grundsätzlich nicht in der Lage sei, die Situation zu bewältigen, indem man neue Fähigkeiten entwickelt. Diese Hilflosigkeit geht mit dem Erleben überbordender Belastungen, Herausforderungen und Bedrohungen, möglicherweise sogar lebensgefährlicher Bedrohungen, einher.
Kontrollverlust
Die Unfähigkeit, die Situation zu strukturieren und zu kontrollieren, wird als Chaos erlebt, die Betroffenen fühlen sich verwirrt und geraten außer Gleichgewicht. Grundsätzlich meint man, wichtige – sogar überlebenswichtige – Dinge nicht mehr kontrollieren zu können und fühlt sich wie gelähmt. Auf emotionaler Ebene geht dieses Erleben oft mit extremer Angst bis hin zu Panikattacken und dem Gefühl einer „Lähmung“ einher. Das gleichzeitige Erleben von „Lähmung“ bei hochgradiger Erregung ist auf der vegetativ-physiologischen Ebene durch eine extreme Reaktion sowohl des sympathischen wie auch des parasympathischen Nervensystems zurückzuführen.
Verlust von Selbstwirksamkeitserwartung
Mit der erlebten Ohnmacht sinkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also das subjektive Vermögen, etwas gemäß den eigenen Zielvorstellungen erreichen zu können. Eng damit verknüpft ist das Selbstwertgefühl, also das Empfinden, ein wertvoller, eigenständiger, für andere wichtiger und zu sich selbst stehender Mensch zu sein.
Psychodynamische und situative Einengung
Mitunter kann es in Krisensituationen auch zu einer psychodynamischen und situativen Einengung kommen. Psychodynamisch in dem Sinne, dass sich Sichtweisen und Handlungsspielräume zunehmend verengen und der Betroffene immer weniger Alternativen zur Überwindung seiner misslichen Situation sieht. Dies kann mit einer primär situativen, krisenbedingten Einengung verbunden sein, wenn etwa der Zusammenbruch sozialer Netze, der Verlust eines Angehörigen oder eines Arbeitsplatzes oder eine schwere Krankheit tatsächlich zu massiven Einschränkungen führen, die dann auch krisenhaft erlebt werden. Es kann aber auch sein, dass infolge der dynamischen Einengung, des Rückzugs oder der sozialen Situation sekundär soziale Netze verschwinden, Krankheiten entstehen oder ein Arbeitsplatz verloren geht.
1.1.4 Krisenmodelle, Formen der Krise
Krisenkategorien
Es dürfte bereits deutlich geworden sein, dass Krisen äußerst vielschichtig und heterogen sind. Krisenmodelle versuchen, verschiedene Ausprägungen und Formen von Krisen in Einheiten / Entitäten zusammenzufassen und daraus möglichst passgenaue Interventionsempfehlungen abzuleiten. Einem auch in Deutschland weit verbreiteten Schema des österreichischen Psychiaters Claudius Stein (2009, 49) folgend, kann man mit einer gewissen Pragmatik Verlustkrisen, Krisen bei Lebensveränderung, Entwicklungskrisen, akute Traumatisierung, posttraumatische Belastungsstörungen, Zustände des Burnouts, narzisstische Krisen (bei Persönlichkeitsstörung) sowie psychiatrische Notfälle unterscheiden. Hinzu kommen krisenbedingte medizinisch-relevante Notfälle anderer Art (beispielsweise Intoxikationen). Die meisten dieser Krisenkategorien werden, wenn auch in einer anderen Reihenfolge und einem eher arbeitsfeldbezogenen Duktus, in diesem Buch aufgegriffen.
Verlustkrisen
Verlustkrisen treten z. B. bei dem Verlust eines Angehörigen (beispielsweise durch Trennung / Scheidung oder Tod), dem Verlust der Heimat, dem subjektiven oder objektiven Verlust des Gefühls der Integrität, beispielsweise nach einer krebsbedingten Brustamputation, aber auch nach dem Verlust eines als wichtig erachteten Ziels oder einer Idealvorstellung auf. Sie gehen mit Trauer und Kummer sowie erhöhter Verletzlichkeit und mitunter auch mit Depressionsgefährdung einher. Nach Stein bietet sich die Krisenintervention (vgl. Kapitel 2.2) als Hilfe zur Überwindung einer Verlustkrise an. Erst bei Übergängen zur Depression ist ggf. auch an eine psychotherapeutische Behandlung zu denken. Im vorliegenden Buch wird auf krankheitsbedingte Verlustkrisen am Beispiel von Krebserkrankungen (vgl. Kapitel 5.1) sowie auf Krisen bei Verlust der Heimat (Kapitel 7.1) eingegangen.
lebensverändernde Life Events
Auf Krisen bei Lebensveränderung wird u. a. in Kapitel 7.1 (Migration) und 7.2 (Flucht) eingegangen. Solche Life-Events, also lebensverändernde Ereignisse, kommen in der Regel von außen, zufallsartig und entziehen sich weitgehend der Kontrolle des Betroffenen. Nach einer ersten Phase der Konfrontation und einer zweiten, in der subjektiv der Verlust erlebt und versucht wird, die Kontrolle über die Situation zu gewinnen, kommt es zu einer Phase der Mobilisierung und – wenn auch dies scheitert – zum Vollbild der Krise. Erst die Bearbeitung, oft mit externer Hilfe, und die Neuorientierung angesichts der sich massiv geändert habenden Umstände führen letztendlich aus dieser Krise.
Entwicklungskrisen
Entwicklungskrisen hingegen, wie beispielsweise Pubertätskrisen (vgl. Kapitel 4.1) oder familienbezogene Krisen (vgl. Kapitel 4.2), hingegen fokussieren weniger externe Ursachen als vielmehr Übergänge, die für das menschliche Leben typisch und unausweichlich sind. Aufgrund der Neuartigkeit in der hiermit verbundenen Lebenssituation, der zu lösenden Entwicklungsaufgaben und der noch fehlenden Erfahrung mit dem Umgang hiermit werden sie jedoch oft auch als sehr krisenhaft erlebt.
Akute Traumen
Akute Traumatisierungen stellen eine besonders gefährliche Form einer akuten Krise dar, die nicht selten auch in lebensbedrohliche Notfälle übergehen können. Dies gilt für Traumen im Rahmen einer Kindesmisshandlung oder eines sexuellen Missbrauchs (vgl. Kapitel 6.1 und 6.2) ebenso wie für Traumatisierungen bei häuslicher Gewalt (Kapitel 6.3) oder bei Flucht, Bürgerkrieg und Folter (Kapitel 7.2). Aber nicht nur in der akuten Traumatisierungsphase sind spezifische Kriseninterventionen (vor allem das Schaffen von Sicherheit, das Eingehen auf einen Schock, das Anbieten von Erholungsmöglichkeiten usw.) notwendig.
Posttraumatische Belastungsstörungen
Auch posttraumatische Belastungsstörungen, wie sie in Kapitel 1.3 thematisiert werden, erfordern spezifische Krisenhilfen und pädagogische wie sozialarbeiterische Interventionen, mitunter auch psychotherapeutische Behandlung. Hiermit befassen sich Kapitel 6.4 (Traumapädagogik) und in einem gewissen Maße Kapitel 3.1 (Selbstverletzendes Verhalten).
Psychiatrische Notfälle
Psychiatrische Notfälle unterscheiden sich nach Stein nicht nur hinsichtlich der Tiefe der Krise, der möglichen Lebensgefahr sowie möglicher Zusammenhänge zu psychischen Erkrankungen, sondern vor allem auch durch die Form der Intervention, die aufgrund des Notfallcharakters anders aussieht als in herkömmlicher Krisensituation. Mit psychiatrischen Notfällen befasst sich das vorliegende Buch vor allem in Kapitel 5.2, in dem auf Krisen und Notfälle bei Psychosen eingegangen wird, sowie in Kapitel 3.2, das auf suizidale Krisen und akute Suizidgefährdung eingeht.
Burnout
Burnout oder, wenn man so will, ein krisenbedingter Erschöpfungszustand, wird in diesem Buch hingegen weniger als Krise von Klienten, denen es zu helfen geht, behandelt. Vielmehr geht es hier um die eigene Burnout-Gefährdung des Krisenhelfers / der Krisenhelferin, der durch entsprechende prophylaktische Maßnahmen Rechnung zu tragen ist (vgl. Kapitel 2.4).
Der Vorteil solcher Krisenmodelle und Einteilungen ist sicher, dass sie gezieltere und differenziertere Kriseninterventionen ermöglichen. Andererseits gibt es fließende Übergänge, und „idealtypische“ Krisenverläufe sind im wirklichen Leben selten. Von daher sind ein gewisser Pragmatismus und eine individuelle Sichtweise auf das ganz konkrete Krisengeschehen sicher hilfreich. Zudem sind letztlich alle als Krisen erlebte Ereignisse durch extreme Angst, Unsicherheit und Ohnmachtsgefühle des Betroffenen gekennzeichnet, so dass sich in diesen Momenten sozusagen ein „kleinster gemeinsamer Nenner“ findet.
1.1.5 Entstehungsfaktoren
Bewusst wird hier auf das Wort „Ursachen“ der Krisen verzichtet – zu vielgestaltig sind die unterschiedlichen und darüber hinaus miteinander interagierenden Faktoren, die zur Entstehung und zum Verlauf einer Krise beitragen können.
Belastungen
Situationen, die so belastend sind, dass sie Ausgangspunkt einer Krise werden können, wurden in den eben vorgestellten Krisenmodellen bereits benannt: Lebensverändernde Ereignisse (life-events), Lebensübergänge und Umbrüche, Verluste oder Traumen sind hier u. a. zu nennen. Aber wie in Kapitel 1.2 (Stress und Stressbewältigung) noch näher zu erläutern sein wird, ist nicht nur das Geschehen oder die Belastung an sich, sondern auch die Interpretation durch den Betroffenen von Bedeutung. Ob ein Ereignis als bedeutsam und belastend angesehen wird, spielt ebenso wie Vorerfahrungen mit ähnlichen Belastungen und Krisen (oder aber erfolgreich gemeisterten Problemen ähnlicher Art) eine bedeutende Rolle für das Erleben der aktuellen Krisensituation.
Soziale Unterstützung
Zudem befinden wir uns stets in einem sozialen Umfeld, das uns einerseits in kritischen Situationen unterstützen, andererseits die Krisensituation verstärken (oder mitverursachen) kann. Hierauf wird insbesondere in Kapitel 4.2 (Familienbezogene Krisen) eingegangen. Meistens werden Familienangehörige, Peers und Freunde als Unterstützung und Ressource in der Krise gesehen, doch können sie auch krisenhaft in das Krisengeschehen verstrickt sein.
Ressourcen und Resilienzfaktoren
Und schließlich sind eigene Ressourcen von Bedeutung. In Kapitel 1.2 (Stress) wird noch gezielt auf Resilienzfaktoren einzugehen sein – Faktoren also, die dem Individuum Schutz vor und Widerstand gegen stresserzeugende und belastende Situationen geben. Das von Antonovsky beschriebene Kohärenzgefühl ermöglicht beispielsweise, ein (belastendes) Ereignis vorherzusehen, zu handhaben und sinnhaft einzuordnen. Andere Faktoren wie Belastbarkeit oder Widerstandskraft (eine hohe innere Überzeugung, Vieles kontrollieren zu können) oder der von Bandura geprägte Begriff der „self-efficacy“, also der Selbstwirksamkeit, werden als weitere Resilienz-Kräfte gesehen.
Coping
Auch Bewältigungsstrategien (Coping-Strategien) gehören hierzu, beispielsweise die Fähigkeit, Probleme detailliert zu analysieren und durch zielgerichtetes Handeln zu lösen (situationsbezogenes Coping), ebenso wie die Fähigkeit, Dinge, die nicht zu ändern sind, mit Gelassenheit zu tragen und mit den dadurch entstehenden Gefühlen umzugehen (emotionsregulierendes Coping).
Aber auch äußere Gegebenheiten, materielle und soziale Ressourcen spielen eine große Rolle, wenn es um die Chance der Krisenüberwindung geht. Es macht schon einen großen Unterschied, ob jemand mit gutem finanziellen Einkommen, einem stabilen sozialen Netz, in einem funktionierenden Gesundheitssystem und mit ausreichender finanzieller Ausstattung den Belastungen einer plötzlichen Krebserkrankung ausgesetzt ist, oder ob er zusätzlich zu der krankheitsbedingten Krise auch noch mit finanziellen, existenziellen Nöten, einem unzureichenden Gesundheitssystem, mangelnder ärztlicher Versorgung u. a. m. zu tun hat.
1.1.6 Krise als Chance
Krise: Gefahr und Chance
Das Wort „Krise“ besteht im Chinesischen aus zwei Zeichen, wobei das „Wey“ Gefahr und das „Ji“ Chance bedeutet. Die möglichen Gefahren (vom Entwicklungsstillstand bis hin zum lebensbedrohlichen Notfall) sind unmittelbar einsichtig – auf sie wurde bereits ausführlich Bezug genommen. Es gilt aber auch, einen Blick auf die einer Krise möglicherweise innewohnenden Chancen zu werfen. Ein Wendepunkt im Leben kann auch bedeuten, dass die Dinge sich zum Besseren wenden. Eine als krisenhaft empfundene Trennung von einem gewalttäti-gen Ehemann kann möglicherweise neue Lebenskräfte freisetzen und Lebenserfahrung ermöglichen. Die Erfahrung, eine kritische Situation, eine schwere Krankheit oder eine besondere Herausforderung überstanden bzw. gemeistert zu haben, verweist auf innere Stärken und führt zu Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Der Eintritt in eine neue Lebensphase – so kritisch diese möglicherweise erlebt wird – bedeutet in der Regel, auf einem neuen, höheren oder zumindest anderen Niveau zu sein, was oft mit neuen Freiheitsgraden und Handlungsmöglichkeiten einhergeht. Erwachsene können eigenständiger, selbständiger, verantwortungsvoller leben und agieren als beispielsweise Kinder. So liegt „jedem Abschied stets ein neuer Anfang inne“ (so formuliert es Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“), und in jeder Krise liegt auch der Keim für eine weiterführende Entwicklung. So geht es beispielsweise nach einer Krisenbehandlung zum einen darum, zu untersuchen, was sich in der aktuellen, neuen Situation geändert hat – auch zum Positiven. Zum anderen geht es aber auch darum, dem Betroffenen zu verdeutlichen, welchen Anteil er selbst an der Lösung der krisenhaften Situation gehabt hat, und welche neuen Ansätze und Coping-Strategien ihm nun zur Verfügung stehen, und schließlich geht es darum, sich Gedanken darum zu machen, wie man in zukünftigen, möglicherweise ähnlichen Krisen vorgeht.
Psychose
Dies ist beispielsweise bei psychosebelasteten Menschen ein besonders wichtiger Punkt: Sie müssen leider damit rechnen, von Zeit zu Zeit einen psychotischen Schub zu erleiden, der im Erleben des Betroffenen und in seiner konkreten Auswirkung oft sehr krisenhaft verläuft. Es ist wichtig, sich beizeiten auf künftige Krisen vorzubereiten und beispielsweise festzulegen, welche Hilfen man von Angehörigen, Ärzten und Psychotherapeuten in einer Zeit braucht, in der man diese Bedürfnisse psychosebedingt nicht mehr klar äußern kann.
Erweiterung von Kompetenzen
Selbst unter so schwierigen Bedingungen wie den wiederkehrenden kritischen Situationen im Rahmen einer Psychose kann es also zur Erweiterung von Kompetenzen und Coping-Strategien, die sich in einem solchen Antizipieren zukünftiger Krisen äußern, kommen, womit sich den Betroffenen mehr Handlungsspielräume eröffnen. Analoges ließe sich für den Umgang mit Rückfällen bei Alkoholkrankheit, Flashbacks bei posttraumatischer Belastung und vielen anderen Gegebenheiten zeigen.
1.1.7 Ausblick
Schnelles, zielgerichtetes Handeln
In vielen Arbeitsfeldern und Aufgabenbereichen von sozialer Arbeit, Pädagogik und Psychologie kann es – gelegentlich – zu Notfällen oder akuten Krisen sehr unterschiedlicher Art kommen: Entwicklungskrisen, wie z. B. akuten Pubertätskrisen, Verlustkrisen, wie beispielsweise in Scheidungssituationen oder bei schwerer Erkrankung, akuten oder chronischen Traumatisierungen (z. B. nach Flucht, Kindesmisshandlung oder sexuellem Missbrauch), akuten lebensgefährlichen Situationen, wie beispielsweise Suizidalität usw., die mitunter schnelles und zielgerichtetes Entscheiden und Handeln erfordern. Dabei gilt es, weiterführende, meist interdisziplinäre Hilfe nicht aus den Augen zu verlieren – was im Falle einer unmittelbaren bedrohlichen Gefährdung des Kindeswohls oder akuter Suizidgefährdung eines depressiven Menschen nach schweren Verlusterlebnissen unmittelbar einsichtig ist.
Thematik und Aufbau des Buches
Hier möchte das vorliegende Buch ansetzen. Es thematisiert die – m. E. häufigsten und wichtigsten – Krisen- und Notfallsituationen, mit denen Sozialarbeiterinnen, Pädagogen und Psychologinnen im Laufe ihres Berufslebens mutmaßlich konfrontiert werden, wie z. B. traumatische Belastungen, Suizidalität, Gewaltsituationen in Familie und Schule, drogenbezogene Krisen (Vergiftung, Entzug, Rückfall) u. a. m. Jedes dieser Themen wird systematisch wie folgt behandelt:
Zunächst wird kurz auf den Kontext und den Bezug zur Sozialarbeit, Pädagogik und Psychologie bzw. Psychotherapie eingegangen: Wann und wo hat man mit dieser Form von Krisen zu tun?
Allgemeine Grundlagen (beispielsweise über Alkoholkrankheit oder Suizidalität) sollen das Verstehen der Situation ermöglichen, werden aber relativ kurzgehalten. Gezielter und ausführlicher wird sodann auf spezifische Notfall- und Krisensituationen eingegangen, im Fall von drogenbezogenen Krisen beispielsweise auf Vergiftung, Entzugskrisen, Rückfallsituationen oder Erregungszustände.
Ein Kernstück der Ausführungen ist jeweils ein Überblick über Notfallmaßnahmen und Kriseninterventionen in diesen spezifischen Situationen. Dieser Teil ist sehr pragmatisch gehalten und reicht vom Abschätzen der akuten Gefährdung (drohender Atemstillstand) über schutzgebende Kontaktaufnahme, Erfassen des Kontextes und der Problematik bis zur Setzung von Prioritäten und einem Krisenplan zur Lösung der – aus Klientensicht – dringendsten Probleme.
Dieser Teil soll Sozialarbeiterinnen, Pädagogen und Psychologinnen helfen, sich eine schnelle Übersicht zu verschaffen, Prioritäten zu setzen und begründbare Entscheidungen, auch unter Zeitdruck, zu fällen. Danach werden weiterführende, nachhaltigere Maßnahmen pädagogischer, sozialer und psychotherapeutischer Art in Folgeabschnitten kurz skizziert.
Belastung, Stress, Krise und Traumatisierung
Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte dient der schnellen Orientierung und beendet das jeweilige Kapitel.
Um die Zusammenhänge zwischen Belastung, Stress, Krisensitu-ation und Traumatisierung zu verstehen, scheint es mir sinnvoll, sich zum einen mit den biologisch-physiologischen sowie den psychologisch-sozialen Aspekten des Stressgeschehens und der Stressreaktion zu befassen, zum anderen die biologischen sowie psychodynamischen Grundlagen der Traumatisierung und der Entstehung der posttraumatischen Belastungsstörung zu fokussieren. Dies geschieht in den beiden folgenden Kapiteln.
Auf einen Blick
■ Krisen entstehen in der Konfrontation mit neuen Herausforderungen, die als überfordernd erlebt werden, und gehen häufig mit Ohnmachtsgefühlen, Hilflosigkeit und Verlust der Selbstwirksamkeitserwartung einher.
■ In einer Notfallsituation hat sich die Situation so zugespitzt, dass die Gefahr einer schweren seelischen oder körperlichen, möglicherweise irreversiblen oder lebensbedrohlichen Gefährdung besteht.
■ Man kann Verlustkrisen, Krisen bei lebensverändernden Ereignissen, Entwicklungskrisen, Krisen bei Traumatisierungen, narzisstische Krisen und psychiatrische Notfälle unterscheiden
■ Krisen beinhalten sowohl die Gefahr des Scheiterns oder des Entwicklungsstillstandes als auch die Chance, ein neues Entwicklungsniveau zu erreichen, Kompetenzen zu erweitern und neue Handlungsspielräume zu erlangen.
■ Neben der Krisenintervention gehört auch die Begleitung der Klienten an den Schnittstellen von Krise und Notfallsituation zu den Aufgaben in den Arbeitsfeldern der Pädagogik, sozialen Arbeit und Psychologie.
Multiple-Choice-Fragen zu diesem Kapitel finden Sie unter testfragen. reinhardt-verlag.de
1.2 Belastung, Stress und Stressbewältigung: Biologische, psychische und soziale Aspekte
Sympathikus-Nebennierenmark-Achse
Unter Stress verstehen wir im weitesten Sinne ein Ereignis, in dem durch spezifische äußere oder innere Reize (Stressoren) die Anpassungsfähigkeit eines Individuums beansprucht (oder überbeansprucht) wird und das mit psychischen und physischen Reaktionen dieses Individuums einhergeht, die es zur Bewältigung dieser besonderen Anforderungen befähigen. Die auslösenden Ereignisse werden als Stressoren, die sich hieraus ergebenden Reaktionen des Körpers als „Stress“ bezeichnet.
Eustress und Dysstress
Stress ist durch das Leben an sich bedingt ein notwendiger Anpassungsmechanismus an außergewöhnliche Leistungen. Handelt es sich um eine Reaktion auf Stressoren, die den Organismus zwar beanspruchen, aber nicht zu einer Überforderung führen, so wird dies als Eustress bezeichnet. Dieser wirkt sich positiv aus, da er die Aufmerksamkeit erhöht und die maximale Leistungsfähigkeit des Individuums gewährleistet. Unter Dysstress hingegen versteht man einen als negativ empfundenen Stress, der häufig oder dauerhaft auftritt und psychisch wie körperlich nicht kompensiert werden kann, wodurch er als bedrohlich bzw. überfordernd erlebt wird und bei längerer Andauer zu chronischen Anspannungen des Körpers und auf die Dauer zur Abnahme der Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit, schließlich auch zu Fehlfunktionen, Krankheit oder Tod führen kann.
Zwei Stressreaktionen
Es gibt zwei unterschiedliche Wege des Organismus, auf ein stressendes Ereignis zu reagieren. Zunächst wird ein von einem Stressor ausgehender Reiz von Sinneszellen aufgenommen und an den Thalamus im limbischen System weitergeleitet. Hier entsteht ein noch ungenaues, vorbewusstes, wenngleich sehr wirkmächtiges Bild der Situation. Einerseits wird die Information an die Großhirnrinde weitergeleitet, die mithilfe von Erinnerungen ähnlicher Situationen ein konkretes Bild generiert, wobei die Situation differenzierter beurteilt werden kann. Dieses Prozedere dauert allerdings länger als der direkte Weg vom Thalamus zur Amygdala, bei dem neben einer emotionalen Reaktion auf die Situation vor allen Dingen die eigentliche körperliche Stressreaktion ausgelöst wird.
Der Botenstoff Noradrenalin setzt die Stressreaktion über die Sympathikus-Nebennierenmark-Achse fort, indem er den unbewusst arbeitenden Nervus sympathicus des vegetativen Nervensystems aktiviert. Diese sympathikotone Reaktion des vegetativen Nervensystems bereitet die Fight-and-Flight-Reaktion des Körpers vor.
Abb. 1.2.1: Die Stressreaktion (Hülshoff 2012, 268)
Flight-or-Fight-Reaktion
Wie in Abbildung 1.2.1 zu sehen ist, wird über diese Reaktionsschiene zum einen das Nebennierenmark veranlasst, Adrenalin auszuschütten, ein zweites Stresshormon aus der Gruppe der Catecholamine. Zum anderen beeinflussen Noradrenalin und Adrenalin synchron eine ganze Reihe von Organen so, dass Kampf oder Flucht ermöglicht werden. Beispielsweise wird der Kreislauf aktiviert (Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck), die Atemfrequenz wird erhöht, Muskeln werden vermehrt mit Energie versorgt, um kräftiger, koordinierter und schneller reagieren zu können, das Gehirn erhält mehr Sauerstoff und Zucker, um passende Lösungsstrategien zu finden, die Pupillen erweitern sich, was einer gezielten Gefahrenerkenntnis förderlich ist, die Blutgerinnungsfähigkeit steigt, um im Verletzungsfall nicht zu viel Blut zu verlieren, die Schmerzempfindlichkeit sinkt (was u. a. durch eine vermehrte Ausschüttung von körpereigenen Opiaten, sog. Endorphinen, bewerkstelligt wird), Fett- und Zuckerreserven aus Leber und Fetteinlagerungen werden abgebaut und als Energielieferanten benutzt, und der entstehenden Körperwärme mit entsprechender Überhitzungsgefahr wird durch eine vermehrte Schweißproduktion (Verdunstung) begegnet. All dies führt dazu, dass der Körper für die Flight-or-Fight-Reaktion gerüstet ist. Gelingt die Bewältigung des drohenden Ereignisses, so wird die Glutamatproduktion gestoppt, was zu einem Abbau von Noradrenalin und Adrenalin, einer Senkung der sympathischen Aktivität und einem Sistieren der Stressreaktion führt.
Nebennierenrinden-Kortisol-Achse
Gelingt die Anpassung nicht, so wird diese Aktivierung beibehalten (Dauerstress), es werden also vermehrt und verlängert Noradrenalin und Adrenalin ausgeschüttet, und zudem setzt das Glutamat eine erweiterte Stressreaktion über die zweite Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Kortisol-Achse) in Gang, auf die die rechte Seite der Abbildung 1.2.1 hinweist. Dabei produziert die Nebennierenrinde verstärkt Kortisol. Dieses dritte Stresshormon ist wesentlich daran beteiligt, Glukose aus Fettspeichern zu mobilisieren und dem Körper Energien für die Stressreaktion zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass – wenigstens im Moment – zweitrangige Körperfunktionen reduziert werden. Dies gilt vor allem für das Immun- bzw. Abwehrsystem: Kortison hat eine das Immunsystem schwächende Wirkung. Mit anderen Worten: Ein akutes, stressendes Ereignis kann durch die von den Catecholaminen Adrenalin und Noradrenalin vermittelte Reaktion der ersten Stressachse im Sinne der Fight-and-Flight-Reaktion adäquat und schnell gelöst werden, so dass der hier aufgetretene Stress als „Herausforderung“ erlebt und schnell überwunden wird.
In einer verlängerten Stressreaktion – beispielsweise aufgrund anhaltender gefährdender Situationen – kommt die zweite Achse (Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde-Kortisol) zum Tragen, weil hier über längere Zeit ein erhöhter Stressbewältigungslevel aufrechterhalten werden muss. Dies wird in der Regel nicht als Herausforderung (challenge), sondern als ernstzunehmende und bedrohliche Krise (crisis) erlebt. Dennoch handelt es sich in beiden Szenarien um Stress, für den unser Körper prinzipiell angelegt ist. Erst in einer dritten Phase, bei der der gefahrenbedingte Stress als entweder grundsätzlich nicht zu lösen oder auf Dauer nicht zu beenden erlebt wird, kommt es zum Kontrollverlust (loss) und im Gefolge zu Panik und Trauma bzw. Erschöpfung. Mit anderen Worten: Chronischer Dysstress kann krank machen.
Stress und Krankheit
Beim Stressgeschehen kommt es nicht nur zu einer physischen Belastung, sondern auch zu einer starken psychischen Anspannung, auf die weiter unten noch näher eingegangen wird. Diese emotionalen Erregungszustände, hervorgerufen durch unterschiedliche Auslöser, verursachen die relativ einheitlichen somatischen Stressreaktionen. Als Stress assoziierte Emotionen werden oft Angst, Wut, Aggression sowie Trauer und Niedergeschlagenheit genannt. Ein zu starker, pausenloser Stress, der nicht adäquat abgearbeitet werden kann, führt anders als Eustress zu einem körperlichen Erschöpfungssyndrom, oft einhergehend mit einem psychischen Erleben einer Depression. Insgesamt werden wir nun krankheitsanfälliger und sind unter Umständen ernsthaft gesundheitsgefährdet. Dabei ist Stress nie alleiniger pathogener Faktor, kann aber einen ausschlaggebenden Beitrag leisten.
Abb. 1.2.2: Das Stress-Vulnerabilitätsmodell, dargestellt am Beispiel der Depression (Hülshoff 2011, 313)
Vulnerabilitäts-Stress-Hypothese
Die sog. Vulnerabilitäts-Stress-Hypothese, die sich einem bio-psychosozialen Krankheitsmodell verpflichtet fühlt, geht beispielsweise davon aus, dass eine Reihe von körperlichen, aber auch psychischen Erkrankungen auf ein interaktionales Geschehen von frühen Verletzungen und damit einhergehender Verletzbarkeit / Vulnerabilität und hinzukommenden Stressoren zurückzuführen ist.
Darüber hinaus gibt es offensichtlich Zusammenhänge zwischen Hormonen, Neurotransmittern, Nervenaktionen und psychischem Erleben, die sich im Stressgeschehen unheilvoll ergänzen und verdichten können.
So gibt es enge Wechselwirkungen zwischen psychischen Phänomenen (also Gefühlen, Vorstellungen und kognitiven Prozessen, die in unserem Gehirn repräsentiert werden), neurologischen Phänomenen, die sich als Aktivität unseres Nervensystems beschreiben lassen, endokrinen Prozessen, die durch Hormonausschüttungen charakterisiert sind, und immunologischen Prozessen, die maßgeblich von den Zellen unseres Abwehrsystems abhängen und dafür sorgen, dass wir uns vor pathogenen Keimen schützen können. Nach neueren Erkenntnissen gibt es zwischen diesen Systemen zahlreiche Verbindungen und Zusammenhänge. Nicht nur das Gehirn lernt, sondern auch das Immunsystem, und über die Kopplung von Transmittern und Hormonen sind beide Systeme miteinander verbunden. So sind z. B. Hormone, auch Stresshormone, wichtige Bindeglieder zwischen psychischem Erleben, neuronalen Aktivitäten und Organfunktionen. Dazu gehören die Catecholamine Adrenalin und Noradrenalin sowie Kortisol und die Opiate Endorphin und Enkephalin (die zur Schmerzabwehr im Stressgeschehen beitragen), die sich alle stark auf das Immunsystem auswirken. Noradrenalin tritt im Gehirn als Neurotransmitter, in der Peripherie als Hormon auf.
Erschöpfung und Depression
Kortisol wirkt nicht nur suppressiv auf das Immunsystem, sondern ändert auch das psychische Erleben (in Richtung Depressivität). Auch die Funktion, ja sogar die Feinstruktur bestimmter Hirnareale kann sich unter langjährigem Einfluss von Hormonen und Neurotransmittern verändern.
Die hier nur angedeuteten Zusammenhänge lassen erahnen, warum beispielsweise eine Erschöpfungsdepression immer ein psychisches und somatisches Geschehen ist, das sich nicht nur in Niedergeschlagenheit, Avitalität, Lustlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und anderen psychischen Erscheinungen äußert, sondern ebenso sehr auch in körperlichen Funktionsstörungen, beispielsweise Schlafstörungen, Erschöpfung, Abwehrschwäche, erhöhter Krankheitsanfälligkeit u. v. m. Wie sehr stressende Lebensereignisse die Gesundheit beeinflussen können, zeigt auch eine Untersuchung des Psychiaters Holmes aus den 1960er-Jahren, dem aufgefallen war, dass dem Ausbruch verschiedener Erkrankungen sehr häufig eine Summierung einschneidender Veränderungen in Lebenssituation der Betroffenen vorausgegangen war, z. B. ein Wechsel des Arbeitsplatzes, Änderungen der Familiensituation (Scheidung etc., Holmes / Rahe 1967). Hieraus wurde die Hypothese abgeleitet, dass die krankheitsfördernde Belastung abhängig sei von vorausgegangenen einschneidenden Lebensereignissen, die man als „life-events“ bezeichnete, und die subjektiv als stressauslösend und sehr krisenhaft erlebt wurden. Bei der Erfassung (durch Fragebögen) solcher Belastungen und ihrer Bedeutung für die Stressreaktionen schienen die Trennung von Ehepartnern besonders stressauslösend zu sein, doch wurden zahlreiche andere stressende Lebensereignisse beschrieben (Holmes / Rahe 1967). An Stressoren im Zusammenhang mit Herzkrankheiten sind beispielsweise in erster Linie Lebensunzufriedenheit, insbesondere Unzufriedenheit im Beruf, gefolgt von Situationen der Verlassenheit, dem Verlust enger Bezugspersonen sowie berufliche Unsicherheit zu nennen. Allerdings stellte sich heraus, dass nicht nur die Belastung an sich, sondern vor allem die Tatsache, ob und wie Menschen diese Belastungen bewältigen konnten, ausschlaggebend dafür war, ob und in welcher Weise sich Krankheiten einstellten.
Stress und psychische Erkrankung
Im Hinblick auf Krisensituation und Krisenbewältigung ist vor allem auf affektive Störungen bzw. Erkrankungen hinzuweisen. So geht chronischer Stress oft mit erhöhtem Angstpegel einher, wobei unter Angst ein Grundgefühl zu verstehen ist, das sich als in besonders bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und Unlust betonte Erregung äußert. Dabei kann es zu Angststörungen im Sinne einer krankhaft übersteigerten Angst, zu zunehmenden sozialen Ängsten bis hin zur Isolation und Vermeidung sozialer Kontakte und zu Leistungsängsten bis hin zu Leistungsversagen kommen. Zum anderen ist an alle Formen einer chronischen oder akut auftretenden Depression zu denken, insbesondere an eine Erschöpfungsdepression, aber auch an verschiedene Formen eines Burnout-Syndroms. Hierauf wird in Kapitel 2.4 (Burnout) vertiefend eingegangen.
Erlernte Hilflosigkeit (Seligman)
Vor allem das Konzept der „erlernten Hilflosigkeit“ des Psychologen Martin E. P. Seligman (1979) ist hier zu nennen. Bei erlernter Hilflosigkeit erwartet ein Individuum, bestimmte Situationen oder Sachverhalte nicht kontrollieren oder beeinflussen zu können – was insbesondere nach chronischem Dysstress die Folge ist. Das Individuum engt sein Verhaltensrepertoire ein, und eine solche Selbstbeschränkung bzw. Passivität führt in einem Circulus Vitiosus zu erneuten Erfahrungen von Hilf- und Machtlosigkeit sowie subjektivem Kontrollverlust.
Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um potenzielle Zusammenhänge zwischen chronischem, überfordernden Dysstress, zunehmender Unfähigkeit, Krisen zu lösen, und erhöhter Krankheitsbereitschaft zu erläutern.
Transaktionales Stressmodell nach Lazarus
Die gesamte Diskussion zur Stressentstehung und -verarbeitung sollte im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts bis heute im Wesentlichen durch den Psychologen Richard Lazarus geprägt werden, der 1974 das von ihm entwickelte transaktionale Stressmodell vorstellte. Er war der erste, der eindeutig postulierte, dass nicht nur die objektive Beschaffenheit einer stressauslösenden Situation für eine Stressreaktion von Bedeutung ist, sondern vor allem auch deren subjektive Bewertung durch den Betroffenen. Dabei unterschied er mehrere Stufen der Bewertung. Bei der primären Bewertung (primary appraisal) können Situationen als positiv, unbedeutend / irrelevant oder potenziell gefährlich und damit stressend bewertet werden, wobei die Bewertung drei Stufen erkennen lässt: Eine Herausforderung (challenge) liegt in Situationen vor, die als bewältigbar erscheinen, bei einem zu erwartenden Schaden spricht man von Bedrohung (threat) und von einer Schädigung / Verlust (harm / loss) spricht man, wenn der Schaden bereits eingetreten ist (Lazarus 1974). Mit anderen Worten: Wie sehr etwas belastet, hängt davon ab, wie einschneidend und wie wichtig die Belastung für das weitere Leben des Betroffenen ist. Außerdem wird subjektiv bewertet, welche Bewältigungsmöglichkeiten den Menschen zur Verfügung stehen. Als stressend wird ein Ereignis erst dann erlebt, wenn der Betroffene keine adäquate Möglichkeit mehr sieht, mit der Belastung fertig zu werden. In einer sekundären Bewertung (secundary appraisal) wird also überprüft, ob die Situation mit den verfügbaren Ressourcen zu bewältigen ist (Lazarus / Folkmann 1984).
Der Umgang mit einer Bedrohung und der Versuch, selbige zu bewältigen, werden als Coping bezeichnet. Hierbei unterscheidet man problemorientiertes, emotionsorientiertes sowie bewertungsorientiertes Coping.
Problemorientiertes Coping
Problemorientiertes Coping liegt vor, wenn ein Mensch in einer extremen Belastung das Problem direkt angeht. In diesem Fall wird er versuchen, die belastenden Faktoren auszuschalten, sie zu umgehen oder durch persönliche gezielte Problemlösungen die Ursache des Stresses zu bewältigen. Dabei kann die Situation sowohl allein durch persönliche als auch durch kollektive Bewältigungsmöglichkeiten (soziale Unterstützung, soziales Netzwerk, soziale Integration) gemeistert werden.
Emotionsregulierendes Coping
Eine andere Form der Stressbewältigung wird als „emotionsregulierendes Coping“ bezeichnet, das sich vorwiegend darauf beschränkt, mit der emotionalen Erregung fertig zu werden, die eine Stress-Situation ausgelöst hat. Wenn – vereinfacht gesagt – die Stress-Situation nicht zu ändern ist, kann zumindest versucht werden, mit den sie begleitenden Gefühlen wie Ärger, Wut oder Trauer besser umzugehen und sie zu verarbeiten. Auch Entspannungsübungen und andere Methoden (s. u.) dienen zumindest zum Teil diesem Zweck.
Bewertungsorientiertes Coping
Schließlich spricht man vom bewertungsorientierten Coping, wennes zu einer Neubewertung („reappraisal“ nach Lazarus) der Situation kommt. Wenn beispielsweise eine gestresste Person ihr Verhältnis zur Umwelt neu bewertet – eventuell auch nach schon erfolgten Veränderungen –, kann eine zuvor als aussichtslos gesehene Krise nun möglicherweise als eine eher belastende Herausforderung, also positiver gesehen und gewertet werden, was seinerseits neue Ressourcen freisetzt.
Die Arbeiten von Lazarus haben die Stressforschung grundlegend verändert, neu interpretiert und bis heute geprägt. Von nun an ging es nicht mehr primär um die Analyse physiologischer und biochemischer Vorgänge, sondern vor allem um die Untersuchung psychologischer sowie psychosozialer Parameter. So ging es beispielsweise bei dem Konzept der Selbstaufmerksamkeit darum, die Aufmerksamkeit auf sich selbst, das Selbstkonzept oder das Selbstwertgefühl zu lenken. Private Selbstaufmerksamkeit meint die Erfahrung des eigenen Zustandes, den niemand anders letztlich beurteilen kann (Körperempfindung, Stimmungen, Einstellungen, Phantasien etc.). Aber auch die öffentliche Selbstaufmerksamkeit, also die beobachtbare äußere Erscheinung oder das Verhalten, Umgangsformen etc. können von Bedeutung sein. Zwischen Selbstaufmerksamkeit und sozialer Angst sowie Stresserleben bestehen große Zusammenhänge, und eine realitätsnahe Selbsteinschätzung kann durchaus zum Stressabbau beitragen.
Attributionstheorien
Dies führt uns zu Attributionstheorien, also allgemeine Ansätze der Psychologie, die beschreiben, wie Individuen Informationen nutzen, um kausale Erklärungen für menschliche Verhaltensweisen vorzunehmen. Mit dem Konzept Seligmans zur erlernten Hilflosigkeit haben wir bereits eine solche Attributionstheorie kennen gelernt und gesehen, wie ein Circulus Vitiosus im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung ein gestresstes Individuum noch hilfloser und im Gefolge noch gestresster werden lässt.
Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura)
In den 1970er-Jahren entwickelte der kanadische Psychologe Albert Bandura, ein Pionier der kognitiven Lerntheorie, das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung, also einer Erwartung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können – fast spiegelbildlich das Gegenteil der erlernten Hilflosigkeit. Bandura (1977) stellte fest, dass Personen mit starkem Glauben an die eigene Kompetenz größere Ausdauer bei der Bewältigung von Aufgaben haben und außerdem eine niedrigere Anfälligkeit für Angststörungen und Depressionen zeigen.
Auch hier wirken sich Selbstwirksamkeitserwartungen und Handlungsergebnisse zirkulär aus, allerdings im Sinne eines „high performance cycle“, also einer positiven Rückkopplung. Er benannte vier Quellen von Selbstwirksamkeitserwartung, nämlich eigene Erfolgserlebnisse, stellvertretende Erfahrungen, verbale Ermutigungen sowie emotionale Erregung. Dabei handelt es sich bei der emotionalen Erregung um positive Erregung im Sinne von Belohnungs- und Flow-Erlebnissen, die nicht selten durch Dopaminausschüttung getriggert werden. Bei der „stellvertretenden Erfahrung“ (vicarious experience) traut man sich selbst mehr zu, wenn man andere Menschen bei der Meisterung von Problemen beobachtet hat: Man wird also durch Vorbilder beeinflusst. Die Kompetenzerwartung beeinflusst und verändert das Verhalten: Eine hohe Selbstwirksamkeit beflügelt die Inangriffnahme schwieriger Aufgaben, man investiert mehr Anstrengung, erträgt mehr Schmerzen und bewältigt schlussendlich besser anstehende, durch Stress gekennzeichnete Aufgaben.
Salutogenese (Antonovsky)
Bisher haben wir uns damit beschäftigt, dass dysfunktionaler Stress zu Krankheiten führen kann. Insbesondere im Vulnerabilitäts-Stress-Konzept kommt zum Ausdruck, dass ungünstige biographische Faktoren wie beispielsweise Traumen zu einer erhöhten Verletzlichkeit führen, die bei zusätzlicher massiver Stressexposition in eine akute Krankheit umschlagen kann. Dieses Modell fußt, wie bereits erwähnt, auf einem biopsychosozialen Krankheitsverstehen. Der Paradigmenwechsel vom rein naturwissenschaftlichen zum biopsychosozialen Krankheitsmodell führte seit den 1980er-Jahren aber auch zu dem Modell der „Salutogenese“, das 1979 vom Medizinsoziologen Aaron Antonovsky eingeführt wurde. Nach dem Salutogenese-Modell ist Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen. Gleichzeitig geht es um die Stärkung von gesundheitserhaltenden Faktoren. Antonovsky, der sich intensiv mit Lebensläufen und Gesundheit und Krankheit von Überlebenden des Holocaust befasst hatte, fragte sich, warum gleiche Stressoren bei einer Person zu chronischer Belastung oder Krankheit führen, bei anderen hingegen nur zu einer kurzen Krise oder sogar zu einer späteren Verbesserung des Allgemeinzustandes, warum also Menschen trotz großer psychischer oder physischer Belastung gesund bleiben können. Solche zur Salutogenese (lat. salus: Heil, gr. genesis: Entstehung) beitragenden, gesundheitsfördernden Faktoren werden heute als „Resilienzfaktoren“ (Schutzfaktoren) bezeichnet. Sie können u. a. in einer genetisch bedingten, geringeren Vulnerabilität (beispielsweise hinsichtlich Serotoninverschiebung und Depression), Temperamentsunterschieden, Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit, einem positiven Selbstwertgefühl, einer inneren Kontrollüberzeugung oder dem Vertrauen auf Selbsthilfemöglichkeiten bestehen. Auch soziale Faktoren wie Gesprächsmöglichkeiten auf der Meta-Ebene (beispielsweise bei schicksalsbedingten Lebenskrisen) oder familiärer Schutz können sich gesundheitsfördernd auswirken.
Kohärenz
Im Zentrum von Antonovskys (1997) Untersuchungen steht der „Sinn für Kohärenz“ (sense of coherence) bzw. ein „Kohärenzgefühl“. Darunter versteht man ein durchdringendes und andauerndes, gleichzeitig dynamisches Gefühl des Vertrauens darauf, dass
■ Stimuli und Stressoren aus der inneren und äußeren Umgebung strukturiert, voraussehbar und erklärbar sind,
■ Ressourcen zur Verfügung stehen, um diesen Anforderungen zu begegnen,
■ es sich bei diesen Herausforderungen um solche handelt, die Anstrengung und Engagement lohnen.
Nach Antonovsky (1997) speist sich das Kohärenzgefühl aus drei Empfindungen:
1. der Verstehbarkeit der Situation,
2. der Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit der anstehenden Herausforderung und
3. dem Gefühl von Sinnhaftigkeit des Geschehens.
Sowohl in Stress-Situationen als auch bei Krisen unterschiedlichster Formen, nicht nur bei Krankheit, kann die Beachtung dieser Empfindungen sehr hilfreich sein: Wer z. B. bei der Diagnose einer Krebserkrankung versteht, um was es bei Erkrankung und Therapie geht, wer davon überzeugt ist, dass er die nun anstehenden Herausforderungen handhaben und bewältigen kann, und wem es schließlich gelingt, das Krankheitsgeschehen in die eigene Biographie sinnhaft einzubetten, wird wesentlich besser mit der Krisensituation und dem damit verbundenen Stress umgehen können. Psychoedukative Schulungen, Selbsthilfegruppen und Maßnahmen, die weitgehend als „Empowerment“ bezeichnet werden, setzten hier mit unterschiedlichen Methoden an, was in den jeweiligen Kapiteln konkret zu zeigen sein wird.
Stressbewältigung
Zur Stressbewältigung stehen sehr unterschiedliche Ansatzpunkte zur Verfügung. Zum einen können unnötige Stressoren beseitigt, zum anderen die individuelle Stressanfälligkeit vermindert werden. Medizinische und therapeutische Behandlungen stehen ebenso wie Maßnahmen im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung, und neben der humaneren Gestaltung der materiellen und sozialen Lebensbedingungen, beispielsweise am Arbeitsplatz, liegen entscheidende Aspekte zur Stresskontrolle auf der somatischen Ebene in körperlichem Training, ausreichendem Schlaf und gesunder Ernährung, auf der psychischen Ebene in der Veränderung inadäquater Bewertungsmuster im Sinne einer realitätsangemessenen Neuorientierung, und schließlich auf der Verhaltensebene beispielsweise im Abbau von Risikoverhalten und dem Erlernen geeigneter Freizeitverhaltensweisen. Ziel solcher Maßnahmen ist es nicht, den Stress an sich abzuschaffen, da Stress ein konstituierendes Moment der Conditio Humana ist, sondern Dysstress zu reduzieren und zu kontrollieren.
Stressvermeidung
Stress kann auf unterschiedlichen Ebenen bewältigt werden. Zu nennen sind hier u. a. Stressvermeidung, Stressabbau, Coping- bzw. Bewältigungsmechanismen, soziale Unterstützung sowie spezifische Stressinterventionen bzw. therapeutische Ansätze.
Bei der Stressvermeidung gilt es zunächst festzustellen, welche Belastungen als besonders stresserzeugend erlebt werden. Generell sind eine Reihe von Faktoren und Lebensbedingungen der Moderne in besonderem Maße und überdurchschnittlich häufig stresserzeugend, beispielsweise die zunehmend erwartete Flexibilität und Mobilität im Berufsleben, permanente soziale Rollenveränderungen, physikalische Belastungen wie Lärm, Allergen- oder Umweltbelastungen, vor allem aber Arbeitslosigkeit und drohende Arbeitslosigkeit. Die aktive Vermeidung krankmachenden Stresses auch mithilfe professioneller Problemlösungen erfordert letztlich strukturelle Veränderungen. Das Arbeitsschutzgesetz, das Kündigungsschutzgesetz und eine Reihe anderer Maßnahmen auf struktureller und insbesondere gesellschaftspolitischer Ebene sind hier unerlässlich. Nur zum Teil kann auf der persönlichen Ebene hierauf Einfluss genommen werden. Immerhin kann man sich Stressoren bewusst machen, eine Reihe von Störreizen reduzieren (beispielsweise E-Mail-Benachrichtigungen deaktivieren), realistische Tagespläne erstellen, regelmäßige Arbeitspausen einlegen, in denen man auch sportliche oder entspannende Aktivitäten einplant, den Arbeitstag abschließen und die Arbeit nicht „mit nach Hause nehmen“, Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit kategorisieren, den eigenen Anspruch (Perfektionismus) herabsetzen, Aufgaben delegieren, sich ausgewogen ernähren und sich genügend Zeit beim Essen (außerhalb des Arbeitsplatzes) nehmen. All diese – und einige andere – Maßnahmen werden uns in Kapitel 2.4 (Burnout) noch einmal begegnen, wenn es darum geht, auch bei Krisenhelfern übermäßigen Stress und konsekutiven Burnout zu vermeiden.
Stressabbau
Beim Stressabbau ist zunächst darauf hinzuweisen, dass Sport oder kontinuierliche, moderate körperliche Aktivität einen essenziellen Beitrag zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden leisten kann. Eine halbe Stunde Bewegung in angenehmer Umgebung bessert die Laune und das Selbstwertgefühl signifikant und kann Stress lindern. Die eigenen Handlungsmöglichkeiten werden optimistischer wahrgenommen, im Sport können positive Emotionen und soziales Gemeinschaftsgefühl erlebt werden, die Konzentrationsfähigkeit wird verbessert, angestaute Energie abgebaut und das Immunsystem gestärkt. Zudem kann man sich von anderen Problemen distanzieren. Auf der physiologischen Ebene kann die Herz-Kreislauf-Situation verbessert, der Abbau von Catecholaminen sowie Cholesterin gefördert und die Durchblutung von Muskulatur und Organen verbessert werden. Hilft dem einen die Bewegung und (sportliche) Aktivität, bevorzugen andere eher ruhige Entspannungsmethoden, bei denen angestaute Energien frei und muskuläre Spannungen gelöst werden. Einige werden in Kapitel 2.3 (Komplementäre Ansätze in und nach Krisensituationen) vorgestellt.
Coping- und Bewältigungsstrategien
Coping- oder Bewältigungsstrategien können, wie bereits aufgezeigt, in problemlösende sowie emotionsregulierende Coping-Strategien eingeteilt werden. Im ersten Fall versucht man, die Verhältnisse und damit die Stressursachen zu meiden, zu verändern oder zu eliminieren. Im zweiten Fall kann nicht die Situation bzw. können nicht die Stressoren geändert werden, jedoch die emotionale Reaktion darauf.
Eine Veränderung der Einstellung und damit eine Neubewertung stellt eine dritte Form des Copings dar. So kann man sich fragen, wie man selbst eine Situation sieht und wie andere sie sehen, und in einem gezielten Training, evtl. auch in Gruppenübungen, stressreduzierende Neubewertungen und Einstellungen einüben: Aus dem Postulat, alles allein bewältigen zu müssen, kann die Einstellung, um Rat zu bitten und etwas dazuzulernen, werden. Der Wunsch, von allen gemocht zu werden, kann umgewandelt werden in die Erkenntnis, es nicht allen recht machen zu können. Das Verbot, Fehler zu machen, kann zur Erkenntnis werden, dass Fehler menschlich sind. Das Vorurteil, andere seien besser oder intelligenter, kann abgelöst werden von der Erkenntnis, selbst liebenswert und tüchtig zu sein. Und anstatt bei sich oder bei anderen die Schuld für ein Problem zu suchen, kann man sich auf die Lösung des Problems konzentrieren.
Soziale Unterstützung
Dem sozialen Rückhalt und der sozialen Unterstützung kommt eine außerordentlich große Rolle bei der Stressbewältigung und Stressreduktion zu. Dabei kann soziale Unterstützung auf vier Ebenen stattfinden: Zum einen als emotionale Unterstützung (Zuneigung, Vertrauen, Zuspruch), zum anderen durch instrumentelle Unterstützung (konkrete Hilfen wie beispielsweise Hilfe im Haushalt, finanzielle Unterstützung etc.). Drittens können ihre Informationen hilfreich sein, ein Problem zu bewältigen, und zum Vierten sind bewertende Unterstützungen zu nennen, in denen Personen Wertschätzung oder Anerkennung entgegengebracht wird.
Soziale Unterstützung kann auf mehreren Ebenen ansetzen. Im einfachsten Fall kann die soziale Unterstützung einen direkten Effekt auf das Stressgeschehen haben, wenn beispielsweise ein in seiner Arbeit überforderter Mensch konkret entlastet wird. Zum Zweiten kann soziale Unterstützung auch als eine Art Puffer verstanden werden, der in allgemeinerer Hinsicht stressreduzierend wirkt. Die Möglichkeit, mit Freunden gemeinsam zu wandern, zu singen, sich auszusprechen u. a. m. kann also ein Milieu bzw. einen Puffer schaffen, der mich andere Stressoren besser ertragen lässt.
Zum Dritten kann man zwischen lebensbereichsinternen und lebensbereichsfremden Unterstützungsmodi unterscheiden. Lebensbereichsfremde Unterstützung (beispielsweise familiäre Hilfe bei arbeitsbedingtem Stress) wirkt in der Regel weniger stark als lebensbereichsinterne Unterstützung durch Arbeitskollegen.
Neben den bisher genannten Krisen und Stressreaktionen gibt es aber auch schädigende Ereignisse, die als Traumen bezeichnet werden, die so massiv sind, dass sie zu einem sofortigen Zusammenbruch aller körperlichen und seelischen Instanzen führen, die zu einer Lösung beitragen könnten. Hiermit befasst sich das folgende Kapitel.
Auf einen Blick
■ Während Eustress den Organismus zwar beansprucht, aber nicht überfordert, führt Dysstress aufgrund seiner Dauer, seines Ausmaßes sowie mangelnder Kompensationsmöglichkeiten zu emotionalen und körperlichen Überforderungen, Erschöpfung und ggf. zum Zusammenbruch.
■ Die Stadien des Dysstressgeschehens können in eine Alarm-, Anpassungs-(Adaptations-) und Erschöpfungsphase eingeteilt werden.
■ Auf der Sympathikus-Nebennierenmark-Achse der Stressreaktion kommt es unter Einwirkung von Adrenalin zur Flight-and-Fight-Reaktion.
■ Insbesondere bei chronischem Dauerstress kommt es unter Cortisol-Mitwirkung auf der Nebennierenrinden-Cortisol- Achse der Stressreaktion zunächst zur Anpassung an das Belastungsniveau, schließlich zur Erschöpfung.
■ Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell bildet die Grundlage zum Verständnis vieler, insbesondere psychischer und psychosomatischer Erkrankungen.
■ Man kann von problemorientierten, emotionsregulierenden und bewertungsorientierten Bewältigungs-(Coping-)Strategien sprechen.
■ Neben der Qualität und dem Ausmaß des Stressors spielen auch erlebte Bedeutung der Belastung (Herausforderung / challenge, Bedrohung / threat und Schädigung-Verlust / harmloss) sowie Selbstwirksamkeitserwartungen des Individuums eine Rolle bei Stressauswirkung und Stressbewältigung.
■ Selbstwirksamkeit, Resilienzfaktoren und Kohärenzgefühl sind zentrale Begriffe des Konzeptes der Salutogenese.
Multiple-Choice-Fragen zu diesem Kapitel finden Sie unter testfragen. reinhardt-verlag.de
Weiterführende Literatur
Hildenbrand, B., Welter-Enderlin, R. (2012): Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände. 4. Aufl. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg
Hülshoff, Th. (2015): Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik. 3. überarbeitete Aufl. UTB / Reinhardt, München, Basel
Hülshoff, Th. (2008): Das Gehirn. Funktionen und Funktionseinbußen. Eine Einführung für pflegende, soziale, pädagogische und Gesundheitsberufe. 3., völlig überarbeitete und erweiterte Aufl. Verlag Hans Huber, Bern, Göttingen, Toronto, Seattle
Hüther, G. (2011): Biologie der Angst. Wie aus Stress Gefühle werden. 10. Aufl. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
Meichenbaum, D. H. (1991): Intervention bei Anwendung und Wirkung des Stressimpfungstrainings. Huber, Bern
1.3 Trauma und Posttraumatische Belastungsstörung
Posttraumatisches Belastungssyndrom
Man spricht von einem posttraumatischen Belastungssyndrom, wenn es aufgrund eines Stressors zu Phänomenen der Intrusion, des Vermeidungsverhaltens, negativer Veränderungen von Kognition und Emotion sowie einer allgemeinen Übererregung kommt. Dissoziative Symptome können hinzukommen.
Existenzielle Stressoren
Solche existenziellen Stressoren liegen vor, wenn jemand Todesgefahr, Todesdrohung, akuter Bedrohung durch ernsthafte Verletzungen oder sexueller Gewalt ausgesetzt war bzw. unmittelbarer Zeuge solcher Gewalt an anderen Menschen wurde.
Dabei kann man zwischen natürlichen und menschengemachten Stressoren bzw. Katastrophen unterscheiden. Zum Ersteren gehören beispielsweise Erdbeben oder Flutkatastrophen, zu Zweiterem Krieg, Folter, sexueller Missbrauch etc. Zudem kann man einmalige, stressende Katastrophen, von denen viele Menschen betroffen sind, von solchen Stressoren unterscheiden, die gezielt eine einzige Person betreffen. Völkermord, Flucht und Vertreibung usw. sind menschengemachte Katastrophen, von denen aber tausende Menschen betroffen sind. Anders ist dies bei schweren Verkehrsunfällen, bei sexuellem Missbrauch, Kindesmisshandlung oder existenzieller Bedrohung durch individuelle Krankheiten, beispielsweise metastasierendem Krebs.
Hyperarousal
Die drei Kardinalsymptome der posttraumatischen Belastung, die sich über Jahre (mitunter sogar Jahrzehnte) zeigen können, sind die der Intrusion, der Übererregung, der emotionalen und kognitiven Belastung sowie der Vermeidung (Konstriktion). Die Übererregung (Hyperarousal) zeigt sich in allgemeiner Unruhe, Konzentrations- und Leistungsschwäche, plötzlichen und aggressiven Impulsdurchbrüchen sowie Übersprungshandlungen und temporärer Orientierungslosigkeit, all dies ohne einen unmittelbaren und einsichtigen Anlass und in deutlichem zeitlichen Abstand vom stressenden Ereignis. Die Betroffenen erschrecken häufig in unangemessener Weise, haben Schlafstörungen, zeigen sich häufig in für die Umwelt unverständlicher Weise besorgt und hypersensitiv, irritierbar oder von einer gereizten Grundstimmung. Selbst destruktives Verhalten kann hinzukommen.
Intrusion
Zusätzlich zu diesen Zeichen der Übererregung, die häufig die Grundhaltung und das Grundverhalten betroffener Menschen prägen, kommt es von Zeit zu Zeit, oft für die Betroffenen unvorhersehbar, zu Intrusionen, dem Wiedererleben des stressenden Ereignisses / der Katastrophe oder meistens Teilen dieser Katastrophe. Bestimmte Gerüche, Orte, Bilder, Worte oder Berührungen, Verhaltensweisen oder archetypische Bewegungen können an das Trauma erinnern und die gesamte traumatische Situation wieder heraufbeschwören.
Flashback
Diese unfreiwilligen vorübergehenden Erinnerungen können im Rahmen von Albträumen, aber auch in der Phase der Wachheit auftreten und werden als „Flashbacks“ bezeichnet. Sie führen in der Regel zu Panikattacken, Hilflosigkeit, allen Zeichen extremen körperlichen Stresses (wie z. B. erhöhtem Herzschlag und Blutdruck, Angstschweiß, Engegefühl, Hyperventilation und Luftnot etc.). Darüber hinaus zeigen sich manchmal dissoziative Reaktionen (die Betroffenen haben den Eindruck, nicht sie selbst zu sein, fühlen sich wie in einer traumhaften Situation, sind subjektiv ihren Ängsten und dem Stress sowie der aktuellen Situation scheinbar völlig hilflos ausgeliefert und haben keinen oder nur verminderten Zugang zu ihren kognitiven, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten, die sie ansonsten bei der Lösung von Problemen einsetzen könnten).
Konstriktion
Das dritte Kriterium, die Vermeidung oder Konstriktion auslösender Trigger, ist als Versuch des Körpers und der Psyche zu verstehen, diese als extrem belastenden und existenzgefährdenden Situationen möglichst zu vermeiden. Psychische Abwehr, Verleugnung und Verdrängung können ebenso Zeichen eines Konstriktionsverhaltens sein wie Rückzug und Isolation, was zur sozialen Einsamkeit führt. Hinzukommen können zwanghaftes Verhalten (mitunter gepaart mit diffusen oder konkreten Ängsten), was die Lebensqualität und den sozialen Wirkungskreis erheblich einschränken kann, die eben schon beschriebene Dissoziation und vor allem Verhaltensweisen, die mit Betäubung oder Erstarrung einhergehen. Nicht zuletzt sind eine Reihe von Suchterkrankungen bei näherem Hinsehen durchaus auch als Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung zu identifizieren.
Depersonalisation
Und schließlich können kognitive und emotionale Veränderungen Ausdruck eines posttraumatischen Belastungsgeschehens sein. Dies gilt insbesondere für die Depersonalisationen, bei denen die Betroffenen sich als z. T. außerhalb befindliche Beobachter sehen, die abgelöst vom eigentlichen inneren Geschehen sind („Mir passiert das gerade nicht“, „Das ist ein Traum“).
Derealisation
Die Erfahrung der Unwirklichkeit des Geschehens oder einer gewissen Distanz („Das ist alles nicht real“) wird als Derealisation bezeichnet. Schwere Konzentrationsstörungen, scheinbar unkontrollierbare aggressive Durchbrüche, die eben schon beschriebene Isolation oder Depression tun ein Übriges, um die soziale Adaptationsfähigkeit, das adäquate emotionale Mitschwingen oder das Ausschöpfen der intellektuellen Leistungsfähigkeit der Betroffenen zu erschweren und teilweise erheblich (vorübergehend) zu vermindern.
Ursachen
Im Folgenden soll auf mögliche Ursachen dieses dramatischen Geschehens eingegangen werden.
Dabei gilt es, sich zunächst einmal grundsätzlich klarzumachen, dass eine ganz wesentliche Leistung unseres Gehirns darin besteht, auf gefährdende und mitunter lebensbedrohliche Situationen schnell und adäquat zu reagieren. Die synaptische Verschaltung unserer Hirnzellen erfolgt ein Leben lang in Reaktion und Interaktion mit äußeren, umweltbedingten Gegebenheiten, die das Gehirn über die Sinne registriert, interpretiert und – mehr oder weniger erfolgreich – so verarbeitet, dass das Individuum keinen oder möglichst geringen Schaden nimmt. Die so entstehende Verschaltung führt ihrerseits dazu, dass in ähnlichen Krisen- oder Gefahrenmomenten „schon eingefahrene Leitungsbahnen“ bereitstehen und damit Problemlösungsmodi oder Copingverhalten präjudiziert sind. Sie werden erst modifiziert oder umgeändert, wenn sie sich bei weiteren stressenden Ereignissen oder Traumen als unwirksam erweisen. Zunächst bleibt festzuhalten, dass das Gehirn sich im Laufe eines Menschenlebens durch die Interaktion mit Geschehnissen in der Umwelt – insbesondere sozialen Situationen – fortwährend weiter strukturiert, wobei es sich als grundlegend plastisch erweist und uns lebenslanges Lernen und auch Umlernen ermöglicht. Andererseits hinterlassen eindrückliche Erlebnisse – und lebensbedrohliche Traumen gehören zu den eindrücklichsten Erlebnissen, die wir kennen – tiefe neuronale Spuren, was die synaptische Verschaltung und die Reaktion durch Hormone und Neurotransmitter angeht.
An der entwicklungsgeschichtlich jüngsten, hierarchisch gesehen obersten Stelle unseres Gehirns, der Präfrontal- und insbesondere periokulären Kortex, sind wir in der Lage, auf einen extremen Stressor – beispielsweise eine wütende und von drohender Gewalt gekennzeichnete Auseinandersetzung – logisch, argumentativ und bis zu gewissen Grenzen auch deeskalierend zu begegnen. Dies geschieht in der Regel durch Worte, wenngleich Mimik, Gestik, Körperhaltung, Stimmklang und Drohgebärden eine starke emotionale Beteiligung signalisieren.
Stereotypes Verhalten
Ist die Gefahr bedrohlicher, und drohen wir erheblichen Schaden davonzutragen, so reagieren wir – zwar immer noch auf Kortexebene, aber schon „eine Ebene tiefer“ – in der Regel mit Stereotypen, also eingeschliffenen Verhaltensmustern, Vorurteilen, naheliegenden Vorwürfen, Handgreiflichkeiten u. a. m. Emotionales, fast schon reflexhaftes, jedenfalls nicht nur durch kognitive bewusste Entscheidungen geprägtes Verhalten gewinnt langsam die Oberhand.
Fight-and-Flight-Reaktion
Bei einer noch größeren, existenziellen Bedrohung werden Gefühle massiver Angst bis hin zur Panik sowie massiver Wut bis hin zur Aggressionsbereitschaft im limbischen System, insbesondere in der Amygdala, zum Teil durch hippocampale Strukturen generiert. Der Hippocampus wird auch als „die Pforte zum Gedächtnis“ bezeichnet, in dem alte Erfahrungen von Kampf oder Flucht erinnert und reaktiviert werden. Unter Zuhilfenahme aller Ressourcen unseres vegetativen Systems (erhöhter Blutdruck und erhöhter Pulsschlag, die die Blutversorgung fördern, maximal erweiterter Pupille, die noch den letzten Lichtquant analysieren kann, Schweißreaktion, die das Abstrahlen von energiebedingter Hitze ermöglicht, Anspannung der Muskulatur, Aufrichtung der Haarbälge u.v.a. Parameter der akuten Stressreaktion) gehen wir körperlich, aber auch emotional in den Kampfmodus oder den Fluchtmodus (Fight-and-Flight-Reaktion). Je nach Möglichkeit, gilt es also, sich so schnell wie möglich der Gefahr durch Flucht zu entziehen, oder aber durch Kampf die bedrohliche Situation zu überwinden. Ersteres geht mit massiven Angstgefühlen, zweiteres mit den Gefühlen von Wut, Zorn oder Ärger einher.
Freeze
Ist die bedrohliche Situation völlig aussichtslos, da sie weder durch Kampf oder Flucht zu bewältigen ist, kommt es zum Stadium des Freeze, der Erstarrung, die als ein biologisch verankertes, letztes verzweifeltes Bemühen, durch Nicht-Auffallen oder eine Art Totstellreflex noch einmal davonzukommen, evolutionär erklärt werden kann. Hier stellt sich ein Gefühl der völligen Ohnmacht und des Ausgeliefertseins, nicht selten mit maximaler Panik, ein. In einer solchen Situation ist man häufig desorientiert, mitunter verwirrt, man verliert wichtige emotionale und kognitive Ressourcen. Teile des Geschehens werden nicht oder nur unzusammenhängend wahrgenommen, es überwiegen die panikverstärkenden und unmittelbar bedrohlichen Eindrücke. Der Zugang zu Ressourcen und Problemlösungsstrategien ist häufig versperrt. Die Amygdala sorgt für ein maximales Erleben von Panik, während hippocampale Funktionen eingeschränkt sind, so dass wir uns später an Einzelheiten des Traumas gar nicht oder nur sehr partiell und bruchstückhaft erinnern. Die Integration des Geschehens ins Bewusstsein sowie ins Langzeitgedächtnis ist also gestört. Das gilt auch für die Integration des emotionalen Erlebens. Schlussendlich können Teile des Erlebten noch nicht einmal mehr sprachlich erfasst werden, da Wege zu den Sprachzentren in der Großhirnrinde nicht mehr in adäquater Weise zur Verfügung stehen.
In einer letzten Stufe der Verarbeitung werden nur noch die vegetativen Überlebensfunktionen gewährleistet.
In einer Situation, in der letztlich Zwischenhirnstrukturen oder die noch darunter liegenden vegetativen Funktionen die Führung übernehmen und die darüber liegenden, reiferen und komplexeren Hirnstrukturen völlig überfordert sind, führt dies zu den bereits beschriebenen Phänomenen der Derealisation und der Dissoziation, so dass – beispielsweise bei einer Vergewaltigung – bestimmte Aspekte des Geschehens nicht als real oder als Bedrohung des eigenen Ichs wahrgenommen oder später detailgetreu erinnert werden. Auch eine emotionale Abspaltung und relative Gefühlslosigkeit ist hier einzuordnen.
Es muss betont werden, dass diese Reaktionen und stufenweise vereinfachenden Maßnahmen unterschiedlicher Hirnareale kein pathologisches Phänomen sind. Sie sind vielmehr die normale Reaktion auf ein unnormales, lebensbedrohliches Geschehen.
Die Reize, die über unsere Sinne und verarbeitet vom limbischen System das Gehirn überfluten, signalisieren höchste Gefahr und Todesbedrohung. Mit diesen Impulsen fertig zu werden, sind die höheren kortikalen Strukturen nur bedingt in der Lage. Sind sie damit überfordert, wird der Impuls an die „nächste Etage darunter“ weitergegeben, die ein Überleben (wenn auch auf Kosten von Komplexität und zielgerichtetem Handeln) noch ermöglicht. Selbst die unterste, rein vegetative Reaktion ist also sinnvoll, stellt es doch die einzige und letzte Möglichkeit dar, trotz auswegloser und unmittelbar lebensbedrohlicher Situation eventuell doch noch zu überleben.
Reaktionen bei akutem Trauma
So sinnvoll und möglicherweise überlebensfördernd eine solche Reaktion auf ein akutes Trauma ist – sie hat allerdings zur Folge, dass sich Nervenbahnen und synaptische Verschaltungen ändern. Dies führt in der akuten Krisensituation beispielsweise dazu, dass die Betroffenen nur mit dem akuten Überleben beschäftigt sind, hingegen nicht nach gezielter Hilfe Ausschau halten können, Schwierigkeiten mit der Orientierung haben etc. In den folgenden Stunden, Tagen und Wochen (erfahrungsgemäß bis zu einem halben Jahr) werden die Schrecksituationen immer wieder erlebt und reaktiviert. Gelingt es, möglicherweise bereits in oder kurz nach der Katastrophensituation externe Hilfe bei diesem Prozess anzubieten, oder kann man wenigstens innerhalb des ersten halben Jahres auf solche Hilfe zählen, so kann ein solches Trauma bearbeitet, ins bewusste Erleben integriert und somit überwunden werden. Dies setzt allerdings voraus, dass es sich um ein einmaliges Trauma (beispielsweise ein Erdbeben oder ein Autounfall) und nicht um ein fortgesetztes Trauma (sequenzielle permanente Wiedervergewaltigung, Kriegsgefangenschaft, systematische Folter etc.) handelt und dass externe Helfer zur Verfügung stehen.
Direkt in oder nach einem Trauma ist es beispielsweise hilfreich, nach Abwendung der unmittelbaren Lebensgefahr, der Zufuhr von Atemluft (wo dies nötig ist) und Flüssigkeit, für Wärme und Ruhe zu sorgen (Schutz, Decken). Gleichzeitig ist es hilfreich, in kurzen und eindeutigen Sätzen Realität herzustellen („Sie sind jetzt in Sicherheit. Die Gefahr ist gebannt. Folgende Hilfe ist zu erwarten: […]“). Dies muss möglicherweise immer wieder, in einfacher Form, wiederholt werden, weil auf den Verwirrtheitszustand des Betroffenen Rücksicht genommen werden sollte. Aber auch Flashbacks und Intrusionen in der Folgezeit kann durch Sicherheit gebendes, erklärendes Verhalten bzw. gezielte posttraumatische therapeutische Hilfe begegnet werden.
Schwieriger ist es, wenn eine solche Hilfe auf Dauer ausbleibt und / oder es zu einer permanenten, andauernden und wiederholten Traumatisierung kommt, wie das beispielsweise in Kriegssituationen, aber auch in sozialen Situationen, die durch rezidivierende Vergewaltigungen, gewaltanwendende Familienmitglieder o.ä. geprägt sind, der Fall ist.
Sequenzielle Traumatisierung
Im Gegensatz zu einem Monotrauma sind solche politraumatischen, ja sogar sequenziellen, also aufeinanderfolgenden Traumatisierungen dadurch gekennzeichnet, dass immer wieder ähnliche oder sogar gleiche Erfahrungen gemacht werden. Dies führt schließlich dazu, dass sich die neuronalen Verschaltungen, die in der Extremsituation vielleicht lebensrettend waren, verfestigen und stabilisieren. Jedes weitere als Trauma identifizierte Ereignis verfestigt die neuronalen Synapsen, und schließlich kann bei geeigneten Triggern jedes Ereignis, jeder Geruch, jeder Anblick, jede Emotion u. U. mit dem lebensbedrohlichen Trauma assoziiert werden. Das führt dann automatisch dazu, dass das Ereignis nicht in der obersten Etage, also im frontalen Großhirn oder der weiteren Großhirnrinde, sondern direkt von den tiefsten Schichten unseres Gehirns, dem Zwischenhirn, Stammhirn und dem Vegetativum, bearbeitet wird. Der renommierte Neurobiologe Hüther (2017) benutzt das Bild eines Schachtes oder eines Aufzugs, um darzustellen, dass bei einer Verfestigung der nun dysfunktionalen zerebralen Krisenverarbeitungsprozesse bei jeder erneuten Schwierigkeit automatisch der posttraumatische Bearbeitungsmodus ausgelöst wird. Dies erklärt die Intrusionen und Flashbacks, also das permanente Wiedererleben traumatischer Ereignisse, auch in Situationen, bei denen objektiv keine oder nur sehr geringe Gefahr vorliegt, aggressive oder depressive Impulsdurchbrüche, die sich der Kontrolle entziehen, massive Ängste bis hin zu Panikattacken, Verwirrtheitszustände, dissoziative Bilder, Albträume usw. Mit jedem neuen Flashback, mit jedem neuen inadäquat verarbeiteten Trauma, erst recht aber mit jedem weiteren schweren lebensbedrohlichen Trauma, jeder weiteren Gewaltanwendung oder Vergewaltigung verschlimmern und verfestigen sich diese neuronalen Verschaltungen und Bahnen oder, um im Bild von Hüther zu bleiben, die Aufzugsschächte. Umso schwerer wird es auch, andere und neuere, angemessenere Verarbeitungsmodi zu implementieren.
Frühkindliche Traumatisierung
Neben Einzeltraumen und politraumatischen, sequenziellen seelischen Verletzungen ist drittens noch auf frühkindliche (häufig ebenfalls sequenzielle) Traumatisierung einzugehen. Frühkindliche Gewalt, Vernachlässigung / Deprivation oder sexueller Missbrauch, frühkindlicher Hunger, das Erdulden schwerster krankheits- oder kriegsbedingter Traumen am Ende der Schwangerschaft sowie vor allem im ersten, z. T. auch noch im zweiten und dritten Lebensjahr betreffen das Gehirn, das gerade erst im Aufbau ist. Fertig sind bei der Geburt lediglich die Stammhirnfunktion und zu einem gewissen Teil die Zwischenhirnfunktionen des limbischen Systems. Die darüberliegenden Schichten, insbesondere die Hirnrinde und ganz besonders der präfrontale Kortex, die u. a. für differenziertes Bearbeiten sozialer Erfahrungen und das Anbahnen adäquater Lösungsmodi im sozialen Kontext zuständig sind, bilden sich erst in den ersten Lebensjahren im interaktiven Prozess mit der Umwelt, beispielsweise den Eltern, heraus.
Trauma und Bindung
Hierbei entstehen Urvertrauen, das Gefühl der emotionalen Geborgenheit, der Selbstwirksamkeit (also der Fähigkeit, auch schwierige Situationen meistern und kontrollieren zu können), der emotionalen Regulation und der Gewissheit, seinen Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert zu sein, und vor allem ein sicheres und stabiles Bindungsverhalten zu wichtigen, haltgebenden Bezugspersonen. Sind diese Bezugspersonen aber auf Dauer und wiederholt nicht in der Lage, für Sicherheit gebendes Verhalten zu sorgen oder sind sie, schlimmer noch, diejenigen, die die eigentliche Gefährdung darstellen (beispielsweise bei elterlichem sexuellen Missbrauch oder extremer Kindesmisshandlung), so werden in diesem wichtigen Entwicklungszeitraum von vornherein nur die extrem stressbelasteten Erfahrungen gemacht und die damit korrelierenden, subkortikalen Strukturen gefestigt und aufgebaut. Die betroffene Person hat gelernt, auf fast alle wesentlichen, spannungsgeladenen oder bedrohlichen Situationen im Sinne einer extremen Belastungsreaktion zu reagieren. Schlimmer noch: Auch die zerebralen Strukturen, die synaptischen Verschaltungen der entsprechenden Hirnmodule, sind erfahrungsbedingt so strukturiert, dass sich das Gehirn permanent im Ausnahmezustand der Abwehr lebensbedrohlicher traumatischer Ereignisse befindet. Dies äußert sich auch in einer veränderten und häufig erhöhten Stoffwechsellage, insbesondere was Adrenalin und Glutamat sowie einige andere aktivierende Hormone und Neurotransmitter angeht – dies oft auf Kosten beruhigender Neurotransmitter wie beispielsweise der Gamma-Aminobuttersäure.
Traumabedingte Spätfolgen
Eine von extremen Entbehrungen und körperlichen wie psychischen Gefahren geprägte Kindheit prädestiniert aus leicht vorstellbaren Gründen also für eine Reihe von Folgeschäden, die im Jugend- oder Erwachsenenalter als dissoziative Persönlichkeitsstörung, Borderline-Störung mit selbstverletzendem Verhalten, erhöhte Suchtgefährdung und Drogenabhängigkeit, Depression und Suizidalität bis hin zur psychotischen Vulnerabilität imponieren. Tatsächlich sind solche Erscheinungsformen möglicherweise aber nicht primär genuine psychiatrische Störungsbilder (obwohl sie es im Laufe der Zeit werden können), sondern Ausdruck einer tiefgreifenden, sequenziell in der frühen Kindheit angelegten posttraumatischen Belastungsstörung, die nicht zuletzt auch auf epigenetische Veränderungen der Genexpression und eine veränderte Herstellung von Proteinen, insbesondere Neurotransmittern und Hormonen, zurückzuführen ist.
Begleitung traumatisierter Menschen
Was bedeutet dies nun für Pädagogik, Therapie und soziale Begleitung traumatisierter Menschen?
Das Wissen um die neurobiologischen Vorgänge bei der Entstehung posttraumatischer Belastungsstörungen hat auf die Begleitung sowie Behandlung Betroffener einen großen Einfluss und ist in den letzten zwei Jahrzehnten z. T. erheblich erweitert worden. Zunächst einmal kommt es darauf an, angeblich pathologische (oder zumindest auffällige) Verhaltensweisen als normales Verhalten auf ein unnormales – möglicherweise schon lange zurückliegendes – traumatisches Ereignis zu verstehen. Allgemeine Unruhe, plötzliche aggressive Impulsdurchbrüche, das Vermeiden bestimmter Situationen u. a. m. können besser verstanden werden, wenn sie in den Kontext posttraumatischer Belastungen gesetzt werden. Das gilt selbst für Sekundärsyndrome wie selbstverletzendes Verhalten, chronisch empfundene Sinn- und Hoffnungslosigkeit oder Suizidalität als Ausdruck tiefster Verzweiflung. Auch sollte deutlich geworden sein, dass viele der zunächst unverständlich erscheinenden „emotionalen Durchbrüche“ (beispielsweise Panikattacken) verständlich werden, wenn man sie als Intrusionen nicht verarbeiteter Erlebnisse versteht. Auch Zwangsverhalten oder Phobien sowie Depersonalisationserscheinungen können besser verstanden und eingeordnet werden, wenn man sie als Schutzmechanismus vor sonst drohenden Intrusionen einordnet.
Zum anderen gelingt es erst dann, Resilienz- bzw. Schutzfaktoren zu analysieren und zu entdecken: Hierzu gehören beispielsweise erfolgreiche Bewältigungsstrategien, eine sichere Umgebung, sichere emotionale Bindungen zu Bezugspersonen, positive soziale Unterstützung etc. Deren Wichtigkeit wird erst dann deutlich, wenn man sich klar macht, welche destruktiven Potenzen eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Das Wissen darum, dass jedes Verhalten einen „guten Grund“ (gut im Sinne von „sinnmachend“) hat, ermöglicht es, durch das Verstehen solcher Verhaltensweisen andere Alternativen zu suchen und zu finden.
Traumatherapie, Traumapädagogik
Eine der wesentlichen Erkenntnisse neurobiologischen Grundlagenwissens ist, dass vor einer Therapie die traumapädagogische Arbeit steht. Wenn wir unter Therapie das Bemühen verstehen, die traumatischen Ereignisse ins biographische Erleben und das Selbstbild des Betroffenen zu integrieren, so ist es Aufgabe traumapädagogischer Arbeit, zuvor dafür zu sorgen, dass der Betroffene trotz und mit seinen traumatischen Erfahrungen überhaupt lebens- und beziehungsfähig ist. Es hat sich seit Anfang 2000 gezeigt, dass diese traumapädagogischen Grundvoraussetzungen wesentlich wichtiger und notwendiger sind als eine therapeutisch-integrative Arbeit. Etwas überspitzt könnte man formulieren, dass man möglicherweise ohne Traumatherapie einigermaßen zurechtkommen kann, ohne eine pädagogisch begleitete Konsolidierung hingegen auf keinen Fall.
Grundlage allen pädagogischen Handelns ist das Herstellen von Sicherheit, die Reduktion und das Vermeiden von Stress, die Unterstützung von Entwicklung von Bindung und von positiven Selbsthilfen sowie die Orientierung an den Ressourcen des Einzelnen.
Safety first
„Safety first“ meint, dass die atmosphärischen Bedingungen sowie die strukturelle Klarheit unabdingbare Voraussetzungen zu einem Sicherheit gebenden Verhalten sind. Dies gilt insbesondere für sequenziell politraumatisierte Kinder und Jugendliche. Am wichtigsten ist es, sicherzustellen, dass sie keinerlei Sorgen vor erneuter Gewaltanwendung und Retraumatisierung haben müssen. Konkret heißt das, dass sie eindeutig und sicher vor Tätern geschützt werden müssen, dass das Kindeswohl vor allem andern, ggf. auch vor den Wünschen der Eltern steht, wenn Retraumatisierungen (wiederholte Vergewaltigung etc.) zu befürchten sind und dass die Entwicklung in Kindheit und Jugend unter geschützten Maßnahmen in einer wertschätzenden und Geborgenheit vermittelnden Atmosphäre verlaufen soll. Dabei reicht es nicht aus, dass eine Retraumatisierung vermieden wird – genauso wichtig sind feste und belastbare Beziehungen, die selbst dann greifen, wenn es beispielsweise intrusionsbedingt zu erheblichem eigen- oder fremdgefährdenden Verhalten kommt. Dazu gehört eine intensive Begleitung gerade auch in rezidivierenden Krisen, was einen hohen Personalschlüssel sowie eine qualifizierte Ausbildung der Pädagogen (einschließlich Supervision) erfordert. Traumapädagogik setzt Feinfühligkeit, Präsenz, angemessene Beantwortung von Signalen, Unterstützung bei der Stressregulation, sprachliche Interaktion und Resonanz, die Fähigkeit, Empathie zu empfinden und angemessen zu zeigen sowie Geduld und Selbstreflexion voraus. Der Umgang mit Krisensituationen, ein Aufflackern von traumatisierten Inhalten im Sinne von Flashbacks usw., erfordert zudem ein hohes Maß methodischer Kompetenz – wenn es beispielsweise darum geht, autoaggressiven Verhaltensweisen oder Depersonalisationsphänomenen durch Musik oder andere sensorische Reize (scharfe Gewürze, Massagen mit Duftöl, habituierte, Sicherheit gebenden Verhaltensweisen etc.) zu begegnen.
Distanzierung und Selbstberuhigung
Es gibt zahlreiche Strategien zur Distanzierung und Selbstberuhigung wie beispielsweise Atemübungen, Körperübungen, Techniken zur Ablenkung usw., deren Anwendung allerdings eine intensive pädagogische Ausbildung und vor allem die angemessene Berücksichtigung des situativen Kontextes sowie der biographischen Vorerfahrung der Jugendlichen bedarf. Dies gilt auch für das Einüben bestimmter Ressourcen bzw. Skills, die es dem Jugendlichen ermöglichen, trotz und mit seiner immer wieder auftretenden Schwierigkeiten eine angemessene kognitive, emotionale und insbesondere soziale Entwicklung zu nehmen.
Alltags-Skills
Alltags-Skills (Geschirr abwaschen, Körperpflege, Ernährung, Auseinandersetzung in Gruppen) sind Aufgaben aller Jugendlichen, können aber beim Vorliegen eines posttraumatischen Belastungssyndroms erheblich erschwert sein. So kommt dem Krisenmanagement und der Unterstützung von Stressregulation eine besondere Bedeutung zu. Hierbei ist es notwendig, komplexe Flashback-Situationen mit Dissoziation, körperlicher Erregung, Erstarrung etc. zunächst einmal überhaupt zu erkennen und sodann durch eine gezielte Kontaktaufnahme, Aktivierung der Reorientierungskräfte, gezielte Aufklärung und Kontaktregulation dem Betroffenen zu helfen, diese schockähnliche Flashback-Situation zu bewältigen. Hierzu gibt es inzwischen gut elaborierte, sehr praxisnahe Handlungsanweisungen.
Diese und andere Überlegungen der pädagogischen Begleitung (oft über viele Jahre) ermöglichen es, dass das Gehirn unter diesen Sicherheit gebenden strukturellen und beziehungsdynamischen Gegebenheiten neue und dauerhafte Erfahrungen macht, die letztlich zu einer neuen Vernetzung neuronaler Bahnen führt. Dies geschieht top down, d. h., die präfrontale Kortex analysiert, dass Stressoren nicht unbedingt die gleiche potenzielle Gefährdung wie das damalige Trauma haben müssen und dass es andere, abgestufte und komplexere Möglichkeiten der Problembewältigung als die damals im akuten Stress gelernten gibt. Erst nach langjähriger Habituation werden die archaischen Reaktionen (völliges Überrollt-Werden von Gefühlen, Bearbeitung durch Stamm- und Zwischenhirn mit Flight-, Fight- and Freeze-Reaktion, Flashbacks und Intrusion) an Frequenz und Intensität zugunsten adäquaterer Reaktionsmuster und Problemlösungsstrategien abnehmen. Dies wiederum ermöglicht es, von Vermeidungsverhalten (Avoidance) Abstand zu nehmen – es ist nun nicht mehr nötig, panisch, phobisch oder depressiv bzw. durch Rückzug und Isolation möglichen Gefahren eines Wiedererlebens traumatischer Ereignisse auszuweichen.
Mitunter mag dies reichen. Es ist auf alle Fälle die Basis einer gelungenen Begleitung und absolut notwendig, um Menschen vor den destruktiven Folgeerscheinungen des posttraumatischen Belastungssyndroms zu schützen.
Psychoedukation und Psychotherapie
Darüber hinaus kann, wenn der Betroffene es wünscht und der fürihn subjektiv richtige Zeitpunkt gekommen ist, entweder durch Psychoedukation oder durch therapeutische Maßnahmen im eigentlichen Sinne versucht werden, die traumatischen Ereignisse ins bewusste Erleben zu reintegrieren. Dies kann aber erst geschehen, wenn genügend emotionale Sicherheit, Vertrauen in die Selbstwirksamkeit des eigenen Tuns sowie die Beziehung zu anderen Menschen (u. a. den Therapeuten) sowie die Erfahrung, in tatsächlicher Sicherheit vor weiteren Traumen zu sein, vorliegt. (Jemand, der permanent damit rechnen muss, wieder verfolgt, gefoltert, vergewaltigt oder körperlich missbraucht zu werden, kann und sollte sich also nicht auf eine Therapie einlassen, bevor diese äußeren Gefährdungen ausgeschlossen sind).
Traumatherapeutische Ansätze
Bei einer weiterführenden, letztlich auf Integration des traumatischen Erlebens ausgerichteten Psychotherapie stehen vor allem die traumafokussierte kognitiv-behaviorale Therapie (Tf-KBT, Landolt 2008), das Eye-Movement-Desensitization-and-Reprocessing (EMDR; Hensel 2007), die Narrative Expositionstherapie für Kinder (Kidnet, Ruf et al. 2008), die Traumazentrierte Spieltherapie (Weinberg / Hensel 2008) sowie Psychodynamisch-Imaginative-Traumatherapie (PITT; Appel-Ramp 2008) zur Verfügung. Sie alle sind inzwischen recht gut evaluiert, haben einige Spezifika, gleichzeitig aber einige Grundprämissen, die am Beispiel der trauma-fokussierten kognitiv-behavioralen Therapie kurz erläutert werden sollen.
Ansatz einer jeden Therapie ist der Aufbau stabiler Beziehungen, der absolute Schutz vor Retraumatisierungen (auch durch fehlgeschlagene oder inadäquate Therapien!) und die emotionale, soziale und körperliche Stabilisierung. Erst dann kann im Rahmen von Psychoedukation auf einige generelle Aspekte eines traumatischen Geschehens eingegangen werden. Die hierbei auftretenden Affekte sollten erkannt und benannt sowie im Rahmen von Entspannungsverfahren und anderen, in der pädagogischen Arbeit bereits kennen gelernten Skills, effektiv reguliert werden können. Konkret heißt dies, dass bei der Begegnung traumatischer Erinnerungen die damit verbundenen Gefühle immer wieder bearbeitet werden sollten, damit die Konfrontation mit dem Trauma nicht wieder übermächtig wird oder gar zu erneuten Intrusionen führt (dies würde, wie im biologisch orientierten Teil dieses Kapitels gezeigt, zu einer Retraumatisierung und zu einer Festigung der dysfunktionalen neuronal-strukturellen Verbindungen führen). Traumaexposition (die Konfrontation mit traumatischem Erleben oder beispielsweise mit Orten, an denen das Trauma stattgefunden hat, das Ansehen von Fotos etc.), aber auch das Traumanarrativ (also Erzählungen vom traumatischen Erleben) sollten also sehr vorsichtig und unter Berücksichtigung dessen, was der Betroffene verkraften kann, stattfinden. Bei der Screen-Technik werden Betroffene beispielsweise aufgefordert, Teile ihres traumatischen Erlebens wie in einem Film zu erzählen, wobei sie den Film anhalten und damit das szenische Geschehen verlassen können und sollen, wenn sie beispielsweise Gefühle wieder zu übermannen drohen. Neben der Identifikation und Bearbeitung dysfunktionaler Gedanken (beispielsweise des Gedankens, dass von allen Männern sexuelle Gefahr ausgeht) liegt das Ziel der Traumatherapie auch in dem Einüben alternativer Verhaltensweisen und Copingstrategien sowie der langsamen Integration des traumatischen Geschehens in das bewusste Erleben. Aber der entscheidende Punkt ist sicherlich, dass ein solches Prozedere letztlich zur emotionalen Stabilisierung beitragen muss. Tut es das nicht, ist die biographische Konfrontation mit den ursprünglichen Traumen also zu belastend, droht die Gefahr einer weiteren, jetzt iatrogenen (durch den Therapeuten verursachten) Traumatisierung.
Zusammenfassend können wir also festhalten, dass das Wissen um die neurobiologischen Vorgänge im Gehirn im Gefolge eines schweren Traumas bzw. schwerer sich wiederholender Traumata notwendig und hilfreich ist, um Symptome und dysfunktionale Entwicklungen über lange Phasen des Lebens besser zu verstehen und einzuordnen. Darüber hinaus verhilft uns dieses Wissen zu der Erkenntnis, dass es im Wesentlichen um eine Stabilisierung vertrauenswürdiger Beziehungen, eine klare Strukturierung, das Schaffen von Vertrauen in die eigenen Kräfte und insbesondere den bleibenden, nachhaltigen und absolut verlässlichen Schutz vor weiteren (Re-)Traumatisierungen geht. Weiterhin wird verständlich, dass dies die Voraussetzungen für weitergehende, integrative psychotherapeutische Verfahren sind – die bei Monotraumen möglicherweise relativ schnell, bei tiefgreifenden, frühkindlichen und sequenziellen politraumatischen Verletzungen hingegen möglicherweise erst nach langer Zeit psychischer Stabilisierung zur Anwendung kommen sollten.
Auf einen Blick
■ Existenzielle, lebensbedrohliche Stressoren können zu Traumen führen, bei denen die Reaktionen des Individuums über die üblichen Stressreaktionen (flight-and-fight-reaction, freezing) hinausgehen. Traumatische Reaktionen sind als lebenserhaltende und somit normale Reaktionen in unnormalen (nämlich extrem bedrohlichen) Situationen anzusehen.
■ Vor allem frühkindliche Traumen sowie sequenzielle Traumatisierungen können tiefe neurobiologische und seelische Spuren hinterlassen.
■ Ein posttraumatisches Belastungssyndrom ist durch Übererregung (hyperarousal), Intrusionen und Flashbacks, Vermeidungsverhalten (Konstriktion) und Veränderungen von Kognition und Emotion gekennzeichnet. Dissoziative Symp tome können hinzukommen.
■ Safety first: Am Anfang aller Kriseninterventionen bei Traumatisierungen steht die Sicherheit: Verlässlicher und dauerhafter Schutz vor weiterer Traumatisierung.
■ Traumabedingte Spätfolgen können – neben der posttraumatischen Belastungsstörung – auch als dissoziative Persön - lichkeitsstörungen, Borderline-Störungen mit selbstverletzendem Verhalten, erhöhte Suchtgefährdung, Angststörungen, Depression, Suizidalität oder erhöhte Psychosegefährdung auftreten.
Multiple-Choice-Fragen zu diesem Kapitel finden Sie unter testfragen. reinhardt-verlag.de
Weiterführende Literatur
Courtois, C. A., Ford, J. D. (eds.) (2009): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. Guilford Press, New York
Ehring, T., Ehlers, A. (2012): Ratgeber Trauma und Posttraumatische Belastungsstörung. Informationen für Betroffene und Angehörige. Hofgrefe, Göttingen
Friedman, M. J., Keane, T. M., Resick, A. P. (2014): Handbook of PTSD. Science and Practice. 2nd ed. Guilford Press, New York
Poijula, S., Williams, M. B. (2013): The PTSD Workbook. Simple, Effective Techniques for Overcoming Traumatic Stress Symptoms. New Harbinger Publications, Inc., Oakland
Raja, S. (2012): Overcoming Trauma and PTSD: A Workbook Integrating Skills from ACT, DBT and CBT. New Harbinger Publications, Inc., Oakland
Shapiro, F., (2001): Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Basic Principles, Protocols, and Procedures, 2nd ed. Guilford Press, New York