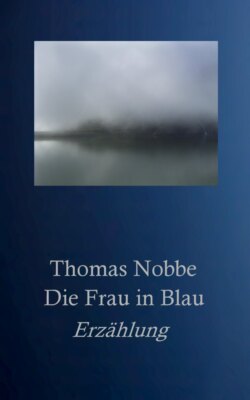Читать книгу Die Frau in Blau - Thomas Nobbe - Страница 3
1
ОглавлениеWas habe ich nicht schon alles gesehen!
Müßig durch die Gegend schlendernd und blind durch alle Mauerritzen starrend bin ich ein immerwacher Observant, dem, augenlos, nicht das geringste an diesem Ort entgeht und wenn ich doch etwas verpasse, zwitschern`s mir die Vögelein zu. Ich weiß Bescheid.
Ich weiß, durch Erfahrung gewitzt, dass das Leben ein zarter Organismus ist, ein subtiles Gefüge, mit fein aufeinander abgestimmten Bestandteilen. Ich kenne das dichte Gewebe seiner vielseitigen Verbindungen und vermeiden ängstlich, es zu stören, damit in dem harmonischen Geflecht keine Verwirrung entsteht, keine häßlichen Knoten und Schlingen, damit alles schön glatt und übersichtlich bleibt, auf das ich selber heil und lebendig bleibe hienieden. Kann einem nämlich auch ruckzuck ganz anders gehen. Hab` ich selbst erlebt! Drum rate ich zur Vorsicht. Das Leben ist ein mächtiger Strom, aber selbst ist man nur ein kleines Tröpfchen darin und ehe man sich versieht ist man verdunstet und dahin. Es muß eben alles eine Balance haben, im Lot stehen, ausgeglichen sein. Es kann nicht immer nur ein Kommen geben, es muß auch mal gegangen werden, damit die Rechnung aufgeht, damit die Bilanz stimmt auf beiden Seiten, selbst wenn die, die`s dann gerade trifft, oft ein bißchen überrascht sind, wie schnell die Dinge sich entwickeln können. Und in welch unerwartete Richtung. Wie gesagt: Am Ende gleicht sich alles aus. Aber, andererseits, hat man am Ende nichts mehr davon. Oder wenigstens nicht viel. Vorher aber, so zwischen dem Anfang und dem Ende, da tut sich doch so einiges, da lohnt es sich, ein wenig hinzuschauen, sich kundig zu machen, sich angemessen einzubringen, in jenen Strom, in jenen Organismus, in jenen fein geordneten Stoff mit seinen kunstvoll verwobenen Fäden. Da muß man ein Gefühl bekommen, für die Dinge, für die feinen Strukturen, mit sensiblen Fingern tasten, zurückhaltend sein und, ich sagte es schon, vorsichtig. Man muß auf die feinen Veränderungen lauschen, die beinahe unmerklichen Wechsel im Pulsschlag dieses Körpers, die kaum wahrnehmbaren Ausschläge seiner Temperatur. Man muß sich Zeit nehmen. Sensibel sein. Die Fäden nicht verwirren. Dann gleicht sich, günstigstenfalls, auch Manches lange vor dem Ende aus und ist im Lot und wir haben doch noch was davon. Wie zum Beispiel, dass wir Blinden besser sehen. Und hören. Und empfinden. Niemand hat ein feineres Gespür, für die Ordnung der Dinge, als ein Blinder, dem ein Gott auf`s Haupt geschlagen hat. Darum rate ich ja so dringend zur Vorsicht. Ich fälle keine Urteile, ich trete, nach Möglichkeit, keiner Schlange auf den Kopf, ich respektiere die Nackheit der Götter und plaudere keine Heimlichkeiten aus. Gestützt auf meinen Seherstock aus Kornelkirsche lausche ich dem Vogelsang und bewahre aufmerksam mein Gleichgewicht. So kann man auch als Blinder lange leben. Irgendwie gleicht sich am Ende alles aus. Wir werden ja sehen!
In flimmernder Hitze liegt die Landschaft, leer und unermesslich, ausgestreckt unter einem stählern blauen Himmel, in totengleicher Stille. Durch das nur von Staub getrübte, gleissende Licht des Mittags nähert sich, aus weiter Ferne kommend, eine kaum wahrnehmbare Gestalt mit unscharfen Konturen, die an den Rändern wie zerfliessen, in der irisierenden, flimmernden Luft. Mit jedem ihrer Schritte wirbelt in kleinen Wolken der Staub von dem Pfad auf, auf dem sie beharrlich und zäh dahinschreitet, steigt träge in die Höhe und legt sich dann allmählich in einer langen Fahne hinter ihr nieder, langsam dünner und dünner werdend, sich verlierend in der Ferne und der Weg hinter ihr ist wie ein Band, angeheftet an ihren Schritt, in sachten Windungen sich ausdehnend bis an den Horizont, in dieser ungeheuren Weite, in der alle Bewegung seltsam vergeblich und verloren wirkt. Regungslos steht die Sonne hoch oben im Zenith. Unmerklich nur und kaum erkennbar kommt sie näher, diese schillernde und unwirkliche Gestalt, kaum das sie wächst und größer erscheint, durch die sich langsam verringernde Distanz und die Zeit fließt träge und zäh, wie dicker, schwerer Saft. Ist das ein Tuch, das sie dort um sich geschlungenen trägt oder ein Umhang? Etwas aus Stoff reicht ihr vom Kopf bis zu den Füßen, weich fliessend, geschmeidig, sich anpassend an jede Bewegung ihres Körpers, an jede Bewegung der Luft, die unscharfe Kontur ihres Körpers noch weiter verwässernd, selbst die Farbe wie Wasser und wie der Himmel, ein stählernes Blau auf einem staubigen, endlosen Weg.
Ich liebe diesen Blick aus meinem Fenster!
Selbst durch das doppelte Glas hindurch spüre ich das Pulsieren und Atmen, den kraftvollen Rhythmus der Stadt. Durch die Mauern des Verwaltungshäuser-Meers dringt, wie eine feine Schwingung, die Vitalität der Menschen nach draußen, die Kraft ihrer Bewegung, die Intensität ihrer Energie, ihr machtvoller Willen, der sich Bahn bricht in diesem Netzwerk aus Straßen, Kanälen und Leitungen, Röhren und Drähten, vielfach verschlungen und ineinander verwoben und doch in einer feinen Ordnung, wie ein Uhrwerk mit seiner präzisen Mechanik. Durch die Straßen schiebt sich, nicht abreißen wollend, der dichte Verkehr, geschäftig und zielgerichtet, Lastwagen und Autos, Motorräder und Roller und hunderte, tausende von Menschen mit Koffern, Beuteln und Taschen, emsig und strebsam, niemals im Stillstand, nie ohne Bewegung, niemals ohne irgend ein Ziel. Ich spüre das Pulsieren, spüre den Atem, wie wenn es mein eigener wäre, spüre, wie es mich mitnimmt und durchdringt und erfüllt mit Energie, prickelnd wie elektrischer Strom in meinem Körper, auf meiner Haut, wie ich ein Teil bin jenes mächtigen Getriebes, das seine Kraft durch meine Gelenke schickt, durch meine Muskeln, meine Nerven, mein Gehirn und wie ich selber vorwärts treibe, mit meiner eigenen Kraft, die Räder und Achsen um mich herum und meinen Beitrag leiste zu dieser umfassenden Spannung und Elektrizität.
Ich liebe es, tagsüber in meinem Büro zu sitzen, durch seine gläserne Front auf die Beschäftigten im Vorzimmer zu blicken, zu sehen, wie sich alle auf ihre Weise in den fein organisierten Mechanismus meines Betriebes einfügen, wie sie alle, konzentriert über ihre Schreibtische gebeugt, dann und wann verstohlene Blicke zu mir werfen, zu mir, der Lenkerin, der Wissenden, der Vorkämpferin, die ich an meinem Schreibtisch stehe, mein Kleid wie eine leichte Rüstung, das Telefon in meiner Hand wie eine kurze Lanze, wie sie sich meiner versichern, dass ich noch da bin, hier bei ihnen, um sich anzudocken an meine Vitalität und Energie, meine Ausstrahlung. Ich liebe es, durch mein Telefon verbunden zu sein mit der Stadt und der Welt um mich her, mit wenigen Sätzen über den Draht die Dinge zu bewegen, zu lenken, zu beschleunigen, aufs richtige Gleis zu setzen, das Gefühl, dass durch die Leitung ein belebender Strom in meinen Kreislauf fährt und mich anfüllt mit Lebendigkeit, die in mir zirkuliert, der ich in diesem Moment, nach Stunden intensiver Arbeit für einen Augenblick am Fenster stehend, wohlig geniessend nachspüren kann.
Von unten her kann ich aus der Werkstatt das Hämmern und Klopfen der Arbeiter hören, mit ihren schweren Werkzeugen, Metall auf Metall, dazwischen Stimmen und Rufe, während aus dem stahlblauen Himmel die Sommersonne ihr gleissendes Licht auf tausende Dächer und durch tausende Scheiben wirft, eine klare Helligkeit, in der die Dinge erkennbar sind und eindeutig und verbunden miteinander durch einen bestimmenden, wollenden Geist. Ich höre auf das Pochen der Hämmer, wie auf das Pochen meines Herzens, ein rhythmisches Dröhnen schallt zu mir herauf, gedämpft durch das dichte Glas der Fensterscheibe und für einen Augenblick überlasse ich mich dem gleichmässigen Klang, dem Rhythmus meiner Firma, in dem ich aufgehe und zuhause bin.
Ich liebe es, von dort hinauszugleiten in meinem schnellen Wagen, abends, erfüllt von vitaler Kraft und voller Lust an der Bewegung mit offenem Verdeck zu fahren, den Wind in meinen Haaren und die gebändigte Gewalt des Motors zu spüren, seine Vibration, und einzutauchen in den Blutstrom der Stadt, ihre Macht und ihre Dynamik zu fühlen, ihrem Drängen zu folgen durch das Netzwerk der Straßen, die Blicke der Passanten, Männer und Frauen, wie ein Prickeln auf meiner Haut, zu spüren, wie hinter den Scheiben der neben mir stehenden Wagen und hinter den Visieren von im Abendlicht glänzenden Helmen alle Augen auf mich gerichtet sind, wenn ich an einer Ampel halte. Mich in den Scheiben spiegelnd sehe ich mich selbst, fühle die Wärme meines Körpers und geniesse es, ein Teil dieses lebendigen Ganzen zu sein.
Seht, das ist Esther!
Esther ist groß, Esther ist schön. Weich und duftig fallen ihre tiefschwarzen Locken über ihr dezent, aber raffiniert geschnittenes, anthrazit-graues Kammgarn-Geschäftskostüm, weich umschmiegen Jacket und Rock ihre schlanke, sportliche Figur und wenn sie morgens mit energischem und selbstbewusstem Schritt, auf dem Weg in ihr Büro, die Verwaltungsetage von Parthen & Cie durchquert, folgen ihr, wie magnetisch angezogen, die Blicke der dort am Schreibtisch Tätigen und alle denken unisono: Das ist unsere Esther, unsere Esther ist schön!
Hier zum Beispiel, dieser junge Mann mit Namen Roland, denkt so und es braucht keine seherischen Fähigkeiten, um sich vorzustellen, was hinter seiner Stirne, wo er sich eigentlich mit voller Konzentration mit der Planung und Zeichnung der Parthen & Cieschen Projekte beschäftigen soll, so alles vor sich geht, wenn, ohne sein eigenes Zutun, sein Kopf sich des Morgens hebt und seine Blicke über die Kante seines 21-Zöllers hinweg wandern und Esther folgen und träumerisch werden, hinter seiner rahmenlosen, superentspiegelten Rodenstock-Brille, wenn seine Nase ihrem feinen Duft nachwittert, der noch eine ganze Zeitlang in der Luft hängt, nachdem Esther schon längst an ihm vorbei und in ihrem Büro angekommen ist. Jeden Morgen freut er sich auf jene kurzen, bald darauf folgenden, köstlichen Momente dort drin an ihrer Seite, ganz in ihrer Nähe, nah bei Esther, die er doch niemals wagt, Esther zu nennen, sondern immer nur Frau Parthen, wie das Parthen & Cie mit dem sachlichen, schnörkellosen Schriftzug auf den Formularen und Notizzetteln auf seinem Schreibtisch, die er den lieben langen Tag vor Augen hat, immer nur Frau Parthen, die ihn immer nur Roland nennt, Roland und Sie, niemals Du und auch das niemals länger als nötig, für ein freundlich-bestimmtes, ungemein geradliniges und ebenfalls schnörkelloses Planer-und-Zeichnergespräch in ihrem Büro mit der gläsernen Front, durch die Roland Esther Montags bis Freitags arbeitstagelang vor sich sitzen sehen kann.
Setzen wir uns also ruhig ein wenig zu ihm hin, unauffällig und still, blicken über seine Schulter auf den Bildschirm seines PCs, wo ein Wirrwarr bunter Linien darauf wartet, von Roland zu einem montagefähigen Objekt geordnet zu werden und beobachten, wie von Zeit zu Zeit seine Blicke hin zu Esther wandern, die an einem makellosen, ebenfalls gläsernen Schreibtisch mit Beinen aus Edelstahl, selbstverständlich Edelstahl, aufs feinste verarbeitet von Parthen & Cie Metallbau, sitzt und dabei gleichzeitig energisch und gelassen wirkt, die langen Beine in einem Hauch von schwarzer Seide, die ebenso schwarze Bluse aus dem gleichen Material, nur, natürlich, sehr viel dichter gewebt, dabei sportlich geschnitten, mit eleganter Betonung der Hüften, das besagte Kammgarn-Jacket hinter ihr lässig über die Lehne ihres Eames-Stuhls hängend. Er sieht ihr zu, wie sie zunächst die in einer Plexiglas-Ablage mit der Aufschrift "Eingang" bereitgelegte Post durchsieht, Vermerke macht und Freigabezeichen setzt, ein rasches, prägnantes Zeichen, gebildert aus den miteinander verschmolzenen Buchstaben E und P, um sodann, in der Reihenfolge des vor ihr liegenden Tagesplaners, telefonisch Gespräche zu führen mit Kunden, Lieferanten, Interessenten, Ausstellern, Architekten und Designern, Treppenbauern, Schlossern, Küchenplanern und natürlich mit allen Abteilungen der Firma Parthen & Cie selber, von der Verwaltung bis zur Raumpflege und natürlich auch mit Roland selbst, der als einer der ganz wenigen in dieser Schar von Menschen das Privileg geniesst, ihr Stunde um Stunde beim telefonieren leibhaftig zusehen zu können.
Esther spricht: Ihr Blick ist konzentriert, doch niemals starr, ein leichtes Lächeln spielt meist um ihren Mund und wächst sich bei Gelegenheit zu einem feinen Lachen aus. Nur selten verschliessen sich die Lippen und werden schmal. Dann duckt sich Roland unwillkürlich ein wenig tiefer hinter seinen Schirm, um nicht aus Versehen von einem jener Blicke getroffen zu werden, die aus Esthers dunkler werdenden Augen schießen und ihn regelmässig gleichzeitig fröstelnd und rotglühendn machen, auch wenn er genau weiß, dass er natürlich gar nicht gemeint, ja vermutlich nicht einmal wahrgenommen worden ist. Aber glücklicherweise gilt im Metallbau, wie anderswo auch, dass sich mit schmal gezogenen Lippen kein vielversprechendes Gespräch führen läßt, wogegen heitere Gelassenheit und entspannte Züge beinah stets gewinnen, zumal im Umgang einer attraktiven Frau mit den in diesem Gewerbe vorherrschenden Herren der Schöpfung, die in aller Regel sowieso vermeiden, deren weiche, offene Züge und samtene Stimme wegen Geringfügigkeiten zu verhärten. Wie oft hat man schließlich, persönlich oder telefonisch, ein so angenehmes Gegenüber? So sitzt und strahlt also Esther hinter ihrem gläsernen Tisch, wirft ihre schwarzen Locken lässig zurück, zupft an den Ärmeln ihrer Bluse und dreht ihren Kugelschreiber in den Fingern, beugt sich nach vorn, um die Intensität des Gesprächs zu steigern, lehnt sich dann wieder zurück, um die Spannung etwas zu vermindern, blickt dabei immer wieder beiläufig auf eine filigrane Figur aus Olivenholz auf ihrem Schreibtisch, eine Eule mit sehr großen Augen, die, nebenbei bemerkt, ihr Lieblingstier ist, und zieht auf diese Weise Stunde um Stunde die Fäden, an denen sich das Geschick der Firma Parthen & Cie entlanghaspelt. Am meisten aber liebt es Roland, wenn sie, für gewöhnlich zwei- bis dreimal am Tag, nach einer Reihe von Gesprächen von ihrem Stuhl aufsteht und sich, von ihm aus gesehen im Profil, vor das große Panoramafenster stellt, die Hände auf das Fensterbrett gestützt, hinter ihr, in einer Ecke des Büros, das üppige Grün eines sorgfältig beschnittenen Baumes, dessen leicht gedrehter Stamm aus einem mächtigen Terrakotta-Topf emporwächst, ebenfalls eine Olive übrigens und neben der Eule der einzige Schmuck im ganzen Zimmer. Ihr Rücken ist gerade, der Blick nach vorn gerichtet, über das Wellblechdach der Werkstatt hinweg auf das Verwaltungshäuser-Meer des umliegenden Gewerbegebiets und sie wirkt versonnen und wach in Einem und in Rolands Planer und Zeichneraugen sieht sie, umrahmt von Stahlelementen, Glas und grünen Zweigen, aus, wie eine archaische Göttin inmitten einer Industriedesigner-Dekoration.
So sitzt und schaut und träumt der gute Mann also vor uns, auf seinem Stuhl. Ihm gegenüber sitzt und schaut, ebenfalls vor einem 21-Zöller sitzend, auch Katja, seine Assistentin, Katja übrigens mit kollegialem Du und auch ihre Blicke folgen aus beweglichen blauen Augen dem elastischen Gang ihrer Chefin nach, bevor sie dann wieder zurück an ihren Bildschirm wandern, aber sie träumt nicht, weil sie eine mit beiden Beinen in der Wirklichkeit stehende, nüchterne junge Frau ist, deren heitere, entspannten Züge den verträumt dasitzenden Roland Morgen für Morgen mit deutlicher Verlegenheit in die ebenso nüchterne Gegenwart zurückrufen, sobald sie ihm, geradeheraus, über die Kante ihres Schirms hinweg, in sein versunkenes Gesicht blickt. Ertappt wendet er sich dann rasch wieder seiner Arbeit zu, murmelt etwas unverständliches vor sich hin und verbirgt die in seinem Gesicht aufsteigende Röte hinter dem großen Rechteck mit 53cm Schutzdiagonale vor ihm auf dem Tisch.
Weiter hinten in dem großzügigen Raum, nun schon mit einigen Metern Abstand zu Esthers gläsernem Büro, heben und senken sich auch die Blicke von Tanja, der brünetten Buchhalterin mit den gepflegten, schlanken Fingern, die unwillkürlich jedesmal bei dieser Gelegenheit ihre mit großer Mühe vor einem ebenso großem Spiegel herausmodellierte Erscheinung mit der ihrer Chefin vergleicht, die von Klaus, einem solar-gebräunten Mittvierziger mit drahtiger Fitness-Studio Figur, dessen ziemlich glatter Humor und stromlinienförmige Freundlichkeit ihn zu einer idealen Besetzung am Telefon der Auftragsannahme machen und dessen Nase, geradeso wie die Rolands, allmorgendlich, ohne das er es bewusst registriert, dem feinen Duft aus Esthers edlen Flacons nachfolgt, schließlich auch noch die von Petra, der schweigsamen und etwas eigenbrötlerischen Dame für das Bestellwesen, deren strenge Kurzhaarfrisur ebenso pedantisch wirkt, wie die gesamte Person auch tatsächlich ist. Das einzig Anmutige an Petra ist vermutlich ihre Chefin. Und alle, wie sie dasitzen, hängen für ein paar Sekunden an der faszinierenden Erscheinung ihrer Chefin, der Meisterin, der Padronin, ehe sie die Köpfe wieder ihren Schreibtischen zuwenden und dabei unisono denken: Das ist unsere Esther, unsere Esther ist schön!
Sagte ich`s nicht?
Müßig durch die Gegend schlendernd, den Stock mit seinem gleichmäßigen Tacktack vor mir auf dem heißen Asphalt, die Sonne, die mich niemals blendet, warm in meinem Gesicht, sehe ich so manches, das Anderen verborgen bleibt, ganz einfach, weil sie sich dauernd für was anderes interessieren, als das, was direkt vor ihrer Nase liegt, weil ihre Augen und ihre Gedanken selten die gleiche Richtung haben und weil das helle Tageslicht ihren zarten Pupillen arg zu schaffen macht. Wer von euch Blinzelnden hätten zum Beispiel dieses schräg gekippte Fenster inmitten einer etwas trostlosen Backsteinfassade beachtet? Wem wäre aufgefallen, wie kalt an einem sonnenüberfluteten Tag wie heute eine völlig überflüssigerweise angeschaltete Neonröhre an der Decke des dahinterliegenden Raumes das Licht verfärbt? Wäre irgend jemanden jener weißbekittelte Rücken eines hageren Mannes mit kurz gestutztem, grauen Haar, der sich, vom Fensterrahmen ebenso weiß umrandet, über seinen Schreibtisch beugt, eines zweiten Blickes würdig erschienen? Mir sagen meine schärferen Sinne, dass hier was vor sich geht, das der Beachtung wert ist, das, sozusagen, in Augenschein genommen werden will, dass es verlohnt, das Ohr ein wenig näher an den Spalt zwischen dem gekippten Fenster und der tristen Mauer zu bringen und zu lauschen, was dort drinnen vor sich geht.
Da wäre also der besagte Kittel, in einer leichten Rundung über einen imponierenden Schreibtisch gebeugt, ein klobiges Ding, dessen hölzerne Masse in einem merkwürdigen Kontrast zu der schmalen Gestalt des Mannes steht, der, mit diesem Kittel behängt, dicht vor seiner Platte Platz genommen hat und, offensichtlich sehr konzentriert, in eine vor ihm aufgeschlagen liegende Akte starrt. Gegenüber, auf der anderen Seite des Tisches, sitzt, in bemerkenswert aufrechter Haltung, eine Frau mit weichen, vollen Wangen, aber sehr markantem Kinn und scharf geschnittener Nase, das Gesicht umrahmt von glattem, dunklem Haar, die Augen starr und weit geöffnet, den Blick, an dem Weißbekittelten vorbei, in die Ferne gerichtet. Während sie so regungslos dasitzt, dreht der Mann, mit einer irgendwie unruhigen Bewegung, unablässig eine massige Kunststoffbrille an den Bügeln zwischen seinen Fingern, verlangsamt aber schließlich die Drehung, senkt seine Hand hinunter auf die Akte und fährt, den Zeigefinger mit einem etwas nachlässig manikürtem Nagel lang ausgestreckt, suchend über ein paar Zeilen hinweg, wobei sein Kopf in einem eigenartigen Rhythmus abwechselnd nach unten zur Tischplatte und geradeaus zu seinem Gegenüber und wieder zurück geht, als betrachte er für einen Augenblick einen unsichtbaren Jojo. Ein schneller Blick, über die Schulter des Mannes hinweg in die offene Akte, läßt dem heimlichen Beobachter, der seinen Augen traut, gerade noch das Wort "Psychose" erkennen, ehe sich der weißbekittelte Rücken nach hinten lehnt und ihm die Sicht auf das Papier versperrt. Dafür kommt nun ein vorn auf dem Schreibtisch aufgestelltes Schild mit dem Aufdruck "Dr. Franz Eitmann" zum Vorschein, aber noch ehe wir uns über die Verbindung dieses Namens, oder besser: dieses Titels, zu der nun verdeckten Bezeichnung in der Akte austauschen könnten, hören wir den Doktor sprechen: "Wann sind sie denn gestern Abend zurück in die Klinik gekommen?" fragt er, doch der in die Ferne gerichtete Blick der Frau bleibt starr, als hätte sie ihn nicht gehört. "Frau König?" fragt er noch einmal und bewegt den gleichen langen Finger, mit dem er eben noch den klein gedruckten Zeilen in seinem Ordner gefolgt ist, nun dicht vor ihren Pupillen hin und her. "Frau König?" wiederholt er noch einmal und wendet sich dann seufzend von ihr ab und seiner Akte zu und beginnt mit einem schmalen Stift einige Notizen zu machen. Aha, psychotisch, denken wir, das passt ja hierher. Denn schließlich befindet sich hinter jener trostlosen Backsteinfassade, auf der hier draußen in sommerlicher Hitze die Mittagssonne gleißt, die Psychiatrische Klinik "St. Hildegard" und also erklärt sich auch dieser abwesende, faszinierende Blick der stillen, sphinxhaften Frau mit Namen König dort vor uns und vor Dr. Eitmann und wir wissen nun: die arme Person mit dem gleichzeitig weichen und strengen Gesicht - ist krank. Irre. Vielleicht sogar wahnsinnig. Mit noch gesteigerter Neugierde blicken wir in das kalt beleuchtete Zimmer hinein, wo unterdessen der Doktor aufgestanden ist, um seiner Patientin mit einer kleinen Lampe in die noch immer starren Pupillen zu leuchten. Dadurch ist nun auch der Blick auf den Aktenordner wieder frei, so das wir rasch erfahren können, dass Frau Maria König tatsächlich seit etlichen Jahren unter einer schweren psychotischen Störung leidet, deren Ursache leider im Dunklen liegt und derzufolge sie regelmässig und in Schüben Wahnvorstellungen hat, die sie in einen tranceartigen Zustand versetzen, in dem sie unansprechbar und starr ins Weite blickt, so wie eben jetzt, ohne jeden Sinn für ihre Umgebung. Oft unternimmt sie in diesem Zustand ziellose Wanderungen durch die Straßen der Stadt, bleibt hie und da ohne erkennbaren Anlass für lange Minuten stehen, spreizt die Arme in schrägem Winkel von ihrem aufgerichteten Körper ab, hebt den Blick nach oben, wie in Erwartung von etwas Himmlischen und setzt dann bald darauf mit gleichmässigem Schritt ihren unbewussten Spaziergang fort. Wieder zu sich gekomment kehrt sie, meistens gegen Abend, hierher, in die Psychiatrische Klinik St. Hildegard, zurück. Hin und wieder aber bleibt sie auch verloren auf irgend einer Parkbank oder an irgend einem Brunnenrand sitzend zurück, starrt mit weit geöffneten Augen in die längst hereingebrochene Nacht, schlaflos und ohne sich zu regen, bis der Morgen anbricht oder, was verschiedentlich schon vorgekommen ist, bis eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife sie findet und zurückbringt, denn den Beamten ist sie mittlerweile schon bekannt und man weiß daher, wohin sie gehört.
Leider schieben sich in diesem Moment Graukopf und Kittel wieder um den Schreibtisch herum und in das Blickfeld, so dass ein weiteres Studium der Akte nicht mehr möglich ist. Aber vermutlich hätte sich auch nicht mehr viel mehr aus der aufgeschlagenen Seite entnehmen lassen und es ist zweifelhaft, ob der Dr. Eitmann uns den Gefallen tut und sie umblättert, bevor er sich ein weiteres mal erhebt und aus dem Weg macht. Augenblicklich sitzt er jedenfalls beinahe so regungslos, wie sein starres Gegenüber und man muß schon einen tieferen Einblick in die Dinge haben, als einem die Sehkraft verleiht, um zu spüren, wie sehr sein Blick für eine ganze Weile an ihrer schlanken Erscheinung haftet, wohl wissend, wie unerreichbar diese Frau König gerade für ihn ist. Dennoch, oder gerade deshalb, schaut er still und unverwandt in Marias große, blaue Augen, die von irritierend gleicher Farbe sind, wie der abgetragene Regenmantel, den sie anhat und seinem Gesicht ist deutlich anzusehen, dass auch ihn die reglos vor ihm sitzende Frau auf besondere Weise fasziniert und ihn etwas in ihrem Wesen ganz offensichtlich mehr beschäftigt, als professionell nun eben gerade nötig. Seinen Gedanken nachhängend, liegt für einen Augenblick in seinen Augen ein ähnlich tranceartiger Ausdruck, wie in denen seines schweigenden Gegenübers. Sich einen plötzlichen Ruck gebend wendet er sich dann aber von Frau König ab und schaut noch eine ganze Weile in die vor ihm liegende Akte. Unbewegt schaut Maria König noch immer, an ihm vorbei, in eine weite Ferne.
Da erhob sich Maria, gab allen den Kuss und sprach zu den Brüdern: „Weint nicht, trauert nicht und zweifelt nicht, denn seine Huld wird mit euch sein und euch hüten. Lasst uns seine Größe rühmen, denn er hat uns hergerichtet und aus uns Menschen gemacht." Indem dies Maria sagte, wendete sie den Sinn derer, die ihr zuhörten, zum Guten, und sie begannen über die Worte des Retters miteinander zu reden. Petrus sprach zu Maria: „Schwester, wir alle wissen, dass der Retter dich lieber hatte als die anderen Frauen. Sage du uns Worte des Retters, derer du dich erinnerst und die du kennst, wir aber nicht, weil wir sie auch nicht gehört haben." Da fing sie an, ihnen diese Worte zu sagen: „Ich" sprach sie „ich sah den Herrn im Traum und sprach zu ihm: Herr ich sah dich heute in einem Traum! Er gab Antwort und sprach zu mir: Segen über dich, da du nicht strauchelst bei meinem Anblick. Denn wie euer Herz ist, wird auch eure Kraft zu sehen sein. Ich sprach zu ihm: Herr, sieht ein Mensch im Traum, den er sieht, durch die Seele oder durch den Geist? Der Retter gab Antwort und sprach: Er sieht weder durch die Seele noch durch den Geist, sondern durch die Mitte und von beidem sieht der Traum durch den Sinn."
Als Maria das gesagt hatte, schwieg sie. Dies war, was der Retter zu ihr geredet hatte. Andreas aber sprach dawider und sagte zu den Brüdern: „Sagt doch, wie denkt ihr über das, was sie gesagt hat? Ich glaube nicht, dass der Retter so geredet hat. Seine Lehren haben eine andere Bedeutung." Da redete Petrus dawider und fragte seine Brüder über den Retter: „Sollte er tatsächlich mit einer Frau allein gesprochen und uns ausgeschlossen haben? Sollten wir ihr etwa zunicken und alle auf sie hören? Hat er sie uns vorgezogen?" Da weinte Maria und sprach zu Petrus: „Mein Bruder Petrus, was sagst du da! Meinst du, ich hätte dies alles selbst ersonnen in meinem Herzen und würde so über den Retter lügen?"
Tja, wer würde so über den Retter lügen? Tatsächlich, nachweislich, eine ganze Menge Leute. Gelogen, Aussprüche erfunden, unterschlagen oder verfälscht, sie bei passender Gelegenheit auch ganz einfach ignoriert und dadurch um ihren Sinn gebracht, sie in ihrem Sinne umgedeutet und instrumentalisiert und das alles in der Regel aus dem einfachsten und naheliegensten Grund, den man sich denken kann: Weil es ihnen nützlich war. Für diese Erkenntnis braucht man sicher nicht erst großartig Geschichte zu studieren oder gar ein exotisches Fach, wie "Vergleichende Religionswissenschaft", wie eben hier, nicht weit von uns entfernt, diese junge Kandidatin, Cora Erdmann, gerade tut. Deren Interesse, beziehungsweise deren durch das Thema ihrer Magisterarbeit bestimmte, frischakademische Neugier, bezieht sich denn auch nicht auf eine Allerweltsfrage, wie ob auch in frühen, christlichen Gemeinden gelogen wurde, sondern auf den sehr viel spezifischeren Punkt, was die Lüge und was die Wahrheit mit dem Geschlecht eines Gemeindemitglieds zu tun hat und warum, beispielsweise, in der gerade vor ihr liegenden, alten koptischen Schrift, mit Namen "Evangelium der Maria Magdalena", Petrus, der Fels, seine Zweifel an Marias Aussagen so explizit mit der Tatsache verknüpft, dass sie eine Frau ist. "Petrus und Maria von Magdala - der Geschlechterkonflikt im frühen Christentum" heißt denn auch der Titel ihrer Arbeit und die darin getroffenen, vorderhand zur Erlangung der angestrebten akademischen Weihen gemachten, Aussagen enthalten, neben ihrem wissenschaftlichen Wert, unter uns gesagt, auch eine ganze Menge persönlichen Herzbluts der emsig lesenden und tippenden Studentin.
Maria aus Magdala: Legendäre Frau und Begleiterin des Messias, erste Empfängerin des österlichen Geheimnisses, Geist-Erfüllte und Begnadete, in der Gnosis erkenntnisreichste Jüngerin und Vermittlerin der wahren Botschaft, deren Verständnis der Lehre unbegrenzt ist, Geliebte des Herrn, die bis zum Tod an seinem Kreuz ausharrt, ja die eins ist mit ihm und unzertrennlich, eine Frau, kurzum, deren Bedeutung kaum übertrieben werden kann und die mehr als jede andere historische Persönlichkeit Cora Erdmanns Gemüt fasziniert und in Wallung bringt. Den mehr oder weniger expliziten Vorwurf der Lüge, von dem das Evangelium berichtet, nimmt die junge Frau aller gebotenen Neutralität und Sachlichkeit zum Trotz, daher auch ziemlich persönlich. Kann Maria Magdalena gelogen haben? Natürlich, sie ist ja eine Frau! Und hat darum bei den alten Juden zurecht von vornherein gar kein Zeugnisrecht. Und so kann es auch niemand ernsthaft erstaunen, dass die männlichen Jünger, wie Markus und Lukas berichten, ihr vorsichtshalber kein Wort glauben, als sie ihnen von dem leeren Grab und der Auferstehung berichtet. Sie halten die Nachricht für Geschwätz. Konsequenterweise erwähnt Paulus, als er in seinem Korintherbrief von den Auferstehungszeugen spricht, denn auch noch nicht einmal mehr ihren Namen, was ihm in Coras Augen recht gibt, wenn er weiter unten von sich selber sagt, er sei nicht wert ein Apostel genannt zu werden. Und doch wird gleichzeitig dieselbe Maria aus Magdala in allen Evangelien als eine Sehende und Erkennende geschildert und nicht, wie nur wenig später die Emmausjünger, die, mit Blindheit geschlagen, stundenlang neben dem Erlöser herlaufen und ihn trotzdem nicht erkennen. Sie sieht und sie erkennt und sie glaubt und die einzige männliche Figur, die in Coras Augen einen ähnlich überzeugenden Charakter hat, ist der ungläubige Thomas, der nichts sieht, nichts erkennt und niemanden glaubt, auch den versammelten Männern nicht. Ist immerhin auch eine Haltung.
Während Cora auf diese Weise damit beschäftigt ist, begleitet vom leisen Summen ihres Laptops, Blume für Blume alter koptischer Weisheiten zu pflücken, wobei sie von Zeit zu Zeit gedankenverloren eine lose Strähne ihres, in einem etwas mädchenhaft wirkenden Pferdeschwanz gehaltenen, blonden Haars hinter das rechte Ohr streicht, läßt am anderen Ende des Raumes, ebenso wohlgefällig wie unauffällig, Manfred Hades, ihr in der Fachwelt ziemlich bekannter Professor, seine Blicke auf ihr ruhen. Das ausgerechnet er, ein eigentlich in jeder Hinsicht ausgesprochen konservativer Mensch, dem sein tief in die Stirn hängendes, dunkles Haar und ein dichter Vollbart ein etwas finsteres und verschlossenes Äußeres verleihen, der hübschen Kandidatin ein so, wie er findet, dezidiertes Modethema genehmigt hat, kann sich Cora ohne weiteres als einen persönlichen Triumph auf ihre Fahne schreiben. Hades hält große Stücke auf diese junge Frau mit der unenthusiastischen Pferdeschwanzfrisur, der etwas rundlichen Figur und dem ausgeprägten Faible für Kleidung in einer Farbe, die zu ihrem Nachnamen in einer denkbar passenden Beziehung steht, zum einen, wegen ihrer wachen Intelligenz und schnellen Auffassungsgabe, zum anderen, wegen ihrer zurückhaltenden, beinahe etwas scheuen Umgangsformen und auch, nicht zuletzt, wegen ihrer, nach seiner Auffassung, ganz allgemein bestechenden Weiblichkeit und weil der Professor, zugegebenermassen, überhaupt einen ausgesprochenen Hang zu jungen Frauen mit rundlicher Figur und blonden Pferdeschwänzen zu seinen Eigenarten rechnen muß.
Außerdem hat das Thema, das Cora - wie er sie, um eine gewisse joviale Vertraulichkeit zum Ausdruck zu bringen, seit ein paar Wochen zu nennen sich erlaubt hat, Cora natürlich mit Sie - ihm da vorgelegt und abgerungen hat, tatsächlich, bei Licht besehen, einen besonderen, sagen wir strategischen Reiz, von dem Cora selbst gar nichts wissen kann: Christus und die Frauen - für ihn ein nicht mehr neues und seit den frühen Achtzigern etwas reichlich beackertes Feld, dennoch insbesondere bei den feministisch inspirierten jungen Theologinnen bis heute äußerst beliebt. Auch noch nicht gänzlich ausgeschöpft, wie er gern bereit ist zuzugeben, auch wenn er persönlich mit dem ganzen Genderscheiß, wie er diesen Zug der Zeit im privaten gern zu nennen pflegt, eigentlich nichts am Hut hat. Der eigentliche, feine Wert dieser Arbeit liegt denn auch für ihn weniger im Zugewinn an wissenschaftlicher Erkenntnis, als auf einem anderen, sehr viel naheliegenderem Gebiet: Die akribische und mit Sicherheit auf blitzblanker Exegese fußende Arbeit unter seiner Ägide bietet dem Professor nämlich eine willkommene Gelegenheit, die wenig geschätzte, weil in eben dieser Richtung nur zu gerne und für seinen Geschmack bei weitem zu tendentiös forschende Kollegin, Frau Professor Ursula Laponte, sozusagen auf deren ureigenem Gebiet ein wenig auszustechen und vorzuführen. Die Kollegin Laponte, die ihn, zu seinem dauernden Ärger, in Besprechungen wegen seiner bekannt konservativen Einstellung und gelegentlich etwas knurrigen Art oft und gerne foppt und ihn mit der dadurch provozierten, selbstverständlich unterdrückten Heiterkeit aufs unangenehmste berührt, Frau Laponte also ist, nebenbei bemerkt, eine Frau, für deren spezielle Art Weiblichkeit der Profossor nun gerade gar kein Faible hat. Die Aussicht, die selbstgefälligen Gesichtszüge dieser Kollegin, deren vornehmlich weibliche Kandidatinnen sich natürlich ausgiebigst auf dem nämlichen Gebiet herumtummeln, durch die Vorlage dieser unerwarteten Magisterarbeit einmal richtig gelängt und entglitten zu sehen erfüllt unseren Mann mit einer diebischen Vorfreude. Die Genehmigung des Themas, wiewohl mit der gebotenen Zurückhaltung erteilt, kommt insofern aus vollem Herzen und aus dem gleichen Grund darf man auch die Blicke, die er quer durch die Bibliothek auf die eifrig schreibende Cora wirft, in mehrfacher Hinsicht als aus dem Herzen kommend bezeichnen.
Solchen Gedanken hinter seiner haarigen Stirne nachhängend, überrollt den Professor eine angenehme Welle der Sympathie. Einem inneren Impuls folgend, erhebt sich der massige Mann von seinem Stuhl, faltet seiner Gewohnheit gemäß die Hände auf dem Rücken und überwindet die kurze Distanz bis zu der jungen Kandidatin mit gemessenem Schritt und leicht nach vorne gebeugtem Oberkörper. Weitläufig umkreist er ihren Schreibtisch und bleibt dann in einigem Abstand hinter ihrem Rücken stehen, um, noch ein wenig weiter vorgebeugt, gemeinsam mit Cora in deren Bildschirm zu schauen. "Na, junge Frau," spricht er dann in beiläufigem Ton, "wie kommen Sie vom Fleck?"