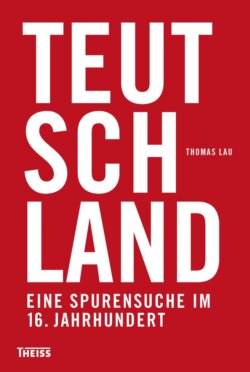Читать книгу Teutschland - Thomas Lau - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[Menü]
„TEUTSCHLAND“ – EINE SPURENSUCHE
Der Chronist zog eine deprimierende Bilanz. Neunhundert Jahre Krieg gegen die Muslime hatten die Christenheit von einer Niederlage zur nächsten geführt. Unendlich viel Blut war vergossen worden: Königreiche, Völker und Länder gingen dennoch verloren. Der Zorn der Heiden hatte nichts an Schärfe verloren. Ihre Eroberungszüge bedrohten nun die letzten Zufluchtsstätten der Christenheit. Europa schien dem Untergang geweiht zu sein.
So groß das Unglück, so erstaunlich war die Blindheit und Verstocktheit der geschlagenen Sünder. Ungerechtigkeit und Habgier, Eigennutz und Gottesferne – all jene teuflischen Triebe, die das Unglück verschuldet hatten, verseuchten die Christenheit nach wie vor. Der Verlust der alten Tugenden und die Blindheit gegen die Lehren der Geschichte zogen die Europäer immer weiter in den Strudel der Katastrophe hinein. Gott wird nicht eher seine Geißel ruhen lassen, bis man in den Spiegel der Wahrheit schaut und die Kräfte der Sünde mit Stumpf und Stil ausrottet. Geschichtsschreibung, so erklärte Johannes Thurmeier alias Aventinus im Vorwort seiner bayerischen Chronik aus dem Jahre 1526, soll dem Leser daher nicht schmeicheln, sondern ihm einen Spiegel vorhalten. Sie soll ihn belehren und ihm einen Ausweg aus einer schwierigen Situation weisen.
Durch akribische Auswertung von Dokumenten, Annalen, Bildern und weiteren Quellen will Aventinus das Dunkel erhellen, und er weiß fürwahr Erstaunliches zu berichten. Während alle Welt sich den Heldentaten der Juden, der Römer, der Griechen oder der Perser zuwendet, war die Geschichte des wichtigsten und glorreichsten Volkes der Erde bislang unerzählt geblieben – die der Deutschen und ihres vornehmsten Stammes, der Bayern. Noah selbst habe seinen Sohn Tuiscon – den Stammvater aller Deutschen – nach Norden entsandt, um einen Idealstaat zu gründen. Der Erfolg des Unternehmens war offenkundig: Die wilden Germanen brachten einen Heldenkönig nach dem anderen hervor, sie vereinten Gottesnähe, Bildung und Natürlichkeit miteinander. Siegreich überzogen sie den Kontinent mit Krieg. Bedroht wurde die Nation der edlen Wilden lediglich durch das Virus der römischen Dekadenz. Die französischen Brüder waren ihm bereits anheimgefallen. Nun hatte der Krankheitserreger seine Attacken auf Deutschland ausgedehnt. Es war daher an der Zeit, dass sich das Stammland der Germanen unter der Führung Bayerns wieder seiner sittlichen Wurzeln erinnerte. Kein Feind, weder Franzosen noch Türken, konnte den Deutschen dann noch widerstehen.
Das zunächst in lateinischer, später in deutscher Sprache erschienene Werk wurde von den humanistischen Freunden des Autors mit Begeisterung aufgenommen. Aventinus galt ihnen als einer der hervorragendsten Gelehrten seiner Zeit, als ein Mann, der völlig neue Aspekte der Geschichte Deutschlands zutage gefördert hatte. Deutschland – dieses Wort wurde von Aventinus mit erstaunlicher Geläufigkeit verwendet. Die Existenz einer deutschen Nation, die eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Tugenden, ein gemeinsames Vaterland besaß, schien für ihn – und nicht nur für ihn – außer Frage zu stehen.
Für national gesinnte Historiker des 19. Jahrhunderts waren dergleichen Bekenntnisse der Humanisten ein wahrer Glücksfall, schienen sie doch die These von der natürlichen, weit in die Geschichte zurückzuverfolgenden Existenz der Nation zu bestätigen. Im 16. Jahrhundert sei sie sich zum ersten Male ihrer selbst bewusst geworden. Dass dieses Bewusstsein sich gegen Rom wandte, gegen den welschen Tand, wurde in Zeiten des Kulturkampfes als weitere Bestätigung des eigenen Geschichtsbildes wahrgenommen. Der Kampf der deutschen Kaiser des Mittelalters fand hier, so frohlockte man, eine ideologisch reflektierte Fortsetzung. Leopold von Ranke wusste das 16. Jahrhundert als deutsches Drama zu inszenieren. Das um seine sittliche Gestalt und seine staatliche Einheit ringende Deutschland wurde weltgeschichtliche Bühne und kollektiver Akteur in einem. Was die Humanisten erstmals formulierten, wurde dabei von einem deutschen Heros aufgenommen, der Gelehrsamkeit und – so frohlockte man – deutsche Innerlichkeit zugleich verkörperte. Martin Luther, der deutsche Revolutionär, war Taktgeber einer Umwälzung, die die Nation in das Licht der Moderne führte und zugleich in die erste nationale Katastrophe. Thesenanschlag und Westfälischer Friede, deutsche Heldentat und deutsches Trauma bildeten in diesem Geschichtsbild gleichsam die Eckpunkte eines zentralen Abschnitts der deutschen Nationalgeschichte.
Sicher, es gab auch andere Stimmen. Ernst Troeltsch und Max Weber etwa hatten schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in höchst gegensätzlicher Weise die europäischen Wirkungen der Wittenberger Reformation hervorgehoben und deren Bedeutung zugleich relativiert. Dergleichen Stimmen blieben zwar nicht ungehört, ihre volle Wirkungsmacht entfalteten sie aber erst, als die Auflösungserscheinungen der europäischen Nationalstaaten evident wurden.
Angesichts der zunehmenden Bedeutung multinationaler Strukturen und des wachsenden Interesses für außereuropäische Entwicklungen ist der Blick auf die Nation in den Jahren nach 1945 deutlich distanzierter geworden. Dass sie eine natürlich gewachsene Einheit darstellt und dass der aus ihr entspringende Nationalstaat der Königsweg in die Moderne ist, wurde von der Forschung als historischer Mythos entlarvt. Nationen, darin ist sich die jüngere Forschung einig, sind gedankliche Bastelarbeiten. Sie entstammen dem Hirn von Ideologieschmieden, die einer Gesellschaft neue Deutungen der Realität anbieten. Die Zahl der Konstrukteure und der von ihnen entworfenen unterschiedlichen Vorstellungen von der Nation ist unüberschaubar groß. Was Deutschland ausmacht, was es kennzeichnet, wie es handeln soll, in welche Strukturen es eingebettet ist, darüber herrschte und herrscht auf dem Markt der Ideen ein ohrenbetäubender Streit. Nur in einem Punkt sind die Möchtegernväter des Vaterlandes sich einig – und zwar darin, dass die Welt sich in exklusive Gemeinschaften von Menschen gliedert, in Nationen, deren Bindungen von unzerreißbarer Stärke sind. Es ist eine Grundüberzeugung, die in Europa im Zuge der politischen und industriellen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts immer stärker Fuß fasste und schließlich zu einem über alle sozialen Schichten hinweg akzeptierten Faktum wurde. Doch was ist mit der Zeit davor? Wenn Nationen Produkt einer auf die Bedürfnisse einer sich industrialisierenden Gesellschaft zugeschnittenen Ideologie sind, was ist dann mit dem Begriff „teutsche Nation“ im 16. oder 17. Jahrhundert gemeint?
Das Beispiel des Aventinus demonstriert, dass das Sprechen über Deutschland, das Entwerfen von Deutschlandbildern schon lange vor dem Siegeszug des Nationalismus einsetzte. Bevor in Museen, Opern, Gedenkstätten, Schulen und Kasernen der Glaube an die Nation eingeübt wurde, produzierten Gelehrte Appelle an alle deutschen Söhne und Reflexionen über die deutsche Geschichte.
Deutschland, das war für Aventinus zunächst einmal eine Nation, die sich auf gemeinsame Ahnen, eine gemeinsame Geschichte und damit auch auf einen gemeinsamen Schatz unvergesslicher Ruhmestaten berufen konnte. Sie war Quell der Ehre für alle deutschen Stände und zugleich ein Schlachtfeld ständischer Profilierung. Doch Deutschland repräsentierte noch mehr. Es war dem Chronisten eine von Gott geschaffene Einheit, ein erwähltes Volk, das die Christenheit rettete. Das Ringen um die rechte Gestalt der Kirche, um die Verteidigung der wahren Heilsbotschaft, war für den bayerischen Chronisten – und nicht nur für ihn – zugleich eine Frage nationaler Selbstbestimmung. Dass der Kaiser in dieser Frage ein gewichtiges Wort mitzureden hatte, ja dass die Nation letztlich nur durch sein Wirken zusammengehalten wurde, bedurfte für ihn keiner weiteren Diskussion. Deutschland und das Reich waren für ihn eine untrennbare Einheit. Das Imperium, in dem neben Bayern und Franken auch Slowenen, Niederländer, Burgunder, Flamen, nicht aber Königsberger oder Schleswiger Platz fanden, geriet in der Chronik der Bayern zu einem exklusiven deutschen Herrschaftsverband.
Der Begriff „Teutschland“ war in seiner Bedeutung an epochenspezifische Strukturen rückgebunden. Welche Bindungswirkungen die neu erfundene deutsche Geblütsnation entfalten konnte, wie Vergangenheit und Zukunft der Germania Sacra, der „teutschen“ Reichskirche, aussahen und wie die künftige Struktur des Reiches zu gestalten war – all dies war gleichermaßen umstritten. Die drei Deutschlandbilder des Aventinus beschreiben damit zentrale Konfliktfelder des 16. und 17. Jahrhunderts. Verbunden wurden sie – wie sich in seiner Chronik andeutet – durch den Versuch der Streitenden, ihre jeweilige Position mit dem Hinweis auf das Wohl und Wehe der Nation zu rechtfertigen. Ein verändertes Reden über die Nation spiegelte zugleich sich wandelnde gesellschaftliche, kirchliche und politische Ordnungsvorstellungen wider. Konfessionalisierung, Reichsverdichtung und die Konstruktion neuer Nationenbilder hingen eng miteinander zusammen. Die Wechselwirkungen, denen diese Prozesse unterlagen, und die Protagonisten, die sie prägten, sollen im Mittelpunkt der folgenden Studie stehen. Sie versteht sich als Spurensuche, die keine vorschnellen Kontinuitäten zwischen dem Reich und moderner Staatlichkeit, zwischen dem konfessionellen Gegensatz der Frühen Neuzeit und der Moderne, dem humanistischen Reden über die Nation und den nationalen Großmachtträumen des 19.und 20. Jahrhunderts herstellen soll. Die Umgestaltung und Neuformierung eines Raumes, der zwischen 1500 und 1648 mit zunehmender Selbstverständlichkeit als „Teutschland“ bezeichnet wurde, soll vielmehr in all ihrer Widersprüchlichkeit analysiert werden.