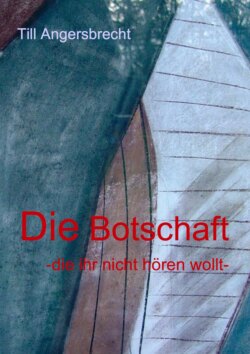Читать книгу Die Botschaft - Till Angersbrecht - Страница 4
Die Kindheit eines großen Mannes
ОглавлениеBotschaft an den Herrn Astrohom Professor Dr. Waldmir Schdruschka und seine Gäste!
Sie sind uns seit längerem gut bekannt, hochverehrter Professor, wie ein gieriger Säugling an der Mutterbrust haben Sie lang und ausgiebig an unserer himmlischen Sphäre gesogen. Mit Ihrem letzten Buch „Die Omega Welt“, das bei uns hier oben eine gewisse Beachtung fand, sind Sie uns endgültig nahe getreten, in Wahrheit viel zu nahe, denn voller Irrtümer steckt das Buch, voller unausgegorener Halbwahrheiten, die man Ihnen hier oben nur deshalb verzeiht, weil wir Mitleid mit Ihnen empfinden: Forschung und Wissenschaft stehen bei Ihnen ja immer noch auf niedrigstem Niveau – was hätten wir da Besseres aus Ihrer Feder erwarten können?
Sie sind begierig herauszufinden, wer wir waren und wer wir sind, natürlich, das wollen so viele andere ebenso gerne wissen. Ihre Neugierde ist begreiflich, wenn auch reichlich vermessen. Haben Sie sich selbst denn schon ausreichend erkannt, um sich an der Erkenntnis höherer Wesen von unserer Art zu versuchen? Bevor Sie sich auf ein so gefährliches Wagnis einlassen, sollten Sie sich erst einmal um die Selbsterkenntnis bemühen: Gnoti sauton!, wie Ihre Gelehrten es nennen. Fragen Sie sich, wer Sie sind, fragen Sie nach dem Wesen Ihrer Mitgeschöpfe.
Bei euch fehlt es bis heute an dieser längst fälligen Selbsterkenntnis. Deswegen unsere Botschaft, mit der wir euch ein Gleichnis schenken, damit ihr darin wie in einem Spiegel das eigene Wesen erschaut. Wir reden von einem Himmelskörper, der euch nicht ganz unbekannt vorkommen wird, da er dem eurigen in vieler Hinsicht so ähnlich ist, dass man beide miteinander verwechseln könnte. Er heißt XZ716qgrün - nennt ihn nur einfach Grün! -, wo wir die beiden Reiche Tatu und Tata aufsuchen, die sich auf ihm die Herrschaft teilen. Es ist unser höchster Wille, Herr Professor, dass sich Kunst, Wissenschaft, Öffentlichkeit und Theologie bei Ihnen versammeln und bei der Verlesung unserer Botschaft anwesend sind. Niemand soll sich später damit herausreden können, er habe wieder einmal von gar nichts gewusst. Wir selbst werden dafür sorgen, dass die von Ihnen Geladenen sich unwiderstehlich getrieben fühlen, zu dieser Verabredung zu erscheinen.
Toller Anfang!, Gernegut lacht, wie ein Schuljunge, dem man gerade einen unanständigen Witz ins Ohr tuschelt, ich meine, er lacht übertrieben laut und mit unüberhörbarer Verlegenheit, während mir ein Schauer über den Rücken läuft. Ja, die hysterische Reaktion des Schriftstellers verstehe ich nur zu gut. Mir ist ganz heiß geworden. Der Anfang ist ja wirklich toll im wortwörtlichen Sinn, man kann es mit der Angst bekommen. Ich begreife jetzt, warum Schdruschka uns eine so ernste Rede hielt.
Jedem von uns blickt Teddy Gernegut der Reihe nach ins Gesicht.
Alles vollkommen wahr; eigentlich wollte ich gar nicht kommen. Im Augenblick habe ich nämlich wirklich sehr viel zu tun, ein neues Buch, wie Sie sich denken können, aber ich spürte so einen seltsamen inneren Zwang. Es half nicht, dass ich dagegen kämpfte, irgendetwas war stärker als ich, und ich musste mich auf den Weg machen. Umso toller der Anfang dieser Botschaft; ihre Absender klären uns gleich zu Beginn darüber auf, dass sie in das Neuronengeflecht unseres Neocortex eindringen, um uns von oben zu dirigieren. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll?
Mit dem Ausdruck verschreckter Hilflosigkeit blickt Gernegut in die Runde. Auch in dem Prälaten scheint etwas vorzugehen, seine Stirn wirft eine Reihe sehr ernster Falten. Nur Platsch schaut grimmig an uns vorbei und schweigt. Eveline setzt sich über die allgemeine Verwirrung hinweg, die gleichmäßige Stimme, mit der sie die Lektüre fortsetzt, verrät nichts von innerer Unruhe. Unbegreiflich: Die seltsame Ruhe dieser Frau, die mir seit zehn Jahren zum ersten Mal wieder gegenübersitzt, geradeso als wäre nichts geschehen, erscheint mir noch viel unheimlicher als jede noch so seltsame Botschaft.
Wir - Beobachter, die selbst die Unbeobachteten sind - haben die Zeit gesiebt und die Räume verdichtet, das Leben durchleuchten wir, seine Essenz destillierend. Die Essenz des Lebens ist Freiheit, die allen Wesen auf allen Himmelskörpern als Geschenk zugeteilt wird. Die Freiheit soll Schauspiel sein, an dem die unbeobachteten Beobachter sich erfeuen. Freiheit ist Vielgestalt, Wagnis, Entfaltung, Evolution, Bewegung, Anfang und Ziel. Wir haben das Schauspiel eine Zeitlang genossen, uns sogar in Ruhe gewiegt, weil alles zum Besseren und schließlich in Richtung des Besten zu laufen schien. Das Ziel stand ja von vornherein fest: der Punkt Omega größter Vollkommenheit, auf den das Universum sich gleichmäßig zubewegt.
Doch dann haben wir plötzlich begreifen müssen: Der Punkt Omega wurde nirgends und niemals erreicht. Wir, die ungesehenen Seher, haben uns in trügerischer Ruhe gewiegt, das war unser Fehler, denn die Freiheit hat den Keim des Bösen hervorgebracht und zu immer schnellerem Wachstum getrieben. Das Böse gedeiht in Tatu ebenso wie in Tata, und wir haben Grund zu der Befürchtung, dass dieser Keim das ganze All infiziert. Mit der Geschwindigkeit des Lichts droht er von Himmelskörper zu Himmelskörper zu springen. Daher greifen wir ein, jetzt, bevor es zu spät ist.
Fürchten braucht ihr euch nicht – noch nicht. Lehnt euch zurück. Alles beginnt völlig harmlos mit einer Familie, der Familie Bubbo, eine der ältesten und angesehensten auf Tatu. Ihr werdet sehen, in Tatu geht es durchaus nicht anders zu als auf vielen anderen Planeten, euren eigenen eingeschlossen. Die dort heimischen Wesen sind redlich bemüht, sich mit einigem Anstand durchs Leben zu schlagen, wobei es den meisten von ihnen allerdings weniger darum geht, anständig zu sein, als anständig zu scheinen, nämlich bei ihren Nachbarn und sonstigen Mitmenschen. Diese Beobachtung trifft auch auf Ronald Bubbo zu, den seine Mitbürger für ein leuchtendes Vorbild der Anständigkeit halten, weil er dieses Wort auch stets im Munde führt. Ein Mann muss das Herz auf dem rechten Fleck haben, so sagt er es oft und gern in seiner Gemeinde. Dieses Bekenntnis hindert Ronald Bubbo jedoch keineswegs daran, sich hinter der glänzenden Fassade seiner Rechtschaffenheit allerlei Verstöße gegen Recht und gute Sitte zu leisten. Soeben hat er zum Beispiel einen Anruf von einem jener besonderen Freunde erhalten, ohne die im Staate Tatu niemand zu Geld und Macht gelangt.
Die Nachricht des Freundes war knapp und für Außenstehende schlicht sibyllinisch: „Nasse Bären kriegen im Sommer sehr viele Junge.“
Niemand anders hätte damit etwas anzufangen gewusst, nicht so Roland Bubbo. Dieser verstand auf Anhieb, was der liebe Freund sagen wollte, denn er klatschte sich mit der Hand auf die Schenkel. Danach befahl er seinem Sekretär, umgehend für eine Million Bolzen – eine durchaus erkleckliche Summe - Aktien der Firma Bear in Nasstal aufzukaufen: Sie würden sich in kurzer Zeit ganz toll vermehren.
Der Tag hatte für den alten Bubbo also unter den besten Vorzeichen begonnen. Kein Wunder, dass er beim Mittagessen im trauten Kreis seiner Lieben immer noch bester Laune war. Die Familie war um ihn versammelt, und das verschaffte ihm stets tiefe Befriedigung, denn wie für jeden von Grund auf anständigen Menschen in Tatu war die Familie auch für Roland Bubbo schlechterdings heilig. Zu seiner aufgeräumten Gemütsverfassung trug aber noch ein weiterer Umstand bei: Craigh Dittlick war heute bei ihnen zu Gast war, ein Mann, dem sein ganz besonderes Wohlwollen galt. Weilte Dittlick in seiner Nähe, so drängte sich dem Geschäftsmann immer derselbe Gedanke auf: ein hervorragender, ein außerordentlicher, ein verehrungswürdiger Mann und noch dazu ein überlegener Denker. Dieser Dittlick weiß einfach alles zusammen. Erstaunlich, dachte Ronald Bubbo, dass es solche Menschen überhaupt gibt! Dabei ist er keiner von diesen ewig mäkelnden, schwatzenden Eierköpfen, vor denen sich jeder anständige Mensch besser in Acht nimmt. Dittlick hat nichts von einem schwafelnden Besserwisser, er ist ein Mann mit Charakter, das Herz auf dem richtigen Fleck. Steht ganz auf unserer Seite, einfach ein toller Mann. Denn wer Dittlick auf seiner Seite hat, der braucht sich vor nichts und niemandem zu fürchten.
Ronald Bubbo war ein stämmiger, rothaariger Mann, der den Freuden der Tafel gern und ausgiebig zugetan war. In seinen Augen gab es eigentlich nur einen einzigen Makel, den man an Dittlick kritisieren konnte: Das war sein reichlich lang gezogener Körper. Man hätte den Mann durch ein Nadelöhr ziehen können. Für seinen Geschmack war Craigh einfach zu dürr. Ein anständiger Mensch muss mit einer gewissen Körperfülle vor die Welt treten können, das verleiht seiner Person Standfestigkeit und seiner Rede Gewicht – so Ronald Bubbos Überzeugung. Doch gerade weil er in diesem Punkt echtes Bedauern mit seinem dürren Freund Dittlick empfand, erblickte er in diesem Mangel einen weiteren Grund, ihn möglichst oft zu sich einzuladen. Wer auf dem Land lebt, weiß, wie man so einem Gebrechen bei Gänsen und anderem Federvieh abhilft, was bei denen gelingt, müsste doch schließlich auch bei Craigh Dittlick anschlagen! Sie würden ihn solange stopfen, bis der Segen des Herrn sich schließlich auch sichtbar auf seine Figur erstreckt.
Denn natürlich war die Tafel bei den Bubbos stets reichlich, man darf sogar sagen, üppig gedeckt. Dittlick ließ sich auch durchaus nicht besonders drängen, wenn Daphne ihn mit den unterschiedlichsten Köstlichkeiten verwöhnte: mit Rumpsteak, Fasan, geschmorter Wildente oder gebratenem Perlhuhn. Man tat also wirklich alles für den künftigen Segen des Herrn. Doch leider hatte das reichliche Angebot an seiner allzu schmächtigen Gestalt bisher keine erkennbaren Änderungen bewirkt. Insgeheim schüttelte der alte Bubbo manchmal missbilligend den Kopf: Es war, als wenn die Gesetze, die für Gänse und anderes Federvieh galten, an seinem gelehrten Freund wirkungslos abprallen würden.
Wie schon gesagt, befand sich Ronald Bubbo an diesem Tag dennoch in bester Laune, weil die Nachricht von den nassen Bären und ihren vielen Jungen seine Kasse wiederum wesentlich aufbessern würde. Er hätte Grund, mit sich und der Welt rundum zufrieden zu sein, wäre da nicht sein Kind, der kleine Bubbo gewesen, der dem Alten auch jetzt wieder Sorgen machte, weil er es schwer ertrug, dass sein Kind die Augen so schüchtern zu Boden schlug.
Blickt auch heute wieder so ängstlich auf die Diele, ärgerte sich der Familienvater, gerade so, als gäbe es dort etwas Besonderes zu entdecken. Wie oft habe ich Daphne schon gesagt: Ein echter Junge und richtiger Bubbo, der richtet die Augen nach oben, gerad ins Gesicht muss er seinem Gegenüber schauen! Soll er ruhig mal trotzig sein, den Tisch umwerfen, eine Vase zerdeppern oder dem alten Diener einen Schlag in den Bauch versetzen. Das macht jeder Junge, das ist normal, die müssen sich doch erst noch die Hörner abstoßen. Ich selbst ging schon mit fünf oder sechs auf die Jagd, ich weiß noch gut, dass meine Steinschleuder mich überall hin begleiten musste. Kann mich noch heute genau erinnern. Den ersten Spatz habe ich im Winter vom Baum geschossen, da war ich Häuptling aller Banditen und gerade fünf Jahre alt. Und der alten Liesi habe ich mit dem Katapult einen Stein auf den Hintern geknallt, dass sie auf einmal hüpfte wie eine Gazelle. Es war eine Freude, das anzusehen, auch wenn es danach keine Freude war, wie man mich mit dem Lederriemen versohlte. Aber unser John, der rührt die Schleuder nicht an, die ich ihm schon im letzten Jahr schenkte. Merkwürdiges Kind, irgendwie aus der Art geschlagen. Gefällt mir überhaupt nicht, vermutlich schadet ihm der dauernde weibliche Umgang.
Das ist es. Die Frauen verziehen das Kind. Ein echter Bubbo, der muss ganz anders als unser John auftreten. Ich habe es Daphne immer wieder gesagt. Siegen kann bei uns nur, wer sich schon in der Jugend als Sieger übt.
Na ja, jetzt habe ich den alten Tammel auf den Jungen angesetzt. Der soll dem Kleinen das Reiten beibringen und, wenn möglich, auch anständige Manieren. Gerade stehen, wenn man mit ihm spricht, Blick nach vorn gerichtet, die Hände nicht in der Hosentasche und nicht so weichlich mit den Armen geschlenkert. Er ist acht Jahre alt, da kann man das ja wohl verlangen. Wenn er erst draußen über die Gräben springt und mit der Flinte auf Hasen und Füchse schießt, wird er lernen, wie ein Mann sich benehmen muss. Pferde sind das beste Erziehungsmittel, das haben schon die alten Aristokraten gewusst. Der Tammel soll dem Jungen mit den Pferden Schneid beibringen. Verdammt nochmal, wenn das nicht in den Genen der Bubbos liegt!
Wenn der alte Ronald Bubbo einmal unversehens ins Nachdenken geriet, trat ihm der Schweiß auf die Stirn, und eigentlich fühlte er sich unwohl bei solchen Anstrengungen; da war es für ihn eine befreiende Aufforderung, dass Daphne den Teller mit der gerösteten Hühnerkeule soeben vor ihn hingestellt hatte. Befriedigt angelte er sie aus dem Geschirr und biss mit der ganzen Kraft seiner Kiefern hinein.
Jetzt geriet sein Denken denn doch wieder in wohltuende Bahnen.
Prima, ging es ihm durch den Kopf. Sie ist rostbraun, diese Keule, und die Haut so krosch, wie ich sie liebe.
Ronald Bubbo liebte die knusprig gebratene Hühnerkeule so sehr, dass ihm die Soße auf den Latz hinuntertropfte. Genüsslich schmatzte er beim Kauen, denn er hatte es gern, wenn seine Umgebung sich auch akustisch am eigenen Behagen erfreute. Überhaupt war seine Weltanschauung in diesem Punkt ganz auf die Nächstenliebe fixiert: Wenn es dir gut geht, dann zeig das den anderen. Mögen sich alle in deiner strahlenden Sonne baden! Verkniffene Leute, Mäkelnaturen und Defätisten, die laufen doch in der freien Natur ohnehin massenweise herum, eine richtige Umweltplage; solche Leute sinnen stets darauf, wie sie einem anständigen Menschen die gute Laune vermiesen. Da ist es doppelt richtig, dass jeder Mensch, auf dem sichtbar der Segen Gottes ruht, der ganzen Welt das eigene Wohlbehagen beweist.
Lurry, rief er der Köchin zu. Bravo, heute hast du das Federvieh wieder ganz nach meinem Geschmack zubereitet!
Lurry war erst seit zwei Wochen bei ihnen zu Dienst, aber bisher gab es absolut nichts an der Köchin zu tadeln. Wenn es aber etwas zu loben gibt, so soll ein anständiger Mensch aus seinem Herzen keine Mördergrube machen.
Ronald blickte zu Daphne, seiner Frau, hinüber.
Und was ist mit Dir? Welche Laus kriecht dir denn heute wieder über die Leber? Du siehst ja aus wie die Klageweiber auf einer Beerdigung. Lauter Sorgenfalten im Gesicht, du bist ja nicht anzuschauen, am liebsten würde ich deine Stirn mit einem Bügeleisen traktieren. Habe ich euch nicht immer wieder gesagt, dass in unserer Familie alle zufrieden und glücklich sind! Traurige Gesichter kann ich nicht leiden, das weißt Du - schon gar nicht beim Mittagessen!
Der alte Bubbo ließ die angenagte Keule missmutig in den Teller sinken.
Die Armen!, sagte seine Frau, die Armen! Schau her, es steht in der Zeitung, und sie reichte ihm die aufgeschlagene „Hauptstadtpost“ über den Tisch.
„Über tausend Menschen verhungert. Sozialdienste haben versagt!“
Ronald schüttelte missmutig den Kopf.
Ja, ja, ich weiß schon. Hältst mich für zu dumm, um die Zeitung selbst zu studieren? Solches Zeug liest man in diesem Eierkopfblatt doch beinahe täglich. Gestern hat es irgendwo auf der Rückseite unserer Kugel, weiß der Teufel, wo es genau war, ein Erdbeben gegeben, vorgestern ist in unserem Nachbarland ein Meteorit niedergegangen, morgen wird bei uns irgendein Flugzeug abstürzen. Na, und all die Scholtis und Doltis sterben sowieso am laufenden Band. Wenn du vorhast, mir jeden Tag ein neues Jammerlied vorzusingen, dann sind wir geschiedene Leute. Warum sagst du mir nichts davon, dass bei uns in Tatu gerade so und so viele süße kleine Babys geboren werden, vielleicht eines von ihnen sogar ein Genie? Warum redest du nicht davon, dass unseren Forschern Tag für Tag die gewaltigsten Entdeckungen gelingen? Stattdessen dieses dauernde Gejammer: „Wieder tausend Menschen verhungert!“, nur um mir, deinem Ehemann, beim Mittagessen den Appetit zu vergällen. Ich sage dir, solche Neuigkeiten gehören nun einmal zum Lauf der Dinge. Das ist so und das wird immer so sein, daran können und werden wir nichts ändern. Du hast mir richtig das Mittagessen verdorben!
Ronald Bubbo schlug mit Verdruss die flache Hand auf den Tisch und schaute drohend in die Runde. Wenn der Alte sich aufregte, dann bebten die Wände, lief ein Zittern durch die Familie einschließlich des Personals. Jeder fürchtete, Ronald Bubbos Unmut zu erregen, aber es gab außerdem noch Grund, um für ihn selbst zu fürchten. Seinen allzu geröteten Wangen war der hohe Blutdruck ja schon von weitem anzusehen. Aber sie wurden erst richtig rot, wenn ihm, so wie gerade in diesem Augenblick, das Blut zu Kopfe schoss.
In schwierigen Momenten wie diesen war es ein großes Glück, dass ein Mann wie Craigh Dittlick bei ihnen am Tisch saß, eine Autorität, auf deren salomonisches Urteil man sich verlassen konnte! Seltsam, so war es Bubbo immer erschienen: Zu viel Verstand, das versaut doch gewöhnlich auch den besten Charakter, aber Dittlick war eine leuchtende Ausnahme von dieser traurigen Regel.
Unser lieber Dittlick ist eine Sonderanfertigung des Lieben Gottes, so pflegte es Ronald Bubbo im Kreis seiner Freunde zu sagen. Der Mann ist so gescheit wie zehn Nobelpreisträger, aber trotzdem fühlst du dich wohl in seiner Nähe. Zu Dittlick hegte Bubbo unbedingtes Vertrauen, ja, er war ihm sogar in uneingeschränkter Bewunderung zugetan. Dieser Mann stand, wie man in seinen Kreisen sagte, mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Der Mann war eine Festung mit einem Verstand wie eine Kanonenkugel, mit der er mühelos Panik im Lager der Feinde erzeugt. Dittlick, das war ein ganz anderes Kaliber als die ewig schwatzenden Professoren, denen es mit ihrem unverständlichen Galimathias gelingt, selbst in den Köpfen der ehrlichsten und aufrichtigsten Menschen jeden Rest von Klarheit zu vertreiben. Dittlick, das ist messerscharfe Intelligenz, die verkörperte Klarheit. Gegen den kam niemand an, deswegen war es für einen allseits beneideten Geschäftsmann wie ihn, Ronald Bubbo, einfach unerlässlich, diesen Mann zu seinen engsten Freunden zu zählen.
Liebe Frau Daphne, sagte Dittlick mit einer Stimme, die so absolut ruhig und unbeirrbar klang wie das gleichmäßige Dahinströmen eines ländlichen Dauerregens. Sie dürfen sich über Vorkommnisse solcher Art nicht ereifern, sondern sollten sie mit Gleichmut akzeptieren.
Daphne blickte ihn verständnislos an, sie hatte immer einen so großen und weichen Blick, besonders, wenn sie hilf- oder ratlos war. Ein Blick, in dem jeder andere als Dittlick wie in einem Sumpf verschwinden oder wie in Treibsand versinken würde. Nur Dittlick versank und verschwand nirgendwo, gegen derartige Gefahren war er gefeit.
Ich verstehe nicht, sagte Daphne, wie man das Furchtbare akzeptieren kann. Wir sind doch alle Menschen. Wir müssen doch Mitleid zeigen!
Das ist es ja gerade, liebe Frau Daphne: Wir sind alle nur Menschen, aber die Geschehnisse, selbst die furchtbarsten, sind so und nicht anders von ganz oben gewollt.
Dittlick blickte einen Augenblick zur Decke des Salons, so als würde sein Blick durch sie hindurch bis zum Himmel schweifen.
Wie Sie wissen, geschieht nichts, aber wirklich gar nichts gegen den Willen des Herrn, nicht ein einziges Haar wird uns auf der Erde gekrümmt, ohne dass Er es zulässt, denn gerade so und nicht anders hat er es aufgrund seines unerforschlichen Ratschlusses gewollt und seit Ewigkeiten vorherbestimmt und vorausgesehen. Niemand von uns darf es wagen, das Gegenteil zu behaupten, dann würden wir den Höchsten auf furchtbare Weise lästern. Wir würden seine Allwissenheit und seine Allmacht bezweifeln.
Mit großen Augen blickte Daphne den Freund ihres Mannes an. Aber der Schrecken und all das Furchtbare?, stammelte sie.
Dittlicks Miene changierte ununterscheidbar zwischen der Andeutung eines Lächelns und unbeirrbar überlegenem Ernst.
Auch der Tod, liebe Frau Daphne, das Erdbeben, der Krieg und die tausend Verhungerten, von denen Sie eben sprachen, das alles ist gewiss von Ihm selbst so und nicht anders gewollt.
Dittlick antwortete ohne den geringsten Bruch in seiner gleichmäßig dahinströmenden Landregenstimme und ohne seinen ruhigen Blick von Frau Daphne abzuwenden.
Bravo, Dittlick, rief der alte Bubbo und griff, durch die Worte des Freundes neuerlich in gute Laune versetzt, nach der vernachlässigten Hühnerkeule. Da hast du meiner Frau ihre kindlichen Flausen mal wieder gründlich ausgetrieben. Recht so! Die Frauen glauben, wir wären auf dieser Welt nur zum Partyfeiern geboren. Aber so ist es nicht, und so wird es auch gewiss niemals sein. In Wahrheit sollen wir uns bewähren, kämpfen, dem Guten zum Sieg verhelfen. Deshalb sage ich ja immer: Krieg und Tod, das muss es geben, sonst nehmen die Leute ihren Auftritt hier unten nicht ernst.
Ronald Bubbo hatte diese Worte mit großer Bestimmtheit vorgetragen und seine Meinung zusätzlich dadurch unterstrichen, dass er bei jedem Satz mit dem Knöchel des Zeigefingers kräftig gegen die Tischplatte schlug. Sein Auftritt hätte jeden anderen eingeschüchtert, nur seine Frau schien wenig beeindruckt. Ihr Blick mochte weich und schwer zu enträtseln sein, aber ihr Gesicht drückte unverkennbar Widerstreben und sogar einen kaum verheimlichten Widerstand aus.
Unser lieber Herr Pfarrer meint aber doch, widersetzte sie sich in mürrischem Ton, Gottes Wille sei auf das Wohlergehen all seiner Geschöpfe gerichtet. Gott liebt uns.
Der alte Bubbo begann sich in diesem Moment wirklich zu ärgern. Widerspruch war er nicht gewohnt, Widerspruch gehörte sich nicht, schon gar nicht in der eigenen Familie.
Seiner Stimme war ein leichtes Knurren anzuhören, als er den Einwand seiner Frau zurückwies.
Ja, natürlich, meine Liebe, sagte er. Das tut Gott ganz gewiss, da hast du unbedingt recht. Mich liebt er zum Beispiel und dich liebt er auch, jedenfalls, wenn du dich zusammenreißt und deinem Mann nicht fortwährend widersprichst. Und dann liebt er noch alle, die guten Willens sind. Aber seine Feinde –von denen diese Welt leider randvoll gefüllt ist! – seine Feinde, die liebt er durchaus nicht. Die verfolgt er mit Feuer und Schwert, und wir sind es, die Ihm dabei helfen sollen. Das ist die große Aufgabe für uns Bubbos und für alle, die auf der richtigen Seite stehen: Die Feinde sollen wir niederringen, damit die Welt am Ende des Tages zu einem Paradies für die Freunde Gottes wird.
Wie es seine Art war – mit zunehmendem Alter hatte sich diese Gewohnheit noch verschärft -, war seine Stimme zuletzt lauter und lauter geworden, sodass er am Ende beinahe schrie. Er schob den Teller mit der abgenagten Keule unmutig beiseite, warf seiner Frau einen vernichtenden Patriarchenblick zu und lehnte auf seinem Stuhl zurück.
Dollo, rief er, meine Pfeife!
Nun war es so, dass Dollo, ein leicht hinkender und unbestimmt schielender Mensch, erst vor kurzem im Hause Bubbo angestellt worden war, und zwar auf Betreiben Daphnes, die ein Herz für Menschen besaß, die das Schicksal mit Missgunst behandelt. Ganz gewiss gehörte Dollo zu dieser Kategorie, denn aufgrund seiner Behinderung hatte keine seiner bisherigen Anstellungen länger als ein bis drei Wochen gewährt. Für dieses Missgeschick schien sein leichtes Hinken nicht einmal den Ausschlag zu geben, eher war sein Schielen der Grund für allerlei unerfreuliche Zwischenfälle. So auch diesmal im Hause Bubbo.
Niemand hätte das Unglück voraussehen können. Denn Dollo gelang es ohne Schwierigkeit, die Pfeife aus der Dose hervorzuziehen, die sich auf der Kommode an der gegenüberliegende Seite des Speisezimmers befand. Mit der Geographie des Salons und der angrenzenden Zimmer war Dollo inzwischen hinreichend vertraut. Nur befand sich zwischen der Kommode und dem Eichentisch, an dem Bubbo mit seiner Familie und seinem Freund Dittlick gerade speiste, ein dreifüßiges Gestell, auf dessen Spitze ein Globus von etwa zweifacher Fußballgröße thronte.
Leider, so muss man sagen! Denn dieser Globus war der Grund für das eintretende Missgeschick. War es der schiefe Blick oder eine falsche neuronale Verdrahtung im Gehirn des armen Dollo – diese Frage wird sich im Nachhinein wohl nie endgültig klären lassen. Über die fatale Wirkung seiner Behinderung besteht jedoch kein Zweifel. Es gelang dem Diener nämlich, mit seinem rechten Bein so gegen einen der drei Füße des Globus zu stoßen, dass das Gestell sich neigte, Frau Daphne einen Schrei des Entsetzens ausstieß, und die Erdkugel aus Polyester sich aus ihrer Halterung löste und zu Boden stürzte. Wie es die Art aller Bälle und deshalb auch die eines ballartigen Globus ist, sprang dieser nach dem Aufprall allerdings gleich wieder in die Höhe, fiel neuerlich zu Boden und dieses Spiel hätte sich vielleicht noch einige weitere Male ereignet, wenn nicht etwas geschehen wäre, was als Denkwürdigkeit allen künftigen Generationen zumindest im Lande Tatu in die Erinnerung eingegraben sein wird.
John Bubbo, der kleine, schüchterne und gewöhnlich ängstlich zu Boden blickende Knabe hatte sich nämlich wieder einmal - leider war das seine ungehörige, von der Mutter oft genug getadelte Art – während des Essens vom Tisch entfernt, freilich ohne den Salon zu verlassen. Mit niedergeschlagenem Blick saß er auf dem Boden, scheinbar sinn- und zwecklos mit sich selbst beschäftigt. Da saß er nun auch in dem Augenblick, als der Globus zu Boden fiel und dort, ganz wie es ihm seine physikalische Natur als elastischer Ball nun einmal gebot, auf die übliche Art zu hüpfen begann. War es Schicksal oder Zufall? Jedenfalls traf es sich so, dass der Globus schnurstracks in Richtung des kleinen Bubbo hüpfte, und dass dieser, statt vor Schreck zurückzuweichen, im Gegenteil die Arme weit von sich streckte und die Erdkugel mit beiden Händen wie ein Geschenk des Himmels auffing und an seinen Körper presste.
So geschah, was bis heute in jeder Biographie von John Ronald Bubbo gleich zu Anfang als das prägende Kindheitserlebnis beschrieben wird: Der kleine Bubbo saß im Salon und umschloss die Welt mit seinen Armen – ein Ereignis, das von Politikern, Philosophen, Theologen und anderen Prominenten des Landes Tatu so oft und so ausgiebig besprochen wurde, dass es an diesem Ort nicht weiter kommentiert werden muss.
Nur eines ist wohl mit Sicherheit anzunehmen. Sein Vater, eine wenig fantasiebegabte und außerdem von oberflächlichen Reizen wie einer leckeren Hühnerkeule ganz und gar absorbierte Natur, hätte die historische Bedeutsamkeit dieses Ereignisses ganz gewiss nicht erkannt. Väter pflegen ja das Genie des eigenen Nachwuchses in den seltensten Fällen richtig zu würdigen, schon gar nicht, wenn der Apfel etwas weiter vom Stamme gefallen ist, was aufgrund der seltsamen Schüchternheit dieses Knaben ja durchaus nicht zu leugnen war. Hätte sich dieses Ereignis also im intimen Kreis der engsten Familie abgespielt, so wäre seine welthistorische Bedeutung niemals ans Licht gekommen.
Doch glücklicherweise war Dittlick, ein Mann von höchstem geistigen Weitblick, Zeuge der historischen Weltumarmung. Auf Anhieb erkannte er deren hohe symbolische und hochgradig prophetische Bedeutung.
Dittlick sprang von seinem Sitz auf. Zum ersten Mal strömte seine Stimme nicht mit der unerschütterlichen Gleichmäßigkeit eines Landregens aus seinem Mund, sondern heiser und erregt stieß es aus ihm hervor:
Unser künftiger Präsident! Seht euch das an, unser kleiner John hält den Planeten in seinen Händen!
Wie richtig ich den Text der Botschaft erfasst und aus dem Gedächtnis wiedergegeben habe, wage ich nicht zu sagen, denn beschäftigt war ich mit etwas anderem, nämlich der Lesenden selbst, die, während sie jene Zeilen las, völlig wehrlos war, meinen Augen schutzlos ausgeliefert. Es liegt eine gewisse Grausamkeit darin, einen Menschen zu mustern, abzutasten und anzustarren, der so mit einer Aufgabe beschäftigt ist, dass er die Zudringlichkeit eines Beobachters nicht abzuwehren vermag. Ich hätte es auch ganz gewiss nicht gewagt, eine Fremde, sagen wir, die Ehefrau des Astronomen Schdruschka, so anzublicken, wie ich es während der Lektüre tat, angenommen, es hätte sich bei ihr um eine mir unbekannte, beliebige Frau gehandelt. Was meinen Blick so beharrlich, so gnadenlos werden ließ, war die Entbehrung, die ich zehn Jahre lang zu erdulden hatte, aber in diesem Augenblick wieder gutmachen wollte, so als wäre es möglich, mich mit der ganzen Beharrlichkeit meines Blicks dafür zu rächen, dass dieser Körper sich meinem Zugriff ganze zehn Jahre entzogen hatte. Was meine Zudringlichkeit noch besonders herausfordern musste, war die restlose Identität der von meinen Blicken gierig abgetasteten Person mit jenem weiblichen Wesen, das damals von einem Tag auf den anderen, ohne Abschied, ohne Erklärung aus meinem Gesichtskreis entschwunden war. Die Haare, blond und glänzend, trug sie noch genauso an den Kopf gestrichen, wie das früher ihre Art gewesen war. Die beiden Grübchen auf ihren Wangen bildeten noch immer jene lustigen kleinen Vertiefungen, in denen sich ihr Lächeln verfing und gleichsam eine Zuflucht suchte. Ihre Zähne, die sie beim Lesen hin und wieder entblößte, glichen noch immer einer Perlenkette – wie gern hatte ich meine Lippen damals auf ihren Mund gedrückt!
Und die weiße Bluse hätte auch noch aus der Zeit unserer großen Liebe stammen können, sie trug sie genau so locker wie damals. Ich brauchte ihre Bluse auch nicht über der rechten Schulter zu lüften, um den Leberfleck vor mir zu sehen, den sie dort trägt: Er bezeichnete den Endpunkt unserer häufigen Spiele, wenn meine Hand zuletzt ihre Brüste liebkost und dann zu ihrem Hals gesprungen war, während sie auf dem Weg mit flüchtigem Finger über diesen Fleck zu streichen pflegte, der für mich weniger ein Fleck war als die letzte Station eines Rituals.
Nein, ich brauchte Eveline – die jetzt Frau Schdruschka hieß - nicht zu entkleiden, um ihren Körper vor mir zu erblicken, seine Architektur, seine Schönheiten, seine Verlockungen sind mir nicht weniger gut bekannt als die Geographie meines Arbeitsraumes, die Aufstellung der darin befindlichen Bücher und der Geranien, die ihn mit ihrem Grün und manchmal mit ihren rot leuchtenden Blüten ziehen. Doch dieses Wissen bereitet mir keinen Genuss, sondern verschafft mir eine Qual, so als sähe ich Eveline ausgestopft in einer Vitrine, zu der nur noch einer den Schlüssel besitzt, der Astronom Schdruschka. Für mich ist diese Frau auf einmal ein fremdes Wesen, eine Art glänzender Käfer, ein sonderbares Insekt, unberührbar, da sie einem anderen gehört, dem Mann mit dem Palatschinkengesicht und einem fremdartigen Lächeln.
Ich habe diese Frau in der Vitrine die ganze Zeit inquisitorisch angestarrt, als wenn die exakte Rekonstruktion ihres physischen Selbst mir darüber Auskunft verschaffen könnte, was damals vor zehn Jahren mit uns beiden geschehen war.
Die hier Anwesenden sind mit einer Botschaft beschäftigt, die mich nichts angeht – so jedenfalls kommt es mir vor. Was soll denn dieser Bericht über die Kindheit eines Mannes von Irgendwo, der einen hüpfenden Globus umarmt? Die Einladung in das Haus des Astronomen, der sich selbst als Astrohom stilisiert, hält für mich eine ganz andere Botschaft bereit: Ich sehe eine Frau in der Vitrine, fremd und schön wie ein Insekt, das ich nicht berühren darf, ein ungelöstes Rätsel, eine unbewältigte Qual. Ich habe diese Frau angestarrt, aber, wenn ich glaubte, dass mein Blick die Entfernung zwischen uns zu verringern und das Rätsel aufzulösen vermag, dann habe ich mich geirrt. Es ist dieselbe Eveline, wie ich sie einst kannte – sie hat sich, so scheint es, in all den Jahren überhaupt nicht verändert - und dennoch ist es eine ganz andere Frau: ein schönes Insekt.
Wie unbekümmert die anderen Gäste sich benehmen! Teddy scheint geradezu in seinem Element zu sein.
Ich bin entzückt, ruft er aus. Da werden uns Menschen einer anderen Welt geschildert, und benehmen sich doch genauso wie du und ich. Den alten Aufschneider Ronald Bubbo habe ich deutlich vor Augen, und so ein kleiner verschüchterter Knabe wie sein Sohn John ist mir schon oft über den Weg gelaufen. Wissen Sie, dass mich diese Ähnlichkeiten mit unserer eigenen Welt wirklich erleichtern? Stellen Sie sich bitte vor, auf anderen Planeten würden Wesen mit drei Augen oder einem Dutzend Händen und Armen leben und sie würden völlig anders denken und fühlen als wir. Das wäre eine echte Katastrophe, vielleicht käme dann überhaupt keine Kommunikation zwischen ihnen und uns zustande. Meine Bücher würden sie dort jedenfalls nicht verstehen. Diese Botschaft dagegen ist für mich der Beweis, dass mein jüngstes Werk „Selig - Warum der Mensch von Natur aus gut ist“ auch in der Welt Bubbos Leser fände. Ein so gescheiter Mensch wie dieser Dittlick würde es gewiss auf Anhieb verstehen. Jedenfalls ist es mein persönlicher Wunsch, mit diesen Wesen so schnell wie möglich Kontakt aufzunehmen - vorausgesetzt natürlich, dass eine solche Verbindung im Sinne unseres Gastgebers ist.
Gernegut hat mit Armen und Beinen zugleich geredet, sein feuriger Optimismus bringt auch Schdruschka zum Lächeln, nur Platsch kehrt uns weiterhin eine finstere Miene zu, die noch umso finsterer wird, je länger der Ausbruch Gerneguts währt.
Bei aller Hochachtung für die Meinung eines Künstlers, tritt er mit mürrischem Wort dazwischen, wäre es doch vielleicht richtiger, erst einmal der Wissenschaft das Wort zu erteilen. Die reichlich simple Geschichte aus dem Hause der Bubbos erinnert mich in der Tat an Ähnliches, was uns auch hier auf unserer guten alten Gaia begegnen könnte. Unser Freund Gernegut hat schon recht: Diese Zeilen könnten aus seiner eigenen Feder stammen. Das nennt man dann wohl Roman oder Erzählung, kurz etwas Erfundenes mit einem in der Regel überaus dürftigen Wahrheitsgehalt. Ich sehe nicht, was wir, speziell, was die ernsthafte Wissenschaft, von diesem Text lernen soll. Herr Gernegut mag sich darüber freuen, dass er seine Werke auch auf dem grünen Planeten bei den Bubbos verkaufen könnte – ich gönne ihm gern ein Publikum in den Weiten des Universums -, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die zufallsgetriebene Evolution im ganzen Kosmos Wesen von gleicher Art wie auf unserem Globus hervorbringt, müssen wir leider für infinitesimal gering einschätzen. Ich kann mir zum Beispiel keinesfalls vorstellen, dass es auf Grün dieselbe Art Vögel gibt wie bei uns, Hühner etwa oder Enten oder eben Menschen wie die Familie Bubbo. Die Erwartung, dass diese Wesen dann auch noch so denken und fühlen wie wir - wir hören ja, dass der Held der Geschichte mit größtem Behagen eine Hühnerkeule verspeist -, muss ich aus rein theoretischen Überlegungen geradezu auf Null reduzieren. Das ist es, Kollege Schdruschka, was ich Ihnen hier als Vertreter der exakten Wissenschaft leider zu sagen habe.
Das saß! Der arme Schdruschka wurde abwechselnd rot und bleich, nicht einmal ein Rest des obligaten Lächelns war in seinem großen Palatschinkengesicht zu entdecken.
Was mich selbst betrifft, so hat mich der Streit zwischen dem Physiker und dem Schriftsteller für einen Augenblick von der blonden Frau losgerissen. Einerseits ist das Argument von Platsch ja wirklich nicht so leicht zu entkräften. Die Familie Bubbo erscheint einem doch auf den ersten Blick geradezu verdächtig bekannt. In meinen Augen gilt das allerdings in noch höherem Grade für den kalt argumentierenden Gast, der uns als Dittlick vorgestellt wird. Ist nicht jeder von uns einem solchen Sophisten schon mehrmals in seinem Leben begegnet? Ich verstehe ja das Entzücken von Gernegut über die frappierenden Ähnlichkeiten mit den hier lebenden Menschen, aber können wir darin wirklich die Beschreibung von Zuständen erblicken, die sich in einer anderen Welt abspielen?
Theophil, der konsultative Prälat – was immer man sich darunter vorstellen mag -, hat bis zu diesem Moment geschwiegen, nur die Augen in stiller Andacht nach oben verdreht. Nun meldet er sich leise zu Wort, und er tut es mit gütigem Lächeln.
Liebe Freunde, wenn sich der weltliche Verstand und die Wissenschaft streiten, dann mag es dem Kenner der überweltlichen Weisheit gestattet sein, in aller Bescheidenheit seine eigene Überzeugung einzubringen. Ist es denn wirklich erstaunlich, dass eine fremde Welt von Wesen besiedelt wird, die uns nicht nur ähnlich sind, sondern uns geradezu gleichen? Mancher Wissenschaftler, wir haben gerade die Meinung von Herrn Justus Platsch gehört, hält dies in der Tat für unwahrscheinlich; wer sich allerdings den Glauben an die Weisheit Gottes bewahrt, der wird im Gegenteil von der allergrößten Wahrscheinlichkeit reden, ja von vornherein davon ausgehen müssen, dass etwas anderes nicht zu erwarten sei. In der Genesis können Sie lesen, dass unser Herrgott am fünften und sechsten Tag die Wesen im Wasser, auf dem Lande und in der Luft auf ein und dieselbe Weise erschuf. Wird da etwa gesagt, dass er auf verschiedenen Himmelskörpern jeweils andere Tiere ins Leben rief? Am sechsten Tag hat unser Herrgott sich dann noch die Mühe gemacht, auch uns, die Menschen, mit eigener Hand zu bilden. Sagt uns die Bibel etwa, dass er ihnen auf den vielen bewohnten Himmelskörpern jeweils andere Gestalten verlieh?
In der von Ihnen soeben verlesenen Botschaft, liebe Frau Schdruschka, erblicke ich einen weiteren sehr schönen Beweis für die Wahrheit unserer Heiligen Schrift. Als gläubiger Mensch und Bewohner Gaias bin ich von diesem Text bisher wirklich angetan, wenn ich auch anmerken möchte, dass die Person, die uns als Herr Dittlick geschildert wird, gewisse Meinungen vertritt, die aus theologischer Sicht recht anfechtbar sind. Dennoch freue ich mich jetzt schon darauf, die Fortsetzung zu hören. Bitte lesen Sie weiter, Frau Schdruschka!
Aber der Text geht doch an diesem Punkt zu Ende, bricht es grimmig aus Platsch hervor.
Das stimmt, pflichtet ihm Schdruschka bei; sein Gesicht ist auf einmal so von Kummer gezeichnet, dass ich in diesem Moment sogar ein gewisses Mitleid mit ihm empfinde.
Da – in diesen Moment klingelt ein Handy. Alle Anwesenden greifen in ihre Taschen. Eveline zieht ein schneeweißes Gerät unter dem Stoß der Seiten hervor.
Eine Mail, ruft sie mit erregter Stimme. Warten Sie, der Absender lautet - er lautet: God@Paradise.com.
Die Verwandlung, die in diesem Augenblick mit unserem Hausherrn Waldmir Schdruschka geschieht, ist kaum zu beschreiben. War sein Gesicht zuvor noch beinahe erloschen, so leuchtet es jetzt auf, beginnt zu strahlen.
Er stammelt sogar im ersten Moment, als er sich mit triumphierendem Blick Platsch zuwendet.
Na also, also; man hat uns keine leeren Versprechungen gemacht. Die Fortsetzung ist da und wartet nur darauf, von meiner Frau ausgedruckt zu werden. Bitte, Eveline, geh ins Haus zum Computer. Es wird nur wenige Minuten dauern, bis wir den Fortgang der Geschichte erfahren. Wir sind auf die Folter gespannt. Ich glaube, jetzt brauche ich in dieser Runde niemanden mehr zu bekehren.
Stimmt nicht!
Platsch schüttelt den Kopf, hebt die vor ihm stehende Tasse, nimmt einen Schluck, stellt sie wieder hin, nur um sie abermals an den Mund zu heben. Vermutlich ist sie längst leer getrunken, aber der Physiker braucht ein Ventil, um sein Unbehagen zu überwinden. Es zuckt in seinem Gesicht, es zuckt auch noch, als Eveline mit einem Stoß Papier in der Hand wieder zu uns auf die Terrasse tritt und die unterbrochene Lektüre sogleich wieder aufnimmt. Aber immerhin steht Platsch nicht auf, wie wir alle scheint auch er an seinen Platz gefesselt. Ich gebrauche das Wort ‚gefesselt’, ein seltsames Wort, doch beschreibt es die Situation, denn auch ich fühle mich an diesen Platz wie mit unsichtbaren Ketten festgezurrt. Nein, es ist nicht die kuriose Geschichte - was gehen mich denn die Bubbos an? -, in meinem Fall ist es das Gesicht einer Frau, ihr Körper, den ich wie in einer Vitrine vor mir sehe. Jetzt, wo sie wieder mit der Lektüre beschäftigt ist, kann mich niemand daran hindern, sie mit meinen Blicken abzutasten, mit meinen Blicken in sie einzudringen.