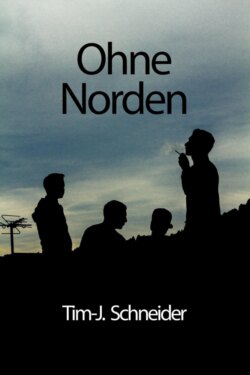Отрывок из книги
Hier bin ich. Habe gerade meine Volljährigkeit erreicht. Liege im Bett, aber nicht flach, sondern lehne mich an der Bettkante an. Habe die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Denke ein bisschen nach. Lasse die Gedanken schweifen, wie man so schön übertrieben sagen kann. Aber in irgendeiner Weise stimmt das ja. Sobald einmal die Maschinerie oben angeworfen worden ist, schießen einem Dinge in den Kopf, die zwei Augenblicke davor noch Lichtjahre entfernt waren. Bin irgendwie stolz auf meinen eigenen Gedanken gerade. Zwei Augenblicke davor noch Lichtjahre entfernt, das klingt irgendwie verdammt gut. Das hätte ich meinem schläfrigen und verkaterten Kasten da oben, wenn ich ehrlich bin, eigentlich gar nicht zugetraut an so einem Morgen, an dem der Wodka nach dem Aufwachen leicht gegen die Schläfe pocht und sobald man sich aufsetzt, zu einem Vorschlaghammer wird, der mit einer gnadenlosen Frequenz versucht, sich vom Inneren des Schädels einen Weg nach draußen zu bahnen. Der nächste Gedanke ist, dass Rührei nicht schlecht wäre und wenn man das nicht „Gedankenschweifen“ nennen kann, dann weiß ich auch nicht. Von wodkagetränkter Tiefsinnigkeit zum bevorstehenden Katerfrühstück, das kriegt nur ein achtzehnjähriges Gehirn hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich versuche aufzustehen, aber ich kapiere schnell, dass der Vorschlaghammer etwas dagegen hat und es wohl noch eine Zeit dauern wird, bis ich dem Traum, in dem eine Pfanne, zwei Eier und ein Schneebesen eine ganz wesentliche Rolle spielen, näher kommen kann. Und so schweife ich weiter. Treffe mich wieder vor ein paar Jahren, mit zwölf, dreizehn, vierzehn vielleicht. Es klingt sehr unlogisch, für mich selbst sogar, aber es kommt häufig vor, dass ich mich selbst nicht verstehe. Also noch einmal: Es klingt sehr unlogisch, dass man mit gerade einmal achtzehn Lenzen auf dem Buckel morgens im Bett liegt und so über sein Leben nachdenkt, reflektiert, beurteilt und vielleicht sogar schon bedauert. Das sollte eigentlich neunzigjährigen Lebemännern auf dem Sterbebett vorbehalten sein, wenn ihr komplettes ausschweifendes Leben noch einmal an ihnen vorbeizieht, ehe sie glücklich und zufrieden den Gang nach Woauchimmer antreten können. Dass das achtzehnjährigen Gymnasiasten passiert, entspricht irgendwie nicht der Regel, aber auch hier gilt wohl festzuhalten: Keine Regel ohne Ausnahme. Und ich weiß, beziehungsweise vermute, oder egal, eigentlich bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich nicht der einzige bin, der hin und wieder, ab und zu daliegt und mal über das nachdenkt, was so war und was vielleicht noch so kommt. Hoffentlich kommt. Ich bin nicht so der Typ, der sich Horrorszenarien in der Zukunft ausmalt, eher der, der die Augen zumacht und sich selbst in einem Ferrari 458 Italia durch Monte Carlo brausen sieht, auf dem Weg zu seiner Yacht, vielleicht auch nur zu einem kleinen Dinner, man will ja bescheiden und realistisch bleiben. In so einem Moment huscht mir dann ein kleines Schmunzeln über die Lippen. Natürlich wird nichts davon passieren und ich werde auch nicht zukünftig in Depressionen verfallen, wenn ich merke, dass dieser kurze Tagtraum sich eines Tages in Luft auflösen wird, aber an solch einem Morgen sehe ich nichts Verwerfliches daran und außerdem lenkt es ein bisschen vom Vorschlaghammer ab. Sich die Zukunft auszumalen, ist auch überhaupt kein Problem. Es ist eher das Problem, das Passierte noch einmal neu durchzugehen und immer wieder zu bewerten. Ich habe es ja eben schon mit dem Sterbebett verglichen, aber mir kommt es so vor, als wäre es eine Krankheit der heutigen Gesellschaft und vielleicht auch meiner Generation, - oh Gott, ich habe nicht nur Gedanken eines Neunzigjährigen, ich rede auch noch so: Meiner Generation. Ich höre mich an wie mein Uropa, Gott hab‘ ihn selig – dass wir viel zu sehr in der Vergangenheit leben und dabei das Hier und Jetzt vernachlässigen. Krankheit ist vielleicht die falsche Bezeichnung. Ich bin noch nicht dazugekommen, diesen Umstand, der meiner Meinung nach so ist, zu bewerten. Aber was auffällt, ist, dass sich viele Menschen darüber beklagen, dass man zu viel über Dinge nachdenkt, die man sowieso nicht mehr ändern kann, statt in der Gegenwart zu leben. Zu denen ich dann ja wohl auch gehöre, da ich hier liege und meine Vergangenheit begutachte. Wieder ein Schmunzeln. Vor meinem geistigen Auge taucht eine Tafel auf, auf der noch einmal alle wichtigen Ereignisse meines Lebens aufgelistet sind, ich davorstehend mit nachdenklicher Miene, die Tafel begutachtend. Vielleicht war begutachten das falsche Wort. Aber ich habe es halt gedacht. Zumindest denke ich über den letzten Abend nach, meinen achtzehnten Geburtstag. Das ist die Vergangenheit, das ist Fakt. Und auch ein bisschen über mein Leben davor. Aber vernachlässige ich deshalb die Gegenwart? Ich lebe im Hier und Jetzt und versuche alles mitzunehmen, aber noch im Moment des Erlebens zu wissen, dass dieser in der Zukunft, wenn man über die Vergangenheit nachdenkt, was Besonderes sein wird, das ist schwer und auf Anhieb kann ich nicht sagen, ob mir das schon passiert ist. Vielleicht macht erst ein gewisser temporärer Abstand Dinge besonders. So liege ich hier und denke, was für eine geile Zeit es war mit meinen Jungs damals auf dem Bolzplatz. Das ist vielleicht sechs, sieben Jahre her. Und ich bin nicht traurig. Ich lebe in dieser Zeit, nicht in der Vergangenheit. Aber mich jetzt daran zu erinnern, das gibt mir irgendwie ein Gefühl im Bauch - ich kann nicht sagen, dass es unangenehm ist. Am besten könnte man es wohl mit dem Wort Wehmut beschreiben. Aber ich empfinde das nicht als etwas Negatives, sondern als etwas Schönes. Eine schöne Wehmut, ja so könnte man es nennen. Und was soll daran verkehrt sein, wenn man sich schöne Erlebnisse bewahrt und sie ab und zu, wenn der Wodka dann und wann gegen die Schläfe pocht, wieder auftauchen. Ich verwerfe das Wort Krankheit meiner Generation und ersetze es durch Merkmal, hoffe aber irgendwie, noch ein besser geeignetes Wort dafür zu finden. Was damit gemeint ist, mit in der Vergangenheit leben, das ist mir natürlich auch klar: Wenn man über Dinge nicht hinwegkommt oder einfach nicht loslassen kann. Und so lieg ich hier auch und denke: „Verdammt, wär’s nur wieder manchmal wieder wie früher.“ Und sicherlich ist das eng mit Personen verknüpft die meinen Weg gekreuzt haben, vielleicht auch mit einer bestimmten Person, vielleicht auch mit einem besonderen Mädchen, dass wenn du mir auf der Straße begegnen würdest und mich danach fragen würdest, ich vielleicht als gar nicht so speziell bezeichnen würde. Aber wir sind nicht auf der Straße, sondern in meinem Kopf, durch den Blut fließt - mit beträchtlichem Alkoholanteil. Man könnte auch sagen, durch den Alkohol fließt - mit einem beträchtlichen Blutanteil. Und jetzt sind die Gedanken wieder in Richtung In-der-Vergangenheit-leben abgeschweift. Zur Krankheit meiner Generation, unserer Gesellschaft. Wie erwähnt, ich bevorzuge schöne Wehmut. Und Rührei. Es gibt nichts was ich im Moment mehr bevorzugen würde als Rührei.
Als ich im Frühling meinen Koffer packte, um ein Wochenende in der Stadt meines Vereines zu verbringen, wusste ich noch nichts von der im Mai bevorstehenden Schmach und der bitteren Pille, die ich als Fan zu schlucken haben würde. Man war in allen drei Wettbewerben noch sehr gut dabei und selbst ein Triple war nicht ausgeschlossen. Ich war extrem aufgeregt, endlich mal die Allianz Arena live miterleben zu dürfen und konnte in der Nacht vor der Reise vor lauter Aufregung nicht einschlafen. Das holte ich aber dann auf den fünf Stunden Fahrt in die Hauptstadt Bayerns nach. Eine längere Autofahrt wirkt auf mich immer wie eine Art Betäubungsmittel und das ist keine Übertreibung. Die fünf Stunden, die ich alleine auf der Fahrt nach München, durchgeschlafen habe, waren nichts im Vergleich zu meinem längsten Marathon-Nickerchen. Unvergessen und nie mehr erreicht war mein 14-Stunden-Schlaf während der Fahrt nach Barcelona. Während meine Eltern zwischendurch fünfmal Rast machten, sogar eine Stunde zu Mittag aßen und mich dabei im Auto ließen, zweieinhalb Stunden im Stau standen und meine ganzen Naschvorräte, die ich von meiner Oma für die Fahrt geschenkt bekommen hatte, verzehrten, schlief ich seelenruhig auf der Rückbank und schlug erst wieder die Augen auf, als wir das Ortsschild von Barcelona passierten. Viele Erklärungsversuche, von der Vermutung, dass die Rückbank einfach zu bequem sei, was, wie ich aus eigener Erfahrung berichten konnte, sicherlich nicht der Fall war, bis zur Unterstellung, ich hätte eine seltene Schlafkrankheit, woraufhin mich sogar ein Arzt nach beharrlichem Drängen meiner Mutter untersuchte, stellten sich als Fehleinschätzungen heraus und irgendwann akzeptierten meine Eltern, dass ich sobald mein Vater auf die Autobahn auffuhr, in einen komatösen Tiefschlaf versetzt wurde, der solange anhielt, bis das angepeilte Ziel erreicht wurde. Ich persönlich sah es als Gabe an, langweilige und zermürbende Autofahrten mit einem kleinen oder im Falle Barcelona auch größeren Nickerchen überbrücken zu können. Ein weiterer positiver Nebeneffekt war, dass ich nach längeren Fahrten ausgeruht und fit wie ein Turnschuh war, während meine Eltern den ersten Tag jeder Reise damit verplemperten, sich von der langen und kräftezehrenden Fahrt zu erholen. Aber in München würde das nicht laufen. Nicht mit mir. Das hatte ich ihnen schon klargemacht. Wir hatten nur ein Wochenende und an dem wollte ich alles erleben, was es in München nur zu erleben gab. Außerdem hatte ich ihre Besorgnis über meinen ungewöhnlichen Schlafrhythmus, sobald eine Reise anstand, sowieso noch nie verstanden. Während andere Kinder permanent unruhig in ihrem Kindersitz hin und her rutschen und alle fünf Minuten die berühmt berüchtigte Frage Wann sind wir da? quengelten, war ich stets ein sehr ruhiger Begleiter und stellte meine Erzieher nie vor eine nervliche Zerreißprobe, worüber andere Eltern froh gewesen wären, aber wie man es als Kind macht, macht man es verkehrt. Das ist bitterer Fakt. Ich wachte indem Moment auf, indem man aus dem Autofenster von der Autobahn aus schon die Allianz Arena sehen konnte und ich brauchte einige Augenblicke, um zu realisieren, dass ich nicht mehr schlief und das hier kein Traum war, sondern dass ich inzwischen aufgewacht war und nun das gigantische Rund und die ganze Aura dieses Stadions miterleben durfte - war es auch nur für einige Momente und aus beträchtlicher Entfernung. Nachdem wir sie passiert hatten, verrenkte ich mir noch lange den Hals, um sie nicht aus meinem Blickfeld zu verlieren. „Na, ausgeschlafen?“, fragte meine Mutter und grinste mich vom Beifahrersitz aus verschmitzt an. Ich nickte verschlafen und rieb mir die Augen. Auf dem Weg zu unserem Hotel, das Kempinski Hotel Airport München, fuhren wir am Herz einer jeden Großstadt, dem Flughafen, vorbei. Dass unser Hotel quasi zum Flughafen dazugehörte fand ich besonders spannend, da Flughäfen mich von je her faszinierten. Sie strahlen eine Freiheit und Vielfältigkeit aus, die einem die komplette Welt greifbar und erreichbar machte. Leute aus aller Herrenländer und Kulturen, die vor ein paar Stunden noch am anderen Ende der Welt verweilten, tummelten sich plötzlich tausende Kilometer von ihrer Heimat weg und es ist scheinbar das Normalste der Welt. Dieses Gefühl faszinierte mich irgendwie und während meine Eltern noch auspackten, machte ich mich direkt auf den Weg zur Besucherterrasse, von der aus man einen guten Blick auf die Start- und Landebahn hatte. Ich stand mindestens eine halbe Stunde lang einfach nur so da und beobachtete, wie eine Maschine nach der anderen abhob. Die eine vielleicht nach Los Angeles, die nächste wiederum vielleicht nach Johannesburg. Während ich weiter durch den Flughafen streifte und das geschäftige Treiben der Menschen genoss, die sich bald alle mit ihren Koffern und Taschen irgendwo in der Welt zerstreuen würden, faszinierte mich vor allem die große Videoleinwand, auf der die Informationen über die Abflüge und Ankünfte eingeblendet wurden. Und als ich so dastand und mein Blick von New York nach Singapur schweifte, bekam ich diese Lust, die mich seitdem immer an Flughäfen überkommt: Am liebsten in den nächsten Flieger steigen und einfach ganz weit wegfliegen. Vielleicht hätte ein Flugzeug sogar denselben Effekt auf mich wie ein Auto und im Handumdrehen wäre ich in den USA. Auch als ich den Terminal zurück in Richtung des Hotels verließ, blieb das Gefühl und vermischte sich mit der Vorfreude auf die Stadt, in der ich gerade war. Ich stellte mir vor, wie irgendein anderer gerade am anderen Ende der Welt stand, auf so eine Tafel blickte und dachte, wie toll es jetzt wäre, einfach mal nach München zu fliegen und ich selbst war in München, in dieser Weltstadt. Ich fühlte mich als Teil davon und als ich die Hotelhalle mit den in die Höhe ragenden Palmen, die fast die Decke zu berühren schienen, betrat, während beschäftigt wirkende Geschäftsleute in den roten Lounge-Sessel saßen, die New York Times lasen und Espressi tranken, verstärkte sich dieser Eindruck noch. Ich machte es mir in einem der Sessel gemütlich, tat so als würde ich geschäftig die sich ständig aktualisierenden Ankunft- und Abflugzeiten studieren und wartete auf meine Eltern, die sich auf unserem Zimmer noch schnell für unseren Trip in die Innenstadt frisch machten. Es dauerte nicht lange, bis eine charmante junge Dame von der Bar aus zu mir geschwebt war und mich mit ihrem schönsten Zahnpastalächeln fragte, ob ich denn gerne etwas zu trinken hätte. Wenn ich charmante junge Dame sage, meine ich, dass sie verdammt heiß war. Ich blickte sie einen Moment perplex an, lehnte dann jedoch dankend ab. Sie schwebte zurück zur Bar, hatte offenbar gemerkt, dass ich ihr nachgesehen hatte und grinste noch einmal. Schade, ich hätte zu gerne was bei ihr bestellt, irgendwas um verdammt cool und seriös zu wirken. Vielleicht einen Martini, geschüttelt, nicht gerührt, à la James Bond. Oder einen alten Whiskey - schön lässig. Sie war zwar gut und gerne fünf Jahre älter als ich, aber dieser Umstand hinderte mich nicht daran, München immer besser zu finden. Und die eigentliche Stadt hatte ich noch gar nicht gesehen. Meine Eltern ließen jedoch nicht lange auf sich warten. Der Plan war, heute ein bisschen die Innenstadt zu erkunden, was für meine Mutter hieß: Eine Boutique nach der anderen unsicher machen. Für mich und meinen Vater hieß es, mein Erspartes im FCB-Fanshop auf den Kopf zu hauen, danach in irgendeinem großen Biergarten Weißbier zu trinken und schön deftig zu essen- typisch bayrisch eben. Wir fuhren mit dem Auto zu einem der Park&Ride-Plätze, die überall im Großraum München verteilt waren und von denen man bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt fahren konnte, in der die Chance, einen Parkplatz zu finden, ungefähr so hoch war, wie eine WM-Teilnahme von San Marino. Mein Vater hatte geplant am Park&Ride im Münchner Vorort Daglfingen den Wagen abzustellen, von wo es gerade einmal zwei S-Bahn Stationen zum Marienplatz waren. Während wir durch Daglfingen fuhren, kam mir der Gedanke, dass, wenn ich vorher ein bisschen eingedöst wäre, ich hätte denken können, dass wir München verlassen hatten und durch eine mittlere Kleinstadt in irgendeinem beschaulichen Landkreis fahren würden. Kleine, beschauliche Anwesen mit gepflegten Vorgärten und einer Doppelgarage. Kinder im Grundschulalter, die Roller und Fahrrad fuhren. Ein paar Jugendliche, die eventuell so alt waren wie ich, saßen an einem Kiosk in Strandstühle, solche, wie man sie von der Nord- oder Ostsee kennt, ließen sich die Sonne auf den Pelz scheinen und tranken Bier aus Dosen. Es war Freitagnachmittag. Wenn ich hier wohnen würde, wäre ich einem ähnlichen Start ins Wochenende nicht abgeneigt. Nichts deutete darauf hin, dass sich nur zwei S-Bahn Stationen weiter das Zentrum einer Millionenstadt befand. Es hätte gut und gerne einen Ort von meiner öden Kleinstadt entfernt sein können - es wäre mir nicht aufgefallen. Aber irgendwie, dachte ich, während ich an der S-Bahn Station saß und auf der anderen Seite des Gleises einen Mann erblickte, der neue Plakate an einer riesigen Werbetafel anbrachte, irgendwie machte das gerade dieses Fleckchen aus. Daglfingen war halt nicht in irgendeinem unbekannten Landkreis, mehrere Autostunden von München entfernt. Es lag mitten in München, tagsüber am Kiosk in der Sonne relaxen und abends zwei S-Bahn Stationen in die Innenstadt – dahin, wo die Action stattfand. Nicht schlecht. Die S-Bahn kam und spätestens dann wurde mir noch einmal klar, dass ich zum Glück nicht zu Hause, sondern in einer pulsierenden Metropole war. Männer in Anzügen und einem Macbook auf dem Schoß, sprachen in fast akzentfreiem Englisch mit anscheinend niemandem, bis ich bemerkte, dass der eine ein Headset im Ohr hatte. Eine Frau las Zeitung, eine andere hörte Musik. Ein Junkie in zerrissener Hose, Nietengürtel und oberkörperfrei schniefte permanent - wahrscheinlich Koks. Arme Socke. Aber die Möglichkeit hier auf die schiefe Bahn zu geraten, war wahrscheinlich höher als auf dem Land. Und in gewisser Weise gehörte auch dies leider zum Charakter einer Weltstadt dazu. In jedem Bahnhof, in den die Bahn einfuhr, drängelten sich mindestens hundert Leute - die einen Richtung Ausgang, die anderen Richtung Bahn. Während meiner Mutter das hektische Treiben nicht so gefiel, fand ich es ja irgendwie spannend. Das alles war so fremd für mich und für diese ganzen Leute doch so normal, dass ich mich in gewisser Weise unwohl fühlte, weil ich nicht wusste, ob man mir diese Unwissenheit ansah. Der Dorftrottel in der großen Stadt. Das würde doch jedem auffallen. Es war als würde es auf meiner Stirn stehen. Aber auf der anderen Seite, fand ich es so toll, ein Teil dieses Ganzen zu sein, dass das unwohle Gefühl sich ziemlich schnell in ein unbekümmertes und fasziniertes verwandelte. An der Haltestelle zum Marienplatz kam die Hektik dann zum Höhepunkt. Aber irgendwie hat Hektik so einen negativen Touch - ähnlich wie Melancholie oder Wehmut, deshalb nenne ich es auch einfach hier schöne Hektik. Für mich war es so. Menschenmassen, die einerseits in die Züge, andererseits zu den zahlreichen Ausgängen strömten, ein Stimmengewirr, gemischt mit dem hallenden Geräusch einfahrender und ausfahrender Züge, ich mittendrin, durchschlendernd, auf der Rolltreppe nach oben, das alles noch einmal beobachtend und festhaltend, was für die anderen stupider Alltag war. Eine echt schöne Hektik. Oben angekommen verwandelte sich die Kühle und Schummerigkeit des U-Bahn-Schachts schlagartig in angenehme Wärme und Helligkeit, als die ersten Strahlen der Frühlingssonne meine Augen kitzelten. Temperatur und Lichtverhältnisse standen in krassem Kontrast. Die Hektik blieb. Ich setzte meine Sonnenbrille auf, blickte direkt in die Sonnenstrahlen und genoss die Aussicht auf den Marienplatz. Vor mir hatte sich eine Menschengruppe gebildet, die sich um eine Art Statue drängelte, Fotos machte und das Abbild eines kleinen Mannes mit Hut anstarrten, der auf einem vergilbten metallgelben Sockel stand und in derselben Farbe in erhabener Pose mit starren Augen in die Mittagssonne stierte. Ich hätte meine Mutter gefragt, wer denn diese Persönlichkeit sein sollte, wollte aber als erklärter München-Fan meine Unwissenheit nicht preisgeben. Ich schob mich ein bisschen nach vorne, um einen besseren Blick erhaschen zu können, vielleicht sogar, um auf dem Sockel einen Namen und Lebenszeitraum der Person erkennen zu können. Um mich herum weiter Blitzlicht, zum Teil von Smartphonekameras, ich hörte wie eine Mutter ihr kleines Mädchen dazu animierte, doch einmal nach vorne zum Denkmal zu gehen, damit sie sie davor fotografieren konnte. Ich verfolgte das Gespräch kurz, um mehr über den Mann herauszufinden, der anscheinend eine ganz große Nummer war, aber nachdem die Kleine mit einem lauten Quengeln deutlich gemacht hatte, dass ihr gar nicht danach war, sich mit irgendeinem Messingmann ablichten zu lassen, wandte ich meinen Blick wieder zum Denkmal. Ich erschrak höllisch. Die Statue, die eigentlich, so zumindest in meiner benebelten Kleinstadtwahrnehmung, ein paarhundert Jahre regungslos an ein und demselben Ort verbringen sollte, bis sie irgendwann in einer Revolution oder bei einem Erdbeben umgestürzt würde, entsprach ganz und gar nicht dieser Vorstellung. Nachdem es ungefähr fünf Minuten lang so ausgesehen hatte, als wäre es ein ganz normales Denkmal, posierte die „Statue“ auf dem Sockel nun freudig für die zahlreich gezückten Kameras, warf einer Gruppe junger Frauen, die scheinbar einen Junggeselleninnenabschied feierten, ein paar Luftküsse zu und genoss die verdutzten Gesichter der unwissenden Touristen, wie ich selbst einer war. Ich war einer gewöhnlichen Großstadtattraktion auf den Leim gegangen, die aber, das musste ich zugeben, sich extrem gut darstellte und präsentierte. Die metallgelbe Farbe schimmerte so real und echt in der Mittagssonne, dass ich, bis sich der Schausteller zum ersten Mal bewegte, im wahrsten Sinne des Wortes, keinen blassen Schimmer hatte, dass es sich nur um einen Fake und nicht um eine reale Persönlichkeit des Münchner Hochadels von vor zweihundert Jahren handelte. Da ich nun keinen passenden Namen für den Messingmann hatte, nannte ich ihn kurzerhand Statuen-Joe. Konstantin, Thommy und ich hatten uns angewöhnt, Personen, deren Namen wir nicht genau kannten, oder ihn einfach doof fanden, andere Namen zu geben, die sich zum Teil auf ihr Aussehen, zum Teil auf Vorlieben oder ihren Charakter bezogen. Damit das auch irgendwie cool und lässig klang, hatte es sich bei uns eingebürgert, das wir hinter der neuen Bezeichnung für die jeweilige Person, den Namen Joe hängten. So wurde von uns ein Mitschüler, der letztes Jahr sein Abitur gemacht hatte und aussah als wäre er Bob Marleys Zwillingsbruder, einfach in Rasta-Joe umgetauft. So setzte sich das an unserer Schule fort, es gab Punker-Joe, Metal-Joe und Locken-Joe. Locken-Joe hat schätzungsweise seit seiner Geburt nie einen Friseursalon von innen gesehen und Metal-Joe hatte nach Wacken letzten Sommer ein paar Risse in den Stimmbändern. Seitdem fiel es uns bei ihm schwer, sich zwischen Metal- und Stimmband-Joe zu entscheiden. Auch unsere Lehrer blieben davon nicht verschont. Eine Lehrerin an unserer Schule gab Französisch und Chemie und noch heute weiß ich nicht wie in Gottes Namen man sich als Frau diese Kombination aussuchen konnte. Sie sah zum Glück aber eher nach Französisch als nach Chemie aus und trug immer Röcke. In ihrem Kleiderschrank schien es keine normale Hose zu geben. Egal ob minus vierzig Grad und Dauerblizzard, die gute Dame hatte keinen Bock auf lange Hosen. Vielleicht zeigte sie gerne ihre Beine. Sie waren ganz okay, aber ein Model stellte sie damit nicht in den Schatten. Als Thommy auf dem Schreibtisch in ihrem Büro dann noch AC/DC-Karten fand, stand dem Namen Rock-Joanne nichts mehr im Wege. Selbst mein Vater blieb von dieser Angewohnheit nicht verschont. Bei einem unserer Grillabende bei mir im Garten bekam er unweigerlich mit, wie wir uns über Rock-Joanne und Locken-Joe unterhielten. Er wollte wissen, was es damit auf sich hatte. Wir erklärten es ihm und seitdem ist mein alter Herr bei meinen Freunden nur noch als Daddy-Joe bekannt. Ich muss zugeben, es klingt schon irgendwie besser. Bei genauem Hinsehen erkannte man aber auch eine vor Statuen-Joe ausgebreitete Schatulle, in die großzügige Passanten Kleingeld werfen konnten - als Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit des Schaustellers. Auch ich zückte sofort meinen Geldbeutel. Wer mich auf so stilvolle Weise verarscht, der hat mein Geld echt verdient. Mein Blick, der die ganze Zeit nur am Denkmal hing und sich im strahlendblauen Himmel verlor, schwenkte nun weiter und erkundete den Rest des Platzes. Unweit von Statuen-Joe war ein weiterer Schausteller, eine Art Clown, der sich bemühte Freude auszustrahlen, aber ihm war deutlich anzumerken, dass es ihn ziemlich abnervte, dass Statuen-Joe die ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. An der Ostseite des Platzes waren verschiedene Restaurants, vor denen sich die Menschen sonnten und Kaffee tranken, während ihre Shoppingtüten wohlbehütet neben ihren Stühlen standen. Der ein oder andere Hund gönnte sich unter den Tischen ein Mittagsschläfchen im Schatten. Weißbier war auch schon zahlreich auf den Tischen verteilt und obwohl es noch sehr früh am Mittag war, konnte ich aus der Entfernung sogar schon ein paar Schweinshaxen erkennen, die auf großen Tabletts von den Kellnern und Kellnerinnen des jeweiligen Lokals zur Kundschaft getragen wurden. Und dann sah ich es endlich: Das Neue Rathaus. Der Bau ragte in die Höhe, strotzend vor neugotischem Stil - oderso. Ich hatte während der U-Bahn-Fahrt noch kurz den zugehörigen Wikipedia-Artikel überflogen und das war das einzige, was hängen geblieben war. Egal. Ich erkannte ihn sofort, den Rathausbalkon, das Epizentrum jeder Meisterfeier des FCB. Auf diesem Balkon standen die Spieler, jubelten in die Menge, die sich unter ihnen auf dem Marienplatz versammelt hatte und präsentierte ihnen die Meisterschale, den DFB-Pokal und ab und zu auch den Henkelpott. Ich machte ein paar Fotos und versuchte mir vorzustellen, wie der Blick wohl von da oben, einen Pokal hochhaltend während die Menge einem zujubelt, war. Das muss doch der Traum eines jeden Fußballspielers sein. Ich machte gefühlt hundert Fotos und schaffte es sogar mit einigen Verrenkungen und missglückten Versuchen, eines mit mir und dem Rathausbalkon im Hintergrund zu machen, das ich direkt Konstantin schickte, dessen Antwort prompt kam: Hasse dich du Glückspilz! Als meine Mutter nach gut zehn Minuten, die ich nur damit verbracht hatte, den Rathausbalkon abzulichten, ungeduldig anmerkte, dass sie auch noch ein paar Einkäufe tätigen wollte und ich meinem Vater, Daddy-Joe, ansah, dass es bei ihm wohl demnächst Zeit für eine Schweinshaxe war, erkannte ich, dass es wohl besser war, die Erfüllung beider Wünsche durch noch zehn weitere Bilder nicht weiter aufzuschieben. Meiner Mutter war ihr Einkaufsbummel da aber doch wichtiger, als dass er sich durch so etwas Unnötiges wie Mittagessen aufschieben ließ. Sie parkte uns in einem urig aussehenden Bierkeller, während sie loszog und verkündete, sie käme uns in zwei Stunden an eben diesem Ort abholen. Ich kam mir vor wie mit drei Jahren, als sie mich mit in ein Möbelgeschäft nahm und mich für ein paar Stunden im Spieleparadies absetzte, um für uns in Ruhe eine neue Wohnzimmer-Couch auszusuchen. Aber damals wie heute war mir das ziemlich schnuppe. Damals konnte ich mich in Ruhe austoben, heute mit meinem Vater gemütlich essen und Weißbier trinken. Das Augustiner-Bräu in München ist der älteste bestehende Bierkeller und keine Ahnung, ob meine Mutter dieses Ziel bewusst angesteuert hatte, um uns dort loszuwerden, aber es war schon ein wenig Glück dabei, dass sie uns genau vor diesem geschichtsträchtigen Bierkeller stehen ließ. Und es war ein richtiger Keller! Hohe Decken, lange Holztische und in den Ecken standen noch kupferfarbene Braukessel. Junge Frauen im Dirndl schwirrten durch den riesigen Bierkeller, immer mindestens fünf Biere in einer Hand oder zehn auf einem Tablett. Bemerkenswerter Weise sah es so aus, als schwebten die Tablette einfach grazil auf den Händen der Damen, als hätten sie nicht mehr als das Gewicht einer Feder hochzustemmen. Eine Bedienung, die ausnahmsweise nicht mit dem Stemmen von Biergläsern beschäftigt war, kam auf uns zu und deutete auf den kleinsten Tisch im ganzen Lokal, der aber immer noch Platz für sechs Personen bot. Direkt daneben stand eine lange Tafel an der ausschließlich Mönche saßen, wahrscheinlich Augustiner-Mönche, die sich unterhielten und ebenfalls, wie sollte es auch anders sein, Weißbier als Grundnahrungsmittel vor sich stehen hatten. Spitzenreiter war ein Mönch am Kopfende des Tisches, der beträchtliche fünf (leere) Gläser vor sich stehen hatte und gerade die Bedienung herbeirief, um sich Nummer sechs zu gönnen. In gewisser Weise schien er die Diskussion auch irgendwie zu leiten. Vielleicht war er der „Vorgesetzte“ der restlichen Mönche. So genau kannte ich mich in der kirchlichen Hierarchie dann doch nicht aus. Aber es zeigte in gewisser Weise, dass der, der auch am meisten Saufen konnte, das Sagen hatte, was ich schon lustig fand, vielleicht war es aber auch nur Zufall. Mein Vater und ich bestellten zum Trinken jeweils ein Weißbier und zum Essen orderte Daddy-Joe die Schweinshaxe, auf die er, wie es schien, seit klar war, dass wir nach München fahren würden, gewartet hatte. Ich würde Leberkäs mit Pommes bekommen. Sowohl das Weißbier, das nicht zu herb und schön fruchtig-frisch war, als auch das deftige Essen lösten ein wohliges Gefühl in mir aus. Während Alpha-Bruder Simon, dessen Namen ich durch das laute Gespräch der Mönch-Meute mitbekommen hatte, Weißbier Nummer sieben hinunterschüttete als wäre es das Blut Christi persönlich, unterhielten sich mein Vater und ich über das bevorstehende Spiel am nächsten Tag, die Allianz Arena und wie es mir bis jetzt so gefiel. Ich versicherte, dass es mehr als dem entsprach, was ich mir so ausgemalt hatte und dass meine Vorfreude, morgen das Stadion des FC Bayern von innen zu sehen, sich in dem Maße in Grenzen hielt, wie der Durst von Bruder Simon. Wir plauderten über Fußball, die Situation in der Liga, kritisierten nach Herzenslust Spieler und machten Witze über Mama, dass sie wieder voll im Einkaufsrausch war und sich gar nicht bremsen ließ, dass sie wahrscheinlich gerade ihren berühmten Shopping-Tunnelblick aufgesetzt hatte, bei dem sie alles um sich herum, inklusive uns beide, vergaß und sich einfach nur auf die tollsten und reduziertesten Teile stürzte. Solche Momente genieße ich immer sehr auf Reisen. Zuhause ist das Verhältnis zwischen meinen Eltern und mir zum Teil echt angespannt. Da spielen Faktoren wie Schule, ständige Partys und die eher nicht so große Lust auf Hausarbeiten eine nicht unwichtige Rolle. Das Diskutieren, warum denn schon wieder die letzte Arbeit verkackt wurde, warum wieder ein Fünfziger für Saufen draufgegangen ist und warum ich nicht bereit bin, ihrer Meinung nach, sie nicht mal mehr im Haushalt zu unterstützen, trägt nicht gerade zu einer ständigen Harmonie bei. Aber wenn wir dann mal aus dem ganzen Stress raus sind, weit weg von alldem, wenn man bereit ist, mal den Alltag, sei es nur für ein Wochenende, zu vergessen, dann merke ich, wie gut es dann ist, wie gut ich eigentlich mit ihnen klarkomme und wie froh ich bin, dass meine Eltern so sind wie sie sind und dass ich sie habe und sie mir so tolle Erlebnisse ermöglichen. Ein Gefühl, das einen kleinen Dämpfer erhielt, als ich die Einkaufstüten meiner Mutter, in denen dem Anschein nach Backsteine statt Klamotten drin waren, zum Feinkostgeschäft Dallmayr tragen durfte, in das sie unbedingt noch rein musste, bevor wir zurück ins Hotel fuhren. Ich wollte nicht mit hinein. Es sah von außen zwar ganz interessant aus, aber das einzige, was ich mit dem Namen verband, waren Kaffeebohnen und ich ging stark davon aus, dass Kaffee in fester Form und ohne Koffein mein Herz nicht gerade schneller schlagen ließ. Ich setzte mich auf eine Bank, die an einem Platz stand, dessen Name ich nicht kannte. Aber in diesem Moment wusste ich irgendwie, wenn es mir nicht schon die ganze Zeit klar war, dass ich mal in München studieren muss, nicht nur will, sogar muss. In dieser Seitenstraße der Hauptfußgängerzone war eine große Liegewiese, auf der Studenten picknickten, die Sonne genossen, sich ausruhten oder was auch immer taten. Links von meiner Bank stand eine Art Straßenrandorchester. Bestimmt gibt es eine offizielle Bezeichnung dafür, die ich aber nicht kenne und die ich auch seitdem nicht rausbekam, vielleicht aber auch, weil ich nie danach gesucht hatte, weil mir das Wort gefiel. Da stand einfach an der Ecke dieses Platzes, der ein bisschen in den Boden eingelassen war, also tiefer als die eigentliche Straße lag, auf der obersten Stufe, die runter zum Grün führte, ein riesiger Flügel, an dem ein Pianist in einem feinen Anzug saß. Auf den restlichen Stufen verteilt gab es noch eine Violinistin, eine Kontrabassspielerin, einen Trompeter und auf der untersten Stufe einen Dirigenten, alle ebenso schick wie der Pianist. Sie spielten nach und nach klassische Stücke und sorgten damit für dezente musikalische Untermalung des Ganzen. Ich malte mir aus, wie ich als Student hier liegen würde, ein langer Tag an der Uni war vorüber, ich würde mit Konstantin und Thommy hier ein bisschen chillen, die Sonne genießen, bevor wir uns zum Feiern in der Nacht fertig machen würden, während Mozarts kleine Nachtmusik im Hintergrund spielt. Die Vorstellung war irgendwie surreal, aber es passierte ja tatsächlich vor meinen Augen. Da lagen ja Studenten, für die das alles ganz normal war. Und das wollte ich auch. Ich wollte diesen surreal erscheinenden Alltag, der wohl irgendwann total unspektakulär werden würde, was im Moment aber noch außerhalb meiner Vorstellungskraft lag. Und während meine Eltern Kaffeebohnen bestaunten, tat ich so, als wäre es schon so, stellte es mir vor und war glücklich ein Teil dieses Gefühls zu sein, dieses Liegewiesen-Gefühls in einer Seitenstraße des Großstadtdschungels.
.....
Als ich im Frühling meinen Koffer packte, um ein Wochenende in der Stadt meines Vereines zu verbringen, wusste ich noch nichts von der im Mai bevorstehenden Schmach und der bitteren Pille, die ich als Fan zu schlucken haben würde. Man war in allen drei Wettbewerben noch sehr gut dabei und selbst ein Triple war nicht ausgeschlossen. Ich war extrem aufgeregt, endlich mal die Allianz Arena live miterleben zu dürfen und konnte in der Nacht vor der Reise vor lauter Aufregung nicht einschlafen. Das holte ich aber dann auf den fünf Stunden Fahrt in die Hauptstadt Bayerns nach. Eine längere Autofahrt wirkt auf mich immer wie eine Art Betäubungsmittel und das ist keine Übertreibung. Die fünf Stunden, die ich alleine auf der Fahrt nach München, durchgeschlafen habe, waren nichts im Vergleich zu meinem längsten Marathon-Nickerchen. Unvergessen und nie mehr erreicht war mein 14-Stunden-Schlaf während der Fahrt nach Barcelona. Während meine Eltern zwischendurch fünfmal Rast machten, sogar eine Stunde zu Mittag aßen und mich dabei im Auto ließen, zweieinhalb Stunden im Stau standen und meine ganzen Naschvorräte, die ich von meiner Oma für die Fahrt geschenkt bekommen hatte, verzehrten, schlief ich seelenruhig auf der Rückbank und schlug erst wieder die Augen auf, als wir das Ortsschild von Barcelona passierten. Viele Erklärungsversuche, von der Vermutung, dass die Rückbank einfach zu bequem sei, was, wie ich aus eigener Erfahrung berichten konnte, sicherlich nicht der Fall war, bis zur Unterstellung, ich hätte eine seltene Schlafkrankheit, woraufhin mich sogar ein Arzt nach beharrlichem Drängen meiner Mutter untersuchte, stellten sich als Fehleinschätzungen heraus und irgendwann akzeptierten meine Eltern, dass ich sobald mein Vater auf die Autobahn auffuhr, in einen komatösen Tiefschlaf versetzt wurde, der solange anhielt, bis das angepeilte Ziel erreicht wurde. Ich persönlich sah es als Gabe an, langweilige und zermürbende Autofahrten mit einem kleinen oder im Falle Barcelona auch größeren Nickerchen überbrücken zu können. Ein weiterer positiver Nebeneffekt war, dass ich nach längeren Fahrten ausgeruht und fit wie ein Turnschuh war, während meine Eltern den ersten Tag jeder Reise damit verplemperten, sich von der langen und kräftezehrenden Fahrt zu erholen. Aber in München würde das nicht laufen. Nicht mit mir. Das hatte ich ihnen schon klargemacht. Wir hatten nur ein Wochenende und an dem wollte ich alles erleben, was es in München nur zu erleben gab. Außerdem hatte ich ihre Besorgnis über meinen ungewöhnlichen Schlafrhythmus, sobald eine Reise anstand, sowieso noch nie verstanden. Während andere Kinder permanent unruhig in ihrem Kindersitz hin und her rutschen und alle fünf Minuten die berühmt berüchtigte Frage Wann sind wir da? quengelten, war ich stets ein sehr ruhiger Begleiter und stellte meine Erzieher nie vor eine nervliche Zerreißprobe, worüber andere Eltern froh gewesen wären, aber wie man es als Kind macht, macht man es verkehrt. Das ist bitterer Fakt. Ich wachte indem Moment auf, indem man aus dem Autofenster von der Autobahn aus schon die Allianz Arena sehen konnte und ich brauchte einige Augenblicke, um zu realisieren, dass ich nicht mehr schlief und das hier kein Traum war, sondern dass ich inzwischen aufgewacht war und nun das gigantische Rund und die ganze Aura dieses Stadions miterleben durfte - war es auch nur für einige Momente und aus beträchtlicher Entfernung. Nachdem wir sie passiert hatten, verrenkte ich mir noch lange den Hals, um sie nicht aus meinem Blickfeld zu verlieren. „Na, ausgeschlafen?“, fragte meine Mutter und grinste mich vom Beifahrersitz aus verschmitzt an. Ich nickte verschlafen und rieb mir die Augen. Auf dem Weg zu unserem Hotel, das Kempinski Hotel Airport München, fuhren wir am Herz einer jeden Großstadt, dem Flughafen, vorbei. Dass unser Hotel quasi zum Flughafen dazugehörte fand ich besonders spannend, da Flughäfen mich von je her faszinierten. Sie strahlen eine Freiheit und Vielfältigkeit aus, die einem die komplette Welt greifbar und erreichbar machte. Leute aus aller Herrenländer und Kulturen, die vor ein paar Stunden noch am anderen Ende der Welt verweilten, tummelten sich plötzlich tausende Kilometer von ihrer Heimat weg und es ist scheinbar das Normalste der Welt. Dieses Gefühl faszinierte mich irgendwie und während meine Eltern noch auspackten, machte ich mich direkt auf den Weg zur Besucherterrasse, von der aus man einen guten Blick auf die Start- und Landebahn hatte. Ich stand mindestens eine halbe Stunde lang einfach nur so da und beobachtete, wie eine Maschine nach der anderen abhob. Die eine vielleicht nach Los Angeles, die nächste wiederum vielleicht nach Johannesburg. Während ich weiter durch den Flughafen streifte und das geschäftige Treiben der Menschen genoss, die sich bald alle mit ihren Koffern und Taschen irgendwo in der Welt zerstreuen würden, faszinierte mich vor allem die große Videoleinwand, auf der die Informationen über die Abflüge und Ankünfte eingeblendet wurden. Und als ich so dastand und mein Blick von New York nach Singapur schweifte, bekam ich diese Lust, die mich seitdem immer an Flughäfen überkommt: Am liebsten in den nächsten Flieger steigen und einfach ganz weit wegfliegen. Vielleicht hätte ein Flugzeug sogar denselben Effekt auf mich wie ein Auto und im Handumdrehen wäre ich in den USA. Auch als ich den Terminal zurück in Richtung des Hotels verließ, blieb das Gefühl und vermischte sich mit der Vorfreude auf die Stadt, in der ich gerade war. Ich stellte mir vor, wie irgendein anderer gerade am anderen Ende der Welt stand, auf so eine Tafel blickte und dachte, wie toll es jetzt wäre, einfach mal nach München zu fliegen und ich selbst war in München, in dieser Weltstadt. Ich fühlte mich als Teil davon und als ich die Hotelhalle mit den in die Höhe ragenden Palmen, die fast die Decke zu berühren schienen, betrat, während beschäftigt wirkende Geschäftsleute in den roten Lounge-Sessel saßen, die New York Times lasen und Espressi tranken, verstärkte sich dieser Eindruck noch. Ich machte es mir in einem der Sessel gemütlich, tat so als würde ich geschäftig die sich ständig aktualisierenden Ankunft- und Abflugzeiten studieren und wartete auf meine Eltern, die sich auf unserem Zimmer noch schnell für unseren Trip in die Innenstadt frisch machten. Es dauerte nicht lange, bis eine charmante junge Dame von der Bar aus zu mir geschwebt war und mich mit ihrem schönsten Zahnpastalächeln fragte, ob ich denn gerne etwas zu trinken hätte. Wenn ich charmante junge Dame sage, meine ich, dass sie verdammt heiß war. Ich blickte sie einen Moment perplex an, lehnte dann jedoch dankend ab. Sie schwebte zurück zur Bar, hatte offenbar gemerkt, dass ich ihr nachgesehen hatte und grinste noch einmal. Schade, ich hätte zu gerne was bei ihr bestellt, irgendwas um verdammt cool und seriös zu wirken. Vielleicht einen Martini, geschüttelt, nicht gerührt, à la James Bond. Oder einen alten Whiskey - schön lässig. Sie war zwar gut und gerne fünf Jahre älter als ich, aber dieser Umstand hinderte mich nicht daran, München immer besser zu finden. Und die eigentliche Stadt hatte ich noch gar nicht gesehen. Meine Eltern ließen jedoch nicht lange auf sich warten. Der Plan war, heute ein bisschen die Innenstadt zu erkunden, was für meine Mutter hieß: Eine Boutique nach der anderen unsicher machen. Für mich und meinen Vater hieß es, mein Erspartes im FCB-Fanshop auf den Kopf zu hauen, danach in irgendeinem großen Biergarten Weißbier zu trinken und schön deftig zu essen- typisch bayrisch eben. Wir fuhren mit dem Auto zu einem der Park&Ride-Plätze, die überall im Großraum München verteilt waren und von denen man bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt fahren konnte, in der die Chance, einen Parkplatz zu finden, ungefähr so hoch war, wie eine WM-Teilnahme von San Marino. Mein Vater hatte geplant am Park&Ride im Münchner Vorort Daglfingen den Wagen abzustellen, von wo es gerade einmal zwei S-Bahn Stationen zum Marienplatz waren. Während wir durch Daglfingen fuhren, kam mir der Gedanke, dass, wenn ich vorher ein bisschen eingedöst wäre, ich hätte denken können, dass wir München verlassen hatten und durch eine mittlere Kleinstadt in irgendeinem beschaulichen Landkreis fahren würden. Kleine, beschauliche Anwesen mit gepflegten Vorgärten und einer Doppelgarage. Kinder im Grundschulalter, die Roller und Fahrrad fuhren. Ein paar Jugendliche, die eventuell so alt waren wie ich, saßen an einem Kiosk in Strandstühle, solche, wie man sie von der Nord- oder Ostsee kennt, ließen sich die Sonne auf den Pelz scheinen und tranken Bier aus Dosen. Es war Freitagnachmittag. Wenn ich hier wohnen würde, wäre ich einem ähnlichen Start ins Wochenende nicht abgeneigt. Nichts deutete darauf hin, dass sich nur zwei S-Bahn Stationen weiter das Zentrum einer Millionenstadt befand. Es hätte gut und gerne einen Ort von meiner öden Kleinstadt entfernt sein können - es wäre mir nicht aufgefallen. Aber irgendwie, dachte ich, während ich an der S-Bahn Station saß und auf der anderen Seite des Gleises einen Mann erblickte, der neue Plakate an einer riesigen Werbetafel anbrachte, irgendwie machte das gerade dieses Fleckchen aus. Daglfingen war halt nicht in irgendeinem unbekannten Landkreis, mehrere Autostunden von München entfernt. Es lag mitten in München, tagsüber am Kiosk in der Sonne relaxen und abends zwei S-Bahn Stationen in die Innenstadt – dahin, wo die Action stattfand. Nicht schlecht. Die S-Bahn kam und spätestens dann wurde mir noch einmal klar, dass ich zum Glück nicht zu Hause, sondern in einer pulsierenden Metropole war. Männer in Anzügen und einem Macbook auf dem Schoß, sprachen in fast akzentfreiem Englisch mit anscheinend niemandem, bis ich bemerkte, dass der eine ein Headset im Ohr hatte. Eine Frau las Zeitung, eine andere hörte Musik. Ein Junkie in zerrissener Hose, Nietengürtel und oberkörperfrei schniefte permanent - wahrscheinlich Koks. Arme Socke. Aber die Möglichkeit hier auf die schiefe Bahn zu geraten, war wahrscheinlich höher als auf dem Land. Und in gewisser Weise gehörte auch dies leider zum Charakter einer Weltstadt dazu. In jedem Bahnhof, in den die Bahn einfuhr, drängelten sich mindestens hundert Leute - die einen Richtung Ausgang, die anderen Richtung Bahn. Während meiner Mutter das hektische Treiben nicht so gefiel, fand ich es ja irgendwie spannend. Das alles war so fremd für mich und für diese ganzen Leute doch so normal, dass ich mich in gewisser Weise unwohl fühlte, weil ich nicht wusste, ob man mir diese Unwissenheit ansah. Der Dorftrottel in der großen Stadt. Das würde doch jedem auffallen. Es war als würde es auf meiner Stirn stehen. Aber auf der anderen Seite, fand ich es so toll, ein Teil dieses Ganzen zu sein, dass das unwohle Gefühl sich ziemlich schnell in ein unbekümmertes und fasziniertes verwandelte. An der Haltestelle zum Marienplatz kam die Hektik dann zum Höhepunkt. Aber irgendwie hat Hektik so einen negativen Touch - ähnlich wie Melancholie oder Wehmut, deshalb nenne ich es auch einfach hier schöne Hektik. Für mich war es so. Menschenmassen, die einerseits in die Züge, andererseits zu den zahlreichen Ausgängen strömten, ein Stimmengewirr, gemischt mit dem hallenden Geräusch einfahrender und ausfahrender Züge, ich mittendrin, durchschlendernd, auf der Rolltreppe nach oben, das alles noch einmal beobachtend und festhaltend, was für die anderen stupider Alltag war. Eine echt schöne Hektik. Oben angekommen verwandelte sich die Kühle und Schummerigkeit des U-Bahn-Schachts schlagartig in angenehme Wärme und Helligkeit, als die ersten Strahlen der Frühlingssonne meine Augen kitzelten. Temperatur und Lichtverhältnisse standen in krassem Kontrast. Die Hektik blieb. Ich setzte meine Sonnenbrille auf, blickte direkt in die Sonnenstrahlen und genoss die Aussicht auf den Marienplatz. Vor mir hatte sich eine Menschengruppe gebildet, die sich um eine Art Statue drängelte, Fotos machte und das Abbild eines kleinen Mannes mit Hut anstarrten, der auf einem vergilbten metallgelben Sockel stand und in derselben Farbe in erhabener Pose mit starren Augen in die Mittagssonne stierte. Ich hätte meine Mutter gefragt, wer denn diese Persönlichkeit sein sollte, wollte aber als erklärter München-Fan meine Unwissenheit nicht preisgeben. Ich schob mich ein bisschen nach vorne, um einen besseren Blick erhaschen zu können, vielleicht sogar, um auf dem Sockel einen Namen und Lebenszeitraum der Person erkennen zu können. Um mich herum weiter Blitzlicht, zum Teil von Smartphonekameras, ich hörte wie eine Mutter ihr kleines Mädchen dazu animierte, doch einmal nach vorne zum Denkmal zu gehen, damit sie sie davor fotografieren konnte. Ich verfolgte das Gespräch kurz, um mehr über den Mann herauszufinden, der anscheinend eine ganz große Nummer war, aber nachdem die Kleine mit einem lauten Quengeln deutlich gemacht hatte, dass ihr gar nicht danach war, sich mit irgendeinem Messingmann ablichten zu lassen, wandte ich meinen Blick wieder zum Denkmal. Ich erschrak höllisch. Die Statue, die eigentlich, so zumindest in meiner benebelten Kleinstadtwahrnehmung, ein paarhundert Jahre regungslos an ein und demselben Ort verbringen sollte, bis sie irgendwann in einer Revolution oder bei einem Erdbeben umgestürzt würde, entsprach ganz und gar nicht dieser Vorstellung. Nachdem es ungefähr fünf Minuten lang so ausgesehen hatte, als wäre es ein ganz normales Denkmal, posierte die „Statue“ auf dem Sockel nun freudig für die zahlreich gezückten Kameras, warf einer Gruppe junger Frauen, die scheinbar einen Junggeselleninnenabschied feierten, ein paar Luftküsse zu und genoss die verdutzten Gesichter der unwissenden Touristen, wie ich selbst einer war. Ich war einer gewöhnlichen Großstadtattraktion auf den Leim gegangen, die aber, das musste ich zugeben, sich extrem gut darstellte und präsentierte. Die metallgelbe Farbe schimmerte so real und echt in der Mittagssonne, dass ich, bis sich der Schausteller zum ersten Mal bewegte, im wahrsten Sinne des Wortes, keinen blassen Schimmer hatte, dass es sich nur um einen Fake und nicht um eine reale Persönlichkeit des Münchner Hochadels von vor zweihundert Jahren handelte. Da ich nun keinen passenden Namen für den Messingmann hatte, nannte ich ihn kurzerhand Statuen-Joe. Konstantin, Thommy und ich hatten uns angewöhnt, Personen, deren Namen wir nicht genau kannten, oder ihn einfach doof fanden, andere Namen zu geben, die sich zum Teil auf ihr Aussehen, zum Teil auf Vorlieben oder ihren Charakter bezogen. Damit das auch irgendwie cool und lässig klang, hatte es sich bei uns eingebürgert, das wir hinter der neuen Bezeichnung für die jeweilige Person, den Namen Joe hängten. So wurde von uns ein Mitschüler, der letztes Jahr sein Abitur gemacht hatte und aussah als wäre er Bob Marleys Zwillingsbruder, einfach in Rasta-Joe umgetauft. So setzte sich das an unserer Schule fort, es gab Punker-Joe, Metal-Joe und Locken-Joe. Locken-Joe hat schätzungsweise seit seiner Geburt nie einen Friseursalon von innen gesehen und Metal-Joe hatte nach Wacken letzten Sommer ein paar Risse in den Stimmbändern. Seitdem fiel es uns bei ihm schwer, sich zwischen Metal- und Stimmband-Joe zu entscheiden. Auch unsere Lehrer blieben davon nicht verschont. Eine Lehrerin an unserer Schule gab Französisch und Chemie und noch heute weiß ich nicht wie in Gottes Namen man sich als Frau diese Kombination aussuchen konnte. Sie sah zum Glück aber eher nach Französisch als nach Chemie aus und trug immer Röcke. In ihrem Kleiderschrank schien es keine normale Hose zu geben. Egal ob minus vierzig Grad und Dauerblizzard, die gute Dame hatte keinen Bock auf lange Hosen. Vielleicht zeigte sie gerne ihre Beine. Sie waren ganz okay, aber ein Model stellte sie damit nicht in den Schatten. Als Thommy auf dem Schreibtisch in ihrem Büro dann noch AC/DC-Karten fand, stand dem Namen Rock-Joanne nichts mehr im Wege. Selbst mein Vater blieb von dieser Angewohnheit nicht verschont. Bei einem unserer Grillabende bei mir im Garten bekam er unweigerlich mit, wie wir uns über Rock-Joanne und Locken-Joe unterhielten. Er wollte wissen, was es damit auf sich hatte. Wir erklärten es ihm und seitdem ist mein alter Herr bei meinen Freunden nur noch als Daddy-Joe bekannt. Ich muss zugeben, es klingt schon irgendwie besser. Bei genauem Hinsehen erkannte man aber auch eine vor Statuen-Joe ausgebreitete Schatulle, in die großzügige Passanten Kleingeld werfen konnten - als Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit des Schaustellers. Auch ich zückte sofort meinen Geldbeutel. Wer mich auf so stilvolle Weise verarscht, der hat mein Geld echt verdient. Mein Blick, der die ganze Zeit nur am Denkmal hing und sich im strahlendblauen Himmel verlor, schwenkte nun weiter und erkundete den Rest des Platzes. Unweit von Statuen-Joe war ein weiterer Schausteller, eine Art Clown, der sich bemühte Freude auszustrahlen, aber ihm war deutlich anzumerken, dass es ihn ziemlich abnervte, dass Statuen-Joe die ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. An der Ostseite des Platzes waren verschiedene Restaurants, vor denen sich die Menschen sonnten und Kaffee tranken, während ihre Shoppingtüten wohlbehütet neben ihren Stühlen standen. Der ein oder andere Hund gönnte sich unter den Tischen ein Mittagsschläfchen im Schatten. Weißbier war auch schon zahlreich auf den Tischen verteilt und obwohl es noch sehr früh am Mittag war, konnte ich aus der Entfernung sogar schon ein paar Schweinshaxen erkennen, die auf großen Tabletts von den Kellnern und Kellnerinnen des jeweiligen Lokals zur Kundschaft getragen wurden. Und dann sah ich es endlich: Das Neue Rathaus. Der Bau ragte in die Höhe, strotzend vor neugotischem Stil - oderso. Ich hatte während der U-Bahn-Fahrt noch kurz den zugehörigen Wikipedia-Artikel überflogen und das war das einzige, was hängen geblieben war. Egal. Ich erkannte ihn sofort, den Rathausbalkon, das Epizentrum jeder Meisterfeier des FCB. Auf diesem Balkon standen die Spieler, jubelten in die Menge, die sich unter ihnen auf dem Marienplatz versammelt hatte und präsentierte ihnen die Meisterschale, den DFB-Pokal und ab und zu auch den Henkelpott. Ich machte ein paar Fotos und versuchte mir vorzustellen, wie der Blick wohl von da oben, einen Pokal hochhaltend während die Menge einem zujubelt, war. Das muss doch der Traum eines jeden Fußballspielers sein. Ich machte gefühlt hundert Fotos und schaffte es sogar mit einigen Verrenkungen und missglückten Versuchen, eines mit mir und dem Rathausbalkon im Hintergrund zu machen, das ich direkt Konstantin schickte, dessen Antwort prompt kam: Hasse dich du Glückspilz! Als meine Mutter nach gut zehn Minuten, die ich nur damit verbracht hatte, den Rathausbalkon abzulichten, ungeduldig anmerkte, dass sie auch noch ein paar Einkäufe tätigen wollte und ich meinem Vater, Daddy-Joe, ansah, dass es bei ihm wohl demnächst Zeit für eine Schweinshaxe war, erkannte ich, dass es wohl besser war, die Erfüllung beider Wünsche durch noch zehn weitere Bilder nicht weiter aufzuschieben. Meiner Mutter war ihr Einkaufsbummel da aber doch wichtiger, als dass er sich durch so etwas Unnötiges wie Mittagessen aufschieben ließ. Sie parkte uns in einem urig aussehenden Bierkeller, während sie loszog und verkündete, sie käme uns in zwei Stunden an eben diesem Ort abholen. Ich kam mir vor wie mit drei Jahren, als sie mich mit in ein Möbelgeschäft nahm und mich für ein paar Stunden im Spieleparadies absetzte, um für uns in Ruhe eine neue Wohnzimmer-Couch auszusuchen. Aber damals wie heute war mir das ziemlich schnuppe. Damals konnte ich mich in Ruhe austoben, heute mit meinem Vater gemütlich essen und Weißbier trinken. Das Augustiner-Bräu in München ist der älteste bestehende Bierkeller und keine Ahnung, ob meine Mutter dieses Ziel bewusst angesteuert hatte, um uns dort loszuwerden, aber es war schon ein wenig Glück dabei, dass sie uns genau vor diesem geschichtsträchtigen Bierkeller stehen ließ. Und es war ein richtiger Keller! Hohe Decken, lange Holztische und in den Ecken standen noch kupferfarbene Braukessel. Junge Frauen im Dirndl schwirrten durch den riesigen Bierkeller, immer mindestens fünf Biere in einer Hand oder zehn auf einem Tablett. Bemerkenswerter Weise sah es so aus, als schwebten die Tablette einfach grazil auf den Händen der Damen, als hätten sie nicht mehr als das Gewicht einer Feder hochzustemmen. Eine Bedienung, die ausnahmsweise nicht mit dem Stemmen von Biergläsern beschäftigt war, kam auf uns zu und deutete auf den kleinsten Tisch im ganzen Lokal, der aber immer noch Platz für sechs Personen bot. Direkt daneben stand eine lange Tafel an der ausschließlich Mönche saßen, wahrscheinlich Augustiner-Mönche, die sich unterhielten und ebenfalls, wie sollte es auch anders sein, Weißbier als Grundnahrungsmittel vor sich stehen hatten. Spitzenreiter war ein Mönch am Kopfende des Tisches, der beträchtliche fünf (leere) Gläser vor sich stehen hatte und gerade die Bedienung herbeirief, um sich Nummer sechs zu gönnen. In gewisser Weise schien er die Diskussion auch irgendwie zu leiten. Vielleicht war er der „Vorgesetzte“ der restlichen Mönche. So genau kannte ich mich in der kirchlichen Hierarchie dann doch nicht aus. Aber es zeigte in gewisser Weise, dass der, der auch am meisten Saufen konnte, das Sagen hatte, was ich schon lustig fand, vielleicht war es aber auch nur Zufall. Mein Vater und ich bestellten zum Trinken jeweils ein Weißbier und zum Essen orderte Daddy-Joe die Schweinshaxe, auf die er, wie es schien, seit klar war, dass wir nach München fahren würden, gewartet hatte. Ich würde Leberkäs mit Pommes bekommen. Sowohl das Weißbier, das nicht zu herb und schön fruchtig-frisch war, als auch das deftige Essen lösten ein wohliges Gefühl in mir aus. Während Alpha-Bruder Simon, dessen Namen ich durch das laute Gespräch der Mönch-Meute mitbekommen hatte, Weißbier Nummer sieben hinunterschüttete als wäre es das Blut Christi persönlich, unterhielten sich mein Vater und ich über das bevorstehende Spiel am nächsten Tag, die Allianz Arena und wie es mir bis jetzt so gefiel. Ich versicherte, dass es mehr als dem entsprach, was ich mir so ausgemalt hatte und dass meine Vorfreude, morgen das Stadion des FC Bayern von innen zu sehen, sich in dem Maße in Grenzen hielt, wie der Durst von Bruder Simon. Wir plauderten über Fußball, die Situation in der Liga, kritisierten nach Herzenslust Spieler und machten Witze über Mama, dass sie wieder voll im Einkaufsrausch war und sich gar nicht bremsen ließ, dass sie wahrscheinlich gerade ihren berühmten Shopping-Tunnelblick aufgesetzt hatte, bei dem sie alles um sich herum, inklusive uns beide, vergaß und sich einfach nur auf die tollsten und reduziertesten Teile stürzte. Solche Momente genieße ich immer sehr auf Reisen. Zuhause ist das Verhältnis zwischen meinen Eltern und mir zum Teil echt angespannt. Da spielen Faktoren wie Schule, ständige Partys und die eher nicht so große Lust auf Hausarbeiten eine nicht unwichtige Rolle. Das Diskutieren, warum denn schon wieder die letzte Arbeit verkackt wurde, warum wieder ein Fünfziger für Saufen draufgegangen ist und warum ich nicht bereit bin, ihrer Meinung nach, sie nicht mal mehr im Haushalt zu unterstützen, trägt nicht gerade zu einer ständigen Harmonie bei. Aber wenn wir dann mal aus dem ganzen Stress raus sind, weit weg von alldem, wenn man bereit ist, mal den Alltag, sei es nur für ein Wochenende, zu vergessen, dann merke ich, wie gut es dann ist, wie gut ich eigentlich mit ihnen klarkomme und wie froh ich bin, dass meine Eltern so sind wie sie sind und dass ich sie habe und sie mir so tolle Erlebnisse ermöglichen. Ein Gefühl, das einen kleinen Dämpfer erhielt, als ich die Einkaufstüten meiner Mutter, in denen dem Anschein nach Backsteine statt Klamotten drin waren, zum Feinkostgeschäft Dallmayr tragen durfte, in das sie unbedingt noch rein musste, bevor wir zurück ins Hotel fuhren. Ich wollte nicht mit hinein. Es sah von außen zwar ganz interessant aus, aber das einzige, was ich mit dem Namen verband, waren Kaffeebohnen und ich ging stark davon aus, dass Kaffee in fester Form und ohne Koffein mein Herz nicht gerade schneller schlagen ließ. Ich setzte mich auf eine Bank, die an einem Platz stand, dessen Name ich nicht kannte. Aber in diesem Moment wusste ich irgendwie, wenn es mir nicht schon die ganze Zeit klar war, dass ich mal in München studieren muss, nicht nur will, sogar muss. In dieser Seitenstraße der Hauptfußgängerzone war eine große Liegewiese, auf der Studenten picknickten, die Sonne genossen, sich ausruhten oder was auch immer taten. Links von meiner Bank stand eine Art Straßenrandorchester. Bestimmt gibt es eine offizielle Bezeichnung dafür, die ich aber nicht kenne und die ich auch seitdem nicht rausbekam, vielleicht aber auch, weil ich nie danach gesucht hatte, weil mir das Wort gefiel. Da stand einfach an der Ecke dieses Platzes, der ein bisschen in den Boden eingelassen war, also tiefer als die eigentliche Straße lag, auf der obersten Stufe, die runter zum Grün führte, ein riesiger Flügel, an dem ein Pianist in einem feinen Anzug saß. Auf den restlichen Stufen verteilt gab es noch eine Violinistin, eine Kontrabassspielerin, einen Trompeter und auf der untersten Stufe einen Dirigenten, alle ebenso schick wie der Pianist. Sie spielten nach und nach klassische Stücke und sorgten damit für dezente musikalische Untermalung des Ganzen. Ich malte mir aus, wie ich als Student hier liegen würde, ein langer Tag an der Uni war vorüber, ich würde mit Konstantin und Thommy hier ein bisschen chillen, die Sonne genießen, bevor wir uns zum Feiern in der Nacht fertig machen würden, während Mozarts kleine Nachtmusik im Hintergrund spielt. Die Vorstellung war irgendwie surreal, aber es passierte ja tatsächlich vor meinen Augen. Da lagen ja Studenten, für die das alles ganz normal war. Und das wollte ich auch. Ich wollte diesen surreal erscheinenden Alltag, der wohl irgendwann total unspektakulär werden würde, was im Moment aber noch außerhalb meiner Vorstellungskraft lag. Und während meine Eltern Kaffeebohnen bestaunten, tat ich so, als wäre es schon so, stellte es mir vor und war glücklich ein Teil dieses Gefühls zu sein, dieses Liegewiesen-Gefühls in einer Seitenstraße des Großstadtdschungels.
Ich hab schon eine Ewigkeit nicht mehr an Liz gedacht, aber sie ist in der Erinnerung an München wieder aufgetaucht und es war kein schlechtes Gefühl. Damals im Auto auf der Rückfahrt fand ich das alles noch ganz schrecklich ungerecht, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass es damals wohl für mein 15-jähriges Ich ein nahezu perfektes Wochenende war. Ich hatte die Stadt meiner Träume entdeckt, hatte mich in der besten Arena der Welt verknallt, wobei ich hier bewusst das Wort verknallt benutze. Während es inzwischen so dunkel war, dass ich von den meisten Autos um uns herum, nur noch die Scheinwerfer erkennen konnte, fielen mir ein paar Worte ein, die ich irgendwann einmal gehört hatte. Ich musste eine Zeit lang überlegen, aber nach ein bisschen Grübeln fiel es mir dann doch wieder ein. Es war gar nicht allzu lange her, zwei Orte weiter findet jedes Jahr ein Frühlingsfest statt. Es wird von manchen jungen Leuten in der Region auch SpringBreak genannt, aber das Fest, das auf einem großen Parkplatz mitten in der Stadt stattfindet, ist soweit vom amerikanischen SpringBreak in Florida entfernt, wie wir von der Sonne. Immerhin passt die Jahreszeit und wenn man Leuten davon erzählt, die sich nicht wirklich auskennen, wie wenig es mit wirklicher Party und Feiern zu tun hat, dann hört es sich schon etwas cooler an als Frühlingsfest. Thommy, Konstantin und ich hatten Connections zum Getränkewagen und so kamen wir, obwohl wir damals erst fünfzehn waren, an Bier, wann immer wir wollten. Auf der Festbühne spielte ein Solokünstler mit Akustikgitarre. Er sang ein paar traurige Lieder auf Englisch und redete zwischendurch mit dem Publikum. Insgesamt passte es irgendwie zur kompletten Veranstaltung, die überraschenderweise richtig gut besucht war, was aber auch daran lag, dass meistens so wenig los ist bei uns, dass man auch das dankend annimmt. Konstantin war kurz in den Büschen verschwunden - Bier macht schon verdammt Druck - und Thommy war schon seit gut einer halben Stunde nicht mehr aufgetaucht. Er hatte wahrscheinlich eine klargemacht und sich mit ihr verzogen. Also stand ich alleine am Bierwagen und kam nicht umhin, dem Mann mit der Gitarre kurz zuzuhören. Er hatte gerade eine besonders traurige Nummer beendet und die Menge schien echt berührt. Seine Gitarre hing ein bisschen schief um seinen Hals, er verkrampfte sich fast ins Mikrofon und schloss die Augen, während er redete. Es wirkte irgendwie skurril, aber die nicht gerade anspruchsvolle Menge ließ es auf sich wirken und war dankbar für ein bisschen Diskussionsstoff. „Ich würde gerne eines meiner Vorbilder zitieren, weil es einfach irgendwie zudem passt, was ich hier gerade erlebe.“ Er räusperte sich und auch ich war irgendwie von einer gewissen Spannung ergriffen. „Wir sind hier heute alle hier zusammengekommen, um diesen Moment miteinander zu verbringen. Und nach diesem Lied gehen wir alle getrennte Wege, aber diesen einen Moment, den teilen wir zusammen.“ So oder so ähnlich war es. Ich hatte es irgendwie vergessen, weil danach eine Rockband kam und die Leitung zum Bierstand ziemlich gut verlegt war. Außerdem hatte Rock-Joanne vor der Bühne mit ihrem designierten Verlobten abgetanzt, als gäb’s kein Morgen mehr, was das Hauptthema in der nächsten Schulwoche war. Deshalb hatte ich es wahrscheinlich vergessen. Aber es fiel mir in diesem Moment ein, indem ich im Auto saß und die Rücklichter aller Modelle an mir vorbeiziehen sah. Damals hatte ich mir nicht wirklich Gedanken über die Worte gemacht, aber das Vorbild, das er zitiert hatte, hatte verdammt Recht. Es war genauso gewesen, wie an diesem Tag in der Arena. Liz und ich, die ganzen sechzigtausend, die Trainer, die Leute an den Pommesbuden, die Betreuer, einfach alle, die da waren, hatten sich für neunzig Minuten versammelt aus den unterschiedlichsten Gründen auch immer. Und für diese neunzig Minuten waren wir füreinander bestimmt, bis wir nach dem Schlusspfiff wieder unsere Wege gingen, „aber diesen Moment, den teilen wir zusammen“. Manchmal tut es echt gut, nach einem Wochenende mit so viel Eindrücken und verwirrenden Gefühlen in den Alltagstrott zurückzukehren und es kann auch manchmal eine Befreiung sein, sich einfach nur in seinen normalen Rhythmus fallen zu lassen. Und nach einem gewissen Abstand kehrt man dann wieder in seine Erinnerung, zum Beispiel wenn man volltrunken im Bett liegt, zurück und lässt sich wieder für ein paar Minuten von der damaligen Zeit verzaubern. Nur kurz. Ich habe schon länger nicht mehr an dieses Wochenende gedacht, aber es hatte dieses Spezielle, obwohl ich seitdem kein Wort mehr mit ihr geredet habe oder sie jemals wieder sah. Aber sie war mitunter der Grund dafür, dass ich mich in München verliebt hatte. Die Begegnung mit ihr hat das Ganze irgendwie noch besonderer gemacht. Und irgendwann - das ist nichts was ich so behaupte, das ist etwas, was ich mir so fest vornehme, dass ich es fast zu hundert Prozent sicher weiß - irgendwann wird diese Stadt mein Alltagsrhythmus sein, in den ich mich zurückfallen lassen werde. Irgendwann wird mich mein Alltag verzaubern.
.....