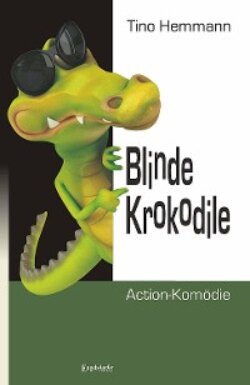Читать книгу Blinde Krokodile - Tino Hemmann - Страница 5
Hosenbisla und Feuerbackerl
ОглавлениеDas Leben ist wahrhaftig kein Zuckerschlecken. Das Leben eines beleibten und unter Umständen tatsächlich erkrankten Mannes schon gar nicht.
So geschah es zu Beginn der wenig goldenen 70er Jahre, dass in einer kleinstädtischen bayerischen Klinik ein Kind das trübe Licht des Kreißsaals von Kleinfingerroda erblicken musste, dem von Beginn an nicht Gutes vergönnt sein sollte. Um das Mitleid des Lesers noch ein wenig zu strapazieren, sei hier eine Anekdote erzählt, die bereits geschah, da unser Protagonist erst deutlich weniger als vierundzwanzig Stunden auf der Welt weilte, genau genommen acht Stunden und zweiundzwanzig Minuten.
Durch das Milchglas einer Zwischentür, von der schon so manche Farbschicht abgeblättert war, sah man nur einen schwachen Lichtschein. Ein Baby brüllte wie am Spieß, gerade so, als hasste es all die bestens situierten und angeblich ingezüchteten Nachkommen der Kleinfingerrodaer Bürgerschaft, die schlafend in den Nachbarbetten aufbewahrt wurden.
In der Geburtenstation erhob sich schwerfällig eine blutjunge, unbedarfte, päpstlich anmutende Kinderkrankenschwester. Wütend warf sie ein mittelmäßiges Romanheft auf das Tischchen vor sich und war als aufgebäumter Schatten hinter dem Milchglas der Tür zu erkennen. Der näherte sich wie ein feuerspeiender Drache dem Bettchen des brüllenden Knaben.
»Oa Bua! Willst du wohl endlich ruhig sein, Hosenbisla?«, schimpfte die Krankenschwester. »Du weckst mir noch die ganze Station auf! – Hier, nimm deinen Schnuller!« Rabiat steckte sie dem pausbackigen Winzling einen pinkfarbenen Schnuller zwischen die rosablauen Lippen. »Und jetzt halt bittschön gefälligst die Klappe!«
Das Baby war nur für sehr kurze Zeit still. Dann war ein »Blubb« zu hören und es schrie erneut.
Geschwind erklang eine bekannte Stimme, die das Schreien des Kindes zu übertönen versuchte: »Mein Gott! Oa Bua! Du machst mi wahnsinnig! Nun sei endlich ruhig, Karl!« Ein deutliches Klatschen war zu hören, woraufhin tatsächlich Ruhe einkehrte.
»Na bitte. Geht doch«, stellte die Schwester mit einer gewissen inneren Genugtuung fest und fragte sich abschließend: »Wie kann man sein Kind nur Valentin nennen, wenn der Nachname Karl ist?«
Kurz darauf widmete sie sich mit größter Aufmerksamkeit ihrem höchst lapidaren Romanheftchen.
Nun ja. »Karl Valentin!«, riefen alle sich selbst zur erzieherischen Vormundschaft erhobenen Erwachsenen den mühsam heranwachsenden Jüngling. Ständig geforderte Nahrungsaufnahmeriten sorgten dafür, dass er zunächst zwar in die Breite, doch weniger in die Länge wuchs. »Karl Valentin!« Und immer antwortete der Kleine, böse und entwürdigende Blicke erhaschend: »Ich heiße aber nicht Karl Valentin. Mein Name ist Valentin Karl.«
Der noch kleine Valentin wurde bereits im beschaulichen Alter von vier Jahren zum Abtrainieren der frühkindlichen Speckrolle in das glorreiche Nachwuchs-Fußballteam vom Grün-Blau Kleinfingerrodaer 1864 e. V. zwangsinvolviert. Dort stieg er mangels Willen zunächst nur zum Ballholer für die anderen Knirpse auf. Anfangs stolperte er häufig über die allzu langen Schnürsenkel der knochenharten Fußballtreter oder ihm rutschte die bis zu den Knöcheln reichende Turnhose unter den Bauch, so dass er auf den Saum trat und schwere Stürze erleiden musste, was amüsierte Väter der anderen Kicker zu blöden Kommentaren veranlasste.
»Feuerbackerl! Hams di vom FC di noh immer ni gfund?« Oder: »Feuerbackerl! Bua, Schweinswiaschtl, hots di? Hosnbisla! Des Fuassboispui dauert noh a ganze hoibe Stund!«
Valentin hörte an diesen Bemerkungen vorbei. Stattdessen lernte er nur für sich allein das Dribbeln und das Schießen mit dem äußerst schweren und harten Fußball. Das Spiel selbst hätte ihm wahrscheinlich richtig gut gefallen, wenn da nicht ständig die extrem langen Wege gewesen wären, die er gehen musste, um den Ball zu erhaschen. Und weil beim Rennen seine Wangen stets rot zu leuchten begannen, rief man den kleinen Valentin stets »Hosenbisla – Feuerbackerl!«.
War Not am Wart, wurde Valentin sogar ins Tor verbannt und von den Gegnern abgeschossen. Als er jedoch eines regnerischen Vormittags einen Abstoßball einem nicht rechtzeitig entkommenen siebenjährigen Mitspieler der eigenen Mannschaft heftig in die Genitalien schoss und dessen winzige Murmeln so sehr im Unterleib des Abgeschossenen versenkte, dass der Bua zunächst sprach- und atemlos umfiel und schließlich ins Sanatorium geschafft werden musste, durfte Valentin bis hinauf zur D-Jugend in den Sturm der Mannschaft. Hosenbisla – Feuerbackerl schoss ganz nebenbei unzählige Tore für den Grün-Blau Kleinfingerrodaer 1864 e. V.; wälzte er samt Ball heran, dann flüchteten die gegnerischen Horden lieber rasch. Doch verehrt wurde er deshalb nicht zwingend.
Valentin reifte zu einem jungen Burschen. Allmählich wurde er auch etwas formschöner, streckte sich hier und da ein bisschen, sein bester Freund erreichte stattliche Ausmaße und die Scham begann zu sprießen. Doch achtete Valentin stets darauf, dass sein Gesamtkörper auf keinen Fall zu schmal, zu dürr oder gar zu schön werden könnte.
Der kleine Valentin wurde trotz aller Problemzonen ein Jugendlicher und kam völlig unvorbereitet und unaufgeklärt in die Pubertät, weil seine Vormünder ohnehin glaubten, in Valentins Leben würde das Thema »Fortpflanzung« bedeutungslos bleiben. Sie fassten diesen Glauben in oft geäußerte Worte, die Valentin zunächst nicht endgültig begriff, die ihn jedoch bedrückten, denn seine Sports- und Schulkameraden bekräftigten die Meinung der Erwachsenen tagtäglich. In jener Gegend fanden aus religiösen Gründen Worte wie »pimpern«, »vögeln« oder gar »bumsen« keine Verwendung. Einzig das Wort »schnackseln« war begrenzt gesellschaftsfähig. Ja so sans, die Kleinfingerrodaer.
»Feuerbackerl, lass dös Schnackseln, des geht fei ned, du seist ehn Homo, Hosnbisla.«
Dem war jedoch nicht mal annähernd so. Im Recyclingpapiermüll fand der inzwischen zwölfjährige und mit einer wahrhaftig auffälligen Akne gesegnete Valentin Karl den verklebten und stinkenden Katalog eines berühmten Sex-Versandwarenhauses, auf dessen bunt illustrierten Seiten die interessantesten erotischen Schnackselsachen von mehr oder minder unangezogenen Damen und Herren feilgeboten wurden. Freilich besaß Valentin kein kreditfähiges Kundenkonto in diesem hocherotischen Versandwarenhaus, doch auf die Ware kam es ihm auch nicht an. Lediglich eine Dame hatte es dem Jungen angetan, die fortan die Protagonistin in seinen Wachträumen spielte. Heimlich und in größter Abgeschiedenheit, nicht minder enthusiastisch, studierte der Junge diesen Katalog und erfuhr infolge des Studiums seine erste reaktionäre Zwei-Stunden-Erektion. Den Abbildungen Glauben schenkend bildete sich Valentin übrigens lange Zeit ein, Babys würden ausschließlich durch ungeschützten Oralverkehr entstehen.
Erst zwei Jahre später, im Verlauf seines vierzehnten Lebensjahres, wies ihn ein blondes Mädchen darauf hin, dass dies der blanke Blödsinn sei und die schlüpfrigen Spermien im Mund einer Frau keineswegs zum Voranschreiten der Weltüberbevölkerung beitrugen.
Genau diesem Mädchen hatte Valentin den ersten und einzigen Schnackselverkehr seiner frühen Gründerjahre zu verdanken – wenn man die obskure Situation überhaupt als solchen bezeichnen konnte.
Es geschah nämlich während einer Zwei-Tage-Ausfahrt der Katholischen Landjugend Kleinfingerrodas (KLK) gemeinsam mit Jugendlichen aus anderen oberbayerischen Bergdörfern in den wunderschönen, vom Baumsterben bedrohten Bayerischen Schwarzwald. Am Abend des ersten Tages saßen alle Landreisenden erschöpft am Lagerfeuer und sangen lustige Kirchenlieder. Valentin war bei diesem Ausflug mit vierzehn einer der jüngsten teilnehmenden Katholiken. Dann kam der Moment, da sich die erwachsenen Begleitpersonen in ihre Zelte zurückzogen, um still und leise gegen das päpstliche Kondomverbot zu protestieren. Währenddessen verteilten zwei der verbliebenen Jugendlichen Weihwasser, das angeblich die Seele säubern würde, ohne dass die begleitenden erwachsenen Kirchdiener davon etwas mitbekamen.
Von diesem Weihwasser nahm Valentin etwas zu viel zu sich. Das tat er keineswegs, um seine Seele besonders gut zu reinigen. Nein, er wollte pubertäre Stärke beweisen, setzte die Flasche an die Lippen und trank und trank und trank, bis ihm der Flaschenbesitzer die Buddel wegriss und schimpfte: »Dummbaddl, hots di?«
Valentin kriegte schon gar nichts mehr mit und es kam zu einem Filmriss besonderer Güte!
Am frühen kühlen Morgen erwachte er in wohliger Wärme umhüllt von einem Mumienschlafsack, der zwei Mumien Platz bieten musste, denn eine völlig unbekannte Mumie lag unmittelbar auf ihm und Valentin fühlte, dass ER fast in ihr steckte, wobei das vielleicht fünfzehn- oder sechzehnjährige Mädchen noch fest schlief, ihre Wange an die seine drückte und Valentin ihren angenehm säuerlichen Mundgeruchshauch auf der Wange zu spüren bekam. Valentin genoss den Augenblick, auch wenn sich die Brüstchen des Mädchens nicht einmal annähernd mit denen der blonden Frau aus dem Katalog messen konnten. Er streichelte zögernd und sanft ihren straffen Po, dann ihren gesamten glatten Körper, ging auf einen Erkundungszug im Neuland der Gefühle und küsste immerzu einen winzigen Leberfleck, der sich hinter ihrem süßen linken Ohr versteckte. Sanft bäumte er sich zwischen den fremden Beinen auf, bis Valentin schließlich mit einem grinsenden, erleichternden und wohltuenden Jauchzer zum Orgasmus kam, kurz aufstöhnte, wodurch das Mädchen erwachte und wenig vorwurfsvoll flüsterte: »Du altes, kleines Ferkel«, um dann dreißig Minuten an seiner Zunge zu saugen und anschließend in seine Lippen zu beißen.
Beide flüsterten ein Weilchen miteinander, als das erledigt war, und im Verlaufe des Gespräches wurde Valentin mehr oder weniger aufgeklärt.
Zu Valentins Leid blieb nur die bloße Erinnerung an wonnige Minuten. Niemals sollte er den Namen des zuckersüßen blonden Engels erfahren, der am Ende des Ausflugs für alle Zeit aus seinem Leben schied.
Jedoch zurück zum Versandhauskatalog: Der beschäftigte den Jungen etliche Monate und der Junge sich selbst, bis alle körpereigenen Reaktionen geklärt, alle Schneizdiachen gefüllt und alle austretenden Flüssigkeiten bekannt waren.
Valentins erste andauernde Liebesbeziehung war die mit der blonden Frau auf den Seiten 322 bis 334, die sich auf zwölf Abbildungen mit allerlei Liebesspielzeug verlustierte. Deren Nippel – auf dem gewaltigsten Busen der Welt thronend, den sich Valentin in seinen feuchten Träumen kaum vorzustellen wagte – waren stets von den Einkaufspreisen der Dildos und Lustkugeln überdeckt. Dabei hätte Valentin gerade diese beiden Nippel so gern einmal gesehen. Schließlich hatte ihm die leibliche Mutter das Saugen an deren Busen sehr zeitig verboten, schon als sein erstes winziges Zähnchen ein lustiges Muster in die Mutterbrust getackert hatte. Dieser Versandhauskatalog jedenfalls, der dem Jüngling Valentin mehr an Herz und Nieren gewachsen war, als es die Bibel jemals tun würde, wurde ihm an einem entsetzlichen Samstagmorgen brutal und überraschend genommen, da Valentins Mutter in einem äußerst hysterischen Anfall das Zimmer des Sohnemanns entrümpelte und den klebrigen Katalog in ihre gummihandschuhgeschützten Hände bekam.
Sie legte die Miene einer völlig verzweifelten Frau und Mutter auf und gab mit letzter Kraft von sich: »Mei, Valentin! Hots di? Buab, elender Hosnbisla! Des geht fei ned! Host mi?«
Einer mittelalterlichen katholischen Manie folgend, musste sich der arme, fast dreizehnjährige Valentin nackt unter der kalten, heimischen Dusche einem Reinigungsritual hingeben, währenddessen ihm die Mutter mit einer kratzenden, mit Persil getränkten Pferdebürste Haut und Pickel vom Leib zu schaben versuchte und dabei inbrünstig betend fluchte – in diesem Fall ins Hochdeutsche übersetzt, da sonst absolut unverständlich: »Ich lass dir das ganze Ding beschneiden! Gotteslästerer! Schau nur, wie groß der schon wieder gewachsen ist! Der liebe Herrgott wird dich strafen für deine unzüchtige Sauerei! Host mi?«
Der verzweifelte Junge hielt schützend die Hände vor dem Schambereich und heulte wütend: »Den Papa hast du auch nie mit Persil geschrubbt, wenn er sich heimlich Pornos aus der Videothek geholt hat!«
»Nu mei! Hau ma bloß ob mit deim Schmarrn! Hat er nischt!«
»Hat er ja doch! – Und dem Fräulein vom Sparmarkt wollte er auf unsrem Küchentisch ein Kind machen!«
»Nu mei! Hau ma bloß ob mit deim Schmarrn! Hat er nischt!«
»Hat er ja doch! In den Mund hat Papa ihr geschnackselt! Nicht mal gemerkt hat er, dass ich mir die Milch aus dem Gefrierschrank geholt habe! Und immerzu hat Papa Zeitschriften mit unerzogenen unangezogenen Frauen in seiner Aktentasche!«
»Nu mei! Hau ma bloß ob mit deim Schmarrn! Hat er nischt!«
»Hat er ja doch! Ich hab’s gesehen, wenn ich mir Kleingeld borgen musste!«
Alles Jammern half nicht. Valentin war in dieser Familie der einzige Verbrecher vor Gott! Die ohnehin stets geröteten, nun jedoch leuchtend roten Hoden erinnerten ihn noch Tage später schmerzlich an die durchstandene Pferdebürsten-Tortur.
Dem alten Herrn Jugendpfarrer musste die Mutter selbstverständlich über die ungeistlichen Selbstbefriedigungen Valentins Bericht erstatten, ebenso über ihre göttliche Gegenaktion, mit dem egoistischen Ziel, sich eines Tages einen Platz in der ersten Reihe im Himmel zu ergattern. Nachdem der Herr Jugendpfarrer die Reinigungstaten der Mutter unter der heimischen Dusche für göttlich gut gedünkt hatte, ließ er sich vom verschämten Valentin all die Einzelheiten erklären, die der Junge mit dem Pornoversandkatalog veranstaltet hatte. Valentin wurde den Eindruck nicht los, dass er außerhalb des Beichtstuhles keinesfalls alles preisgeben musste und verschwieg somit fünfundneunzig Prozent seiner ungöttlichen Handlungen. Jedoch reichten dem Herrn Jugendpfarrer die harmlosen fünf Prozent für den belehrenden und niederschmetternden Ausspruch: »Trieb, mein Junge, ist Sünde.« Und er fuhr Valentin sehr, sehr sanft über den Schopf. »Doch wozu bedarf es unserer Kirche, gäbe es nicht die kleinen lämmlichen Sünder?« Der Jugendpfarrer wurde wieder ernst. »Doch übertreiben darfst du es nicht. Sonst wird ER dir abfallen. Hörst du? Du weißt ja, unsere katholische Kirche ist keine Religion, sie ist eine Weltmacht. Und mit einer solchen sollte man sich nicht anlegen. Schon gar nicht unter der Dusche oder der vermaledeiten Bettdecke. Die Strafe Gottes ist wahrhaftig weniger barmherzig als sein gesamter Ruf.«
Valentin kratzte sich auf dem Weg von der Pfarrei nach Hause nachdenklich den Kopf, die Worte des Pfarrers sortierend, und erklärte der Mutter noch am gleichen Abend: »Der Herr Jugendpfarrer hat gesagt, ich darf das tun. Er würde sonst arbeitslos werden.«
»Nu mei!«, schimpfte die Mutter uneinsichtig. »Hau ma bloß ob mit deim Schmarrn! Hat er nischt!«
»Hat er ja doch!«
Das ganze Hormon-Hoch-und-Runter während der pubertären Stress-Epoche in Valentins Leben sorgte schließlich dafür, dass er fast zwei Jahre lang unter starken Schwindelgefühlen litt. Das soll nicht heißen, dass er unverhältnismäßig häufig lügen musste, nein, er fiel aus heiterem Himmel um, und meistens direkt auf die Fresse.
Eine Diagnose als solches gab es nicht, jeder Arzt vertrat eine andere Version des Krankheitsbildes, so dass Valentin nach einer gewissen Zeit niemandem gegenüber mehr erwähnte, dass er aufgrund eines Schwindelanfalls gestürzt sei. Die Erziehungsberechtigten schoben die Stürze ohnehin auf sein angeborenes Ungeschick. Valentin hingegen glaubte eher einem sehr jungen Kinderarzt, der zu Beginn des Auftretens der Krankheit auf einem Schulsportattestzettel notiert hatte: »Valentin Karl leidet unter einer somatosensorischen Amplifikation.« Die Klassenlehrerin hatte Valentin nach dem Lesen des Zettels gefragt, ob diese Krankheit wohl ansteckend sei. Und Valentin hatte ihr geantwortet: »Oh ja, extrem ansteckend, hat der Doktor gemeint!«, worauf er dem Schulunterricht mehrere Tage lang hatte fernbleiben dürfen.
Trotzdem befürchtete der Junge angesichts der entsetzlichen Worte »somatosensorische Amplifikation«, dass er wahrscheinlich nicht mehr lang zu leben hatte und bereits in sehr jungen Jahren das Zeitliche segnen würde, zumal ihm bekanntlich der liebe Gott nicht wohl gesonnen war, wie der Herr Jugendpfarrer meinte. Aus der Bibliothek besorgte sich Valentin vorsorglich einige wissenschaftliche Werke und wusste daher bald, dass seine Schwindelanfälle mit großer Wahrscheinlichkeit körpereigene Reaktionen im Chaos der pubertätsbiochemischen, psychischen und familiären Mächte waren. Er konnte daran auch nicht sterben, wenn er nicht gerade ohnmächtig umfallen und von einem Auto überrollt werden würde.
Mit fünfzehneinhalb Jahren hatte Valentin fast vergessen, dass er noch kurze Zeit zuvor unter diesen Schwindelgefühlen gelitten hatte, denn von einem Tag auf den anderen ließen sie nach, wurden seltener und traten schließlich gar nicht mehr auf. Offiziell wenigstens. Inoffiziell wusste Valentin das Erscheinungsbild der Krankheit noch zu nutzen. Hatte er keine Lust auf einen Zweitausend-Meter-Lauf im Sportunterricht, dann fiel er eben einfach um und täuschte die somatosensorische Amplifikation unglaublich perfekt vor.
Valentin nahm wieder ein klein wenig zu. Er wurde keineswegs fett, höchstens kräftig – stellte er für sich selbst fest, wenn er seinen Körper halb nackt oder ganz nackt vor dem gewaltigen Schwebetürenschrankspiegel im elterlichen Schlafzimmer musterte. Zudem wurde halbwegs ein Mann aus dem Jungen, denn überall wucherten ihm Haare. Wirklich überall. Gleichsam änderte Valentin einige seiner Interessen. Fußball schaute er sich nunmehr im Fernsehen an, der Kirche kehrte er den Rücken – er betrachtete sich als Oppositioneller der Weltmacht – und vor dem Onanieren verriegelte er sorgfältig die Zimmertür von innen. Alle anderen Dinge änderten sich jedoch nicht.
So ging Valentins Kindheit viel zu rasch zu Ende. Überraschend rasch, denn er wäre wahnsinnig gern Kind geblieben. Andererseits blieb er tatsächlich allzeit ein Kind, denn sein kindliches Gemüt, das verlor Valentin nie.
Nach der Schulzeit erlernte Valentin einen Handwerksberuf, denn das hatten ihm die Erziehungsberechtigten geraten. Valentin war keineswegs dumm und seine schulischen Leistungen hätten ihm auch einen höheren Bildungsweg beschieden, doch war ihm ein solcher nicht vergönnt.
»Du musst endlich eigenes Geld verdienen!«, hieß es. »Wie lange willst du uns denn noch zur Last fallen?«
»Ich war nicht dabei, als ihr mich geschnackselt habt!«, brüllte Valentin aufgebracht. »Hätt sich Mama nicht ausgestreckt, hätt Papa ihn nicht reingesteckt!« Er schaute auf. »Jedenfalls, wenn ich mit der Lehre fertig bin, verlass ich euch. Aber bittet mich nicht, bittet mich niemals, zurückzukommen!«
So fand der korpulente junge Mann nach der Lehre einen Job in einem Möbelhaus, für das er unschöne Billigmöbel in wildfremden Wohnungen für ebenso wildfremde Menschen aufbauen musste. Obwohl Valentin stets im Schussfeld der allerwertesten Kundschaft stand, die nach dem Aufbau erkennen musste, was für einen Schund sie billig erstanden hatte, verbrachte er glatte zehn Jahre als Billiglöhner in diesem Unternehmen.
Während dieser Zeit suchte Valentin hin und wieder nach einem passenden Mädchen, doch irgendwie wollte es ihm nicht gelingen, ein solches zu finden – oder die Brüste waren ihm einfach zu klein. Er selbst kam kaum aus Kleinfingerroda heraus, einer minimalen, höchst katholischen Kleinstadt in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt. Und im Städtchen selbst herrschte eine regelrechte Inzuchtdynastie, die jedes wohlhabende Mädchen an einen möglichst nahen wohlhabenden Verwandten verschacherte, was die katholischen Seelsorger stets vertraulich abnickten, solange ihre Schäfchen bloß keine Kondome benutzten und ES angeblich niemals vor der Hochzeit taten.
Schließlich schaute sich Valentin nach einer eigenen kleinen Absteige um und fand für sich selbst eine Einzimmerwohnung.
Mama verglich sein Fortgehen mit dem Beginn des Dritten Weltkrieges und heulte so bestialisch lange, dass es den Anschein machte, Valentin wäre an der Atomfront gefallen. Das widersprach heftig ihren vorherigen Sprüchen in Sachen »zur Last fallen«. Papa hingegen machte drei Kreuze und richtete sich sein sogenanntes Arbeitszimmer bereits ein, als Valentin noch seine sieben Sachen verpackte.
»Wenigstens ändert sich die Bestimmung des Zimmers nicht«, hatte der Sohn dem Vater gegenüber geäußert.
»Wie soll i dös verstehen?«, hatte der Vater daraufhin gefragt.
»Es ist und bleibt ein Wichszimmer, Papa.«
Die neue kleine Wohnung, die hell und freundlich war und zu Valentin passte, besaß einen unterhaltsamen Vorteil. Vom einzigen Fenster aus war es dem jungen Mieter vergönnt, auf den Friseurladen von Paule Breitmeyer hinabzuschauen. Und so beobachtete Valentin tagtäglich die jungen Damen beim Hineingehen und malte sich bildhaft aus, mit welchem Erscheinungsbild sie Stunden später den Friseurladen wieder verlassen würden.