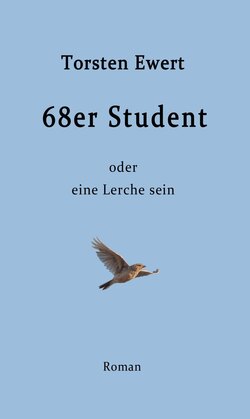Читать книгу 68er Student - Torsten Ewert - Страница 9
ОглавлениеTeil I
Aufbruch
An einem kalten, aber noch sonnigen Herbsttag im Oktober 1968 hielt Peter Quero die Zusage in den Händen, in die Wissenswelt der Universität aufgenommen worden zu sein. Doch es war nicht an der Zeit, sich dem Studium ausschließlich und mit Freuden zu widmen, denn entschlossene Studenten planten den akademischen Elfenbeinturm zu schleifen. Ein revolutionärer Sturmwind sollte nicht nur vom verstaubten akademischen Ballast befreien, sondern auch die Kraft entfalten, von hier aus beginnend die bestehende bürgerliche Zweiklassengesellschaft zu beseitigen, um eine bessere, kommunistische Welt zu erschaffen, in der alle Menschen gleich waren.
Sieben Jahre später verstummten die hitzigen Parolen. Die Revolution zur Beseitigung des bürgerlichen Staates hatte nicht stattgefunden. Der Arbeiter konnte dafür nicht gewonnen werden, und ohne ihn ging es nicht. Dennoch war es den Studenten gelungen, mit ihrer Kritik, ihren visionären Gedanken und entschlossenem Handeln einen Prozess anzustoßen, der lautete: Alle Macht dem Volke.
Jugend
In seiner Jugend an der wind- und regenumtosten Nordseeküste boten der Überseehafen in Bremerhaven und die Wiesen der Unterweser Peter einsame Zufluchtsorte und Abenteuerspielplätze, inmitten roher Eisen- und Betonstrukturen und in endloser Natur. An der Kaimauer des äußeren Hafens, in der Wesermündung gelegen, zerbrachen die ankommenden Wellen aus der Nordsee mit hoch aufspritzender Gischt. Es war eine gleichmäßige Abfolge, wie das pulsierende Blut, das kraftvoll vom Herzen getrieben gegen Peters Schläfen schlug.
Senkrecht stürzte die graue Betonmauer des Columbuskaje ins abgrundtiefe Wasser hinab. Ein Anlegeplatz mit stählernen Pollern, an denen die größten Passagierschiffe der Welt anlanden konnten, allen voran die stolzen englischen Luxusliner. Das Blaue Band wurde dem Schiff zugesprochen, das den Atlantik am schnellsten, zuletzt in ganz knapp 4 Tagen, überquerte. Der Besuch dieser Schiffe hatte Volksfestcharakter mit staunendem Publikum über die hochherrschaftlichen Gäste.
Aber heute nichts davon, und verlassen in zeitloser Einsamkeit lehnten die leeren Gangways an der langgestreckten Abfertigungshalle, wo Peter sein Fahrrad abgestellt hatte. Er balancierte entlang der Abrisskante zum Meer, verspürte dessen verschlingende Gier und trotzte dieser mit waghalsiger Geschicklichkeit. Im Rhythmus der Gezeiten angehoben und fallengelassen floss die Weser der Nordsee entgegen, ging im Atlantik auf, wo das Wasser verdunstete, um als Regen die Küste wieder heimzusuchen. Kreischend schossen die graugesprenkelten Möwen futtersuchend über das brackige Wasser.
Peter sprang aufs Fahrrad, fuhr zwischen den Gleisen der eisernen Entladekräne entlang, deren Ausleger wie Zeiger ins Unendliche eines blassblauen Himmels wiesen, unaufhörlich von einem melodisch-pfeifenden Wind umtönt.
Er bog in den inneren Hafen ab. Keilförmig stemmte sich hier die Schleuse dem angreifenden Außenwasser entgegen, gab dem Hafen ruhige Sicherheit. Sein Ziel war ein kleines Stück Acker in der Aue vor der drehbaren Eisenbahnbrücke, die bei Bedarf den Schiffen den weiteren Weg freigab. Furche um Furche hatte er hier den modrigen Boden umgestoßen, das grasig verwilderte Oberste zuunterst gewendet, dann die Kartoffelknollen der Reihe nach in die krümelige, braunschwarze, glänzende Scholle gesteckt, aus der jetzt das Kraut spross. Mit den bloßen Händen wühlte er in der Erde, fand eine Frucht, die noch unreif grün war, warf sie ins Hafenwasser, reinigte die Hände an der Hose und fuhr weiter in den Hafen hinein. Dessen Lagerhallen glichen heute erstarrten Reptilien, die jedoch kraftvoll erwachen konnten, um die Ladung der ankommenden Schiffe zu verschlingen. Dann waren die jetzt gleichgültigen Zöllner hellwach, jagten Kaffee- und Zigarettenschmugglern hinterher, suchten nach unverzolltem Gut, beschlagnahmten, verhängten Geldstrafen. Unbehelligt fuhr Peter an ihnen vorbei, hinaus aus dem Hafen, hinauf auf den Deich und hinab zur Weser.
Der schmale Basaltdamm zum gesprengten, sich selbst überlassenen und allmählich verfallenden Weserfort, einst Wächter in der Flussmündung, war bei Ebbe mit leichtfüßiger Geschicklichkeit begehbar. In der Einsamkeit des Wattenmeeres provozierte das Schild Betreten verboten, Lebensgefahr zum Gegenteil heraus und wurde ignoriert. Nicht zum ersten Mal kletterte Peter abenteuerlustig über die Trümmer des zerborstenen Betonklotzes, kroch durch die noch offenen, dunklen und kalten Gänge. Vielleicht fand er ein Relikt aus vergangener Zeit? Ein übersehenes Moniereisen zerriss seine Hose, stach ins Knie. Blut tropfte in den Dreck und direkt auf ein kleines kreisrundes Metallteilchen, das sein Interesse weckte. Er stillte das Blut mit dem Taschentuch, nutze es, den blutbesudelten Fund zu polieren, bis ein goldfarbenes Deckelchen zum Vorschein kam. Die erkennbare Gravur zeigte zwei aneinander grenzende verschnörkelte A inmitten eines Lorbeerkranzes. Der Schmerz war vergessen. Erstmals, zu seiner riesigen Freude, hatte er einen Schatz gefunden, den er in der Hosentasche barg. Die Wunde am Knie war die Opfergabe.
Rechtzeitig, mit sicheren Sprüngen, erfolgte der Rückzug über den mit Algen überzogenen Buhnendamm, bevor die einsetzende Flut ihn unter Wasser setzte und die Rückkehr vereitelte.
In den Weserwiesen stiegen die Lerchen mit schnellen Flügelschlägen tirilierend aus dem hohen Gras steil empor, hinein in den blauen Himmel, um hier minutenlang mit wechselndem Gesang zu kreisen, bevor sie sich im Sturzflug mit hochgestellten Flügeln wieder der Erde näherten und verstummten. Peter fühlte sich diesen kleinen erdfarbenen Geschöpfen verbunden, die im melodischem Sing- und eindrucksvollem Schauflug ihr Zuhause bekundeten.
Der Heimweg zurück führte ihn in die Wirklichkeit. Verschmutzt, verletzt und mit zerrissener Hose brach die verzweifelte Wut der Mutter über ihn herein mitsamt der Strafe eines Dunkelarrests im stinkigen Hühnerstall. Seine unbeaufsichtigten, ausschweifenden Streifzüge überforderten sie. Er wusste dies, tat es dennoch. Tapfer lebte sie in einfachen Verhältnissen, dem Nachkriegsalltags nicht immer gewachsen. Der Krieg hatte sie der verwöhnenden Geborgenheit und Sorglosigkeit auf einem Landsitz Ostpreußens entrissen. Geblieben war ihr Bedürfnis, sich die einstige Würde zu erhalten, ihre Schönheit durch elegante Kleidung zu unterstreichen und den Tag, wenn möglich, mit Freundinnen zu verbringen und zu verschwatzen. Peter liebte sie, entzog sich aber ihrer Hoheit.
Für den Vater, Flugzeugingenieur und einst stolzer Pilot, gab es nach dem Krieg keine angemessene Arbeit. Von Abenteuerlust getrieben fand er diese in Bagdad und schraubte dort Baufahrzeuge zusammen, deren Räder spielend einen Mann überragten. Bilder von dort zeigten einen groß gewachsenen, schlanken Mann mit scharf geschnittenen Gesichtszügen, mal im Straßenkreuzer, mal bei der Antilopenjagd in der Wüste. Doch da ihm die Familie fehlte, brach er die Zelte im Orient ab und beendete die Trennung. Für Peter folgte eine spürbare Einschränkung seiner bisherigen Herumtreiberei, die der Vater nicht billigte. Mehr jedoch machte ihm dessen bald darauf folgender beruflicher Ortswechsel zu schaffen, weg aus dem herben und gradlinigen Norden mit Verlust des Vertrauten und Gewohnten, hinein ins ungewohnte Leutselige einer bergisch-rheinischen Kleinstadt. Hier waren Beziehungen alles. Man kannte einander, suchte die gesellige Bestätigung und fühlte sich gegenseitig verpflichtet.
Nichts von alledem war Peter zu eigen, weder in die Gesellschaft noch in die Schule vermochte er sich zu intrigieren. Er schloss mit der Mittleren Reife ab, wollte wie der Vater Ingenieur werden und zunächst eine technische Lehre machen. Doch auch hier fand er keinen Halt. Die Welt an der Werkbank, nach industriellen Normen von nüchternen Technokraten entworfen, vollbracht unter den wachsamen Augen von Vorarbeitern, ausgeführt in lärmender Fabrikhalle und kontrolliert von der Stechuhr führte mehr denn je ins Leere, die auch Zigaretten, Bier, Urlaub oder Fußball nicht auszufüllen vermochten.
Sein Versuch, mit einem Motorrad gelegentlich dem Alltag zu entfliehen, scheiterte zuletzt nach einem Unfall mit Totalschaden der Maschine. Glücklicherweise blieb er unverletzt.
In dieser ausweglosen Lage gab es nur eine Chance, sich wie einst Münchhausen mit aller Kraft am eigenen Schopfe zu packen und aus der Misere zu ziehen. Er brach entschlossen die Zelte im verhassten kleinbürgerlichen Milieu ab und bestieg zum ersten Mal in seinem Leben ein Flugzeug, das ihn in die Weltstadt Berlin brachte. Hier waren eine einfache Bleibe und eine Fabrikarbeit schnell gefunden. Das Ziel war jedoch das Peter-A.-Silbermann-Abendgymnasium. Hier sprach er beim Rektor vor, gab Vorwissen an und schrieb an Ort und Stelle einen Aufsatz. Schon ein paar Tage später wurde ihm die Zusage gemacht, seine schulische Laufbahn genau an dem Punkt fortsetzen zu dürfen, wo sie seinerzeit aufgehört hatte. Er war der glücklichste Mensch auf der Welt und noch einmal genauso glücklich, als ihm im Mai 1968 nach bestandenem Abitur das Zeugnis der Reife übergeben wurde.
Er sah sich wie die Lerche aus der Niederung aufsteigen, um zum Höhenflug anzusetzen.
Der Internationale Vietnamkongress
Berlin war Peters neue Heimat geworden. Hier unternahm er ausgedehnte Spaziergänge im Zentrum Westberlins. Vom Bahnhof Zoo, dem städtischen Zoo unmittelbar anliegend, durchwanderte er den Großen Tiergarten und wurde mit deutscher Geschichte konfrontiert. Mitten im Park, auf der breiten Straße des 17. Juni, in Erinnerung an den Volksaufstand in der DDR 1953 und dessen Zerschlagung durch die sowjetische Armee mit diesem Datum bedacht, stand die Siegessäule mit der prächtigen, vergoldeten Victoria, die Preußens Sieg und Gloria verkündete. Die Berliner nannten sie schnodderig nur die Goldelse.
Einen kleinen Fußmarsch weiter auf das Brandenburger Tor zu, zur Linken, lag das sowjetische Ehrenmal, eine zur Straße hin nach innen gewölbte Pfeilerreihe mit einem zentralen größeren Pfeiler als Sockel für die 8 Meter hohe Bronzestatue eines Rotarmisten mit geschultertem Gewehr, vor dem tagtäglich eine sowjetische Eskorte paradierte. Nicht das Heroische, sondern das Grauen des Krieges wurde hier gemahnt und der gefallenen sowjetischen Soldaten im Kampf gegen Nazideutschland und dessen Vernichtung gedacht.
Die daraufhin erfolgende politische Teilung Deutschlands in West und Ost wurde unübersehbar direkt vor dem Brandenburger Tor anschaulich. Eine halbmondförmige umschließende, rechts und links weiter verlaufende, übermannshohe Mauer um des Brandenburger Tor versperrte den weiteren Weg. Eine Plattform ermöglichte es, in den Osten hineinzuschauen, auf einen Todesstreifen und Wachtürme. Direkt hinter dem Tor in Ostberlin lag die berühmte Allee Unter den Linden, das einstige lebhafte Zentrum Berlins, jetzt weltverlassen. Genauso fast menschenleer war das Gebiet um den verwaisten Reichstag an der Spree, zur Linken auf der Westberliner Seite.
Zurück ging Peters Weg entweder durch den Park oder südlich davon vorbei an nur noch von einstiger diplomatischer Vergangenheit zeugenden, verlassenen, einst prunkvollen Botschaftsgebäuden. Die nördliche Route führte zur neuerbauten Kongresshalle hin, von den Berlinern als Schwangere Auster verhöhnt. Es folgten Schloss Bellevue und im Anschluss daran das moderne, architektonische Vielfalt aufweisende Hansaviertel mit seinen extravaganten Hochhäusern. Am Ende seiner Tour gelangte Peter an die Technische Universität, verweilte dort in den einladenden Buchläden mit der riesigen fächerübergreifenden Auswahl, bevor er nach kurzem Fußmarsch wieder den Bahnhof Zoo und den quirlig belebten Kurfürstendamm erreichte.
Hier war eine zunehmende unruhige politische Atmosphäre unverkennbar. Flugblätter wurden verteilt, kleine Gruppen fügten sich spontan zusammen, diskutierten, häufig lauthals und erregt.
„Was wollt ihr Studenten? Wofür demonstriert ihr? Wollt ihr die Gesellschaft verändern, um sozialistische Verhältnisse wie in der DDR zu schaffen? Wollt ihr die Demokratie untergraben?”
„Nein, wir wollen die Bevormundung und die selbstherrliche, verkrustete Autorität von Politik, Presse und gesellschaftlichen Institutionen beenden, Selbstbestimmung erlangen, frei von Zwängen sein. Alle Menschen sind gleich. Dafür kämpfen wir.”
So stießen die Meinungen aufeinander. Auch Peter brachte sich ein, noch zögerlich, fühlte sich den rebellierenden Studenten verbunden, wollte Stellung beziehen.
Der Internationale Vietnam-Kongress Westberlin wurde vom 17. bis 18. Februar 1968 an der TH von sozialistischen und kommunistischen Organisationen sowie Gleichgesinnten ausgerufen.
Der 18. war Peters Geburtstag und schien ihm geeignet, diesen inmitten von Genossen und Revolutionären zu verbringen.
Der Veranstaltungsort, das Audimax der Technischen Universität am Ernst-Reuter-Platz, war brechend voll; nur auf den Treppenstufen hatte Peter noch Platz gefunden. Auf dem Podest versammelt: die führenden Köpfe des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, SDS, und verwandte revolutionäre Agitatoren.
Das Thema hieß Der Kampf des vietnamesischen Volkes und die Globalstrategie des Imperialismus.
In drei Foren postierten sich die Redner, hielten schonungslose Analysen und Referate über Bedeutung und Notwendigkeit der vietnamesischen Revolution und die Revolution in der Dritten Welt, riefen auf zum antiimperialistischen und antikapitalistischen Kampf.
Eine weltweite Solidarität wurde gefordert. Der siegreiche Kampf des vietnamesischen Volkes gegen den US-Amerikanischen-Imperialismus nährte die Hoffnung auf eine erneute Sozialistische Internationale, um den globalen Imperialismus zu zerschlagen.
„Errichtet die Revolution im eigenen Land” (Ho Chi Minh), schafft „zwei, drei, viele Vietnams” (Che Guevara), das waren die Maximalforderungen. Eine radikale Jugend- und Studentenbewegung träumte davon, war bereit, in den Straßen der Metropolen ihre Meinung auszutragen, trachtete, das Proletariat für die Revolution zu gewinnen, und zwar möglichst rasch.
„Genossen. Wir haben nicht mehr viel Zeit”, entschlossen rief es Rudi Dutschke der Versammlung zu, „lasst uns den neuen Menschen in einer neuen Gesellschaft erschaffen.”
In seinem folgenden Referat legte er Die geschichtlichen Bedingungen für den internationalen Emanzipationskampf dar. Einem Maschinengewehr gleich feuerte er, ohne Luft zu holen, die Endsilben missachtend, seine Ausführungen ins atemlos schweigende Publikum, schilderte das historisch-ökonomisch Versagen des Spätkapitalismus, beschwor die antifaschistische und antiautoritäre Einheitsfront, verlangte die direkte Herrschaft der Produzenten über die Produktionsmittel, wünschte die Globalisierung der revolutionären Kräfte, schloss mit den Sätzen:
„Die Revolutionierung der Revolutionäre ist die entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen. Es lebe die Weltrevolution und die daraus entstehende freie Gesellschaft freier Individuen.”
Lang anhaltender, tumultartiger Beifall brauste auf, eine schwarze Haarsträhne fiel ihm in die bleiche Stirn, ein entschlossenes, fanatisches Gesicht, allmählich erleichtert und zufrieden.
Weitere sozialkritische Referate folgten.
Ernest Mandel forderte nichts Geringeres als „antikapitalistisches Bewusstsein und den antikapitalistischen Kampf …, um die Unfreiheit des Arbeiters und Angestellten an dem Arbeitsplatz selbst, seiner grundlegenden Entfremdung und Verdinglichung im Arbeitsprozess zu beenden … Es lebe die internationale Solidarität … es lebe die sozialistische Weltrevolution.” Die hochgereckte Faust unterstützte seine markigen Weckrufe.
Zwei junge Amerikaner verbrannten ihre Einberufungskarten zum Militärdienst. Wieder brauste begeisterter Applaus auf. Weitere Solidaritätserklärungen aus allen Herren Länder wurden verlesen.
Einzelne, zumeist kurzgehaltene Gegenstimmen verhallten bedeutungslos, wurden mit Gegenstimmen unterbrochen, trotz Dutschkes Ermahnung, auch abweichende Meinungen zu ertragen. Insbesondere ein unscheinbarer kleiner Mann, Typ tadelnder Grundschullehrer, abgetragene Kleidung, fiel auf, der sich ans Katheder stellte, vor ihm die Schulklasse, die es zu maßregeln galt. Im Gegensatz zu seinem Erscheinen, ertönte eine kraftvolle Stimme, die das allgemeine Geraune übertönte.
„Diese Veranstaltung ist nichts als leeres Geschwätz feiger Politagitatoren. Wenn ihr Mut habt, kommt mit mir nach Vietnam. Dort tobt der Kampf, an dem ihr teilhaben könnt. Hier geht ihr kein Risiko ein.”
„Wir kämpfen mit Argumenten, bislang, richtige Hilfe für die vietnamesische Revolution wäre nur die im eigenen Land. So weit sind wir noch nicht. In Vietnam wärest du höchstens ein Hindernis für den Vietcong, die müssten mindestens drei Leute für dich abstellen, damit du dich nicht im Dschungel verläufst. Es lebe der SDS. Hau ab!”
Gelächter erschallte.
Die Schlusserklärung wurde verlesen: „Die in Westberlin versammelten Vertreter der sozialistischen Jugend Westeuropas, der amerikanischen Widerstandsbewegung und der revolutionären Jugend der drei Kontinente werden ihren gemeinsamen antiimperialistischen Kampf konkretisieren und zum aktiven Widerstand entfalten. Folgende Aktionen sind zu planen: Materielle Unterstützung des vietnamesische Befreiungskampfes, Wehrkraftzersetzung der US-Armee, Kampagnen gegen die Nato, Einrichtung einer Dokumentationszentrale, Aufklärung der Bevölkerung.
Und wieder wurde dem Publikum die Hoffnung zugerufen: „Es siege die vietnamesische Revolution. Es siege die sozialistische Weltrevolution!”
Eine letzte Aufforderung erklang: „Kommt morgen alle zur genehmigten Demonstration, Sich-Sammeln in Höhe des Olivaer Platz, die Route geht über den Kurfürstendamm zur Deutschen Oper, den Ort des Polizeiexzesses vom 2. Juni, wo Benno Ohnesorg erschossen wurde. Dort wollen wir keine physische Konfrontation, keine Wasserspiele. Denkt daran, zur Revolution gehört auch Geduld und Disziplin. Das Ende der Demonstration ist eine klare politische Aussage gegen den Senat, der momentan allenfalls gewaltlos gestürzt werden kann.“
Peter staunte, hielt Letzteres für eine unsinnige, weil hoffnungslose Vorstellung.
Die Podiumsteilnehmer verließen ihre Plätze, der Saal leerte sich. Ein Teilnehmer drückte Peter eine Mao-Fibel in die Hand, sein erstes Geburtstagsgeschenk.
„Genosse Mao Zedong ist der größte Marxist-Leninist unserer Zeit”, las er und, „Jeder Kommunist muss die Wahrheit begreifen, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen … Eine Revolution ist kein Gastmahl … ein Kraftakt, durch den eine Klasse eine andere Klasse stürzt.”
Hier hatte Peter heute erlebt, wie mit heftigen Worten gekämpft, auch Waffengewalt beschworen wurde, denn noch keine der bisherigen und gegenwärtigen kommunistischen Revolutionen hatte darauf verzichten können, um zu siegen oder siegen zu wollen. Das hieß in letzter Konsequenz, den Tod in Kauf zu nehmen, auch den eignen.
Am 11. April 1968 schoss Josef Bachmann, ein Gelegenheitsarbeiter aus Peine, am Kurfürstendamm vor dem SDS-Haus dreimal auf Rudi Dutschke, zweimal in den Kopf und einmal in die Brust. Am 24.12.79 ertrank dieser nach einem epileptischen Anfall, als Folge seiner Kopfverletzung, tragischerweise in einer Badewanne.
Nach dem Attentat folgten unmittelbar schwere Ausschreitungen, nicht nur in Berlin, auch in Westdeutschland. Der studentische Kampf eskalierte.
Eine der vielen studentischen Demonstrationen, vorbei am umzäunten Amerikahaus, bewegte sich zur Abschlusserklärung auf den Ernst-Reuter-Platz zu. Wie gewohnt miteinander untergehakt skandierten die ersten Reihen: „USA, SA, SS, Ho-,Ho-,Ho-Chi-Minh”, animierten den Rest, der einstimmte. Rote Fahnen wurden geschwenkt, revolutionäre Parolen auf mitgeführten Transparenten verkündet. Die Technische Universität war zum Schutz vor Beschädigung mit Stacheldraht umzäunt worden. Doch militante Demonstranten rissen eine Lücke hinein und strömten auf das Gelände. Peter mittendrin. Die nachrückende Polizei wurde mit Steinen beworfen, diese setzte Rauchgas ein.
„Schmeiß die kochend heißen Bomben zurück, aber nur mit dem Wollhandschuh”, belehrte ihn ein verwegener Mitstreiter, „Wolle schützt und brennt schlecht.” Wie gesagt nahm dieser die nächste anrollende rauchende Blechbüchse mit bewehrter Hand auf und schleuderte sie zurück.
Doch dem alles entschlossenen Polizeisturm hatten die Eindringlinge letztendlich nichts entgegenzusetzen. Was nützte das Versteck in der Toilette, wenn beißender Qualm jeden zurück ins Freie zwang, geradewegs in die Arme einsatzbereiter Polizisten. Gegenseitige Flüche, Schreie wurden laut, der Gummiknüppel tanzte. Ein am Kopf Getroffener umklammerte diesen mit beiden Händen, krümmte sich vor Schmerzen.
Selber schuld, der trockene Kommentar des Polizisten.
In Reih und Glied wurden alle Aufgegriffenen an der Wand aufgestellt, dann in die Grüne Minna verladen. Eine lange Fahrt in einen Außenbezirk Berlins fand statt, wahrscheinlich Spandau. In einem ehemaligen Kasernengebäude mit Kerkerzellen erfolgten erkennungsdienstliche Maßnahmen der Mitgenommenen: Daumenabdruck, Foto, von vorne, von der Seite, dann die kommentarlose Einsperrung in eine der Zelle. Fragen wurden nicht beantwortet.
Die Nacht brach herein, und weit nach Mitternacht stellte sich für Peter eine unverhoffte Wende ein, der Wachmann forderte ihn auf: „Geh nach Hause.” Orientierungslos stolperte er durch die dunkle Nacht. Dennoch, die frische Luft war Labsal. Endlich erschien ein Wohngebiet, wo nach langem Warten ein erstes öffentliches Verkehrsmittel aufkreuzte, um ihn mitzunehmen.
Eintritt in die Universität
Zögerlich durchstreifte Peter den großflächigen Campus der Freien Universität Berlin in Dahlem, auch er frei, jeglicher Fremdvereinnahmung abhold.
Philosophie, Mathematik, Medizin, Jura, diese archaischen Fächer, jahrhundertelange Herausforderungen, kamen ihm in den Sinn. Wem oder was sollte er folgen, Lust oder Laune, Münzwurf oder Vergabestelle für Numerus-Clausus-Fächer?
Dann, von allen Überlegungen entbunden und womit er am allerwenigsten gerechnet hatte, kaum geglaubt und im Zweckpessimismus von sich gewiesen, war der Brief mit der Zulassung zum Medizinstudium gekommen, neben der Mathematik einer der Favoriten. Seinen aufkommenden Stolz erstickte er in beherrschter Gelassenheit. Es gab niemanden, dem er sich begeistert hätte mitteilen können, außer den Eltern.
Das braune Pappheftchen – Studienbuch der FU Berlin mit fünfstelliger Matrikelnummer und verschnörkeltem Namensschriftzug – beeindruckte ihn trotz nüchterner Schlichtheit, da es das Privileg vermittelte, Student zu sein.
Auf der ersten Innenseite befand sich das eingelochte Passbild eines jungen Mannes: glattes Gesicht, offener Blick, volles, aus der Stirn gekämmtes, gescheiteltes Haar, Jackett, weißes Hemd, gepunktete Krawatte. Darunter ein amtlicher Stempel und seine eigenhändige, zügig davoneilende Unterschrift, von einem zurückschießenden Strich wieder eingefangen. Auf der nächsten Seite folgten Angaben über die Staatsangehörigkeit: Deutsch, die Fakultät: Medizinische, Tag der Aufnahme: 19.11.68, im Wintersemester 1968/69.
Im Belegblatt trug er eigenhändig die Vorlesungen und Praktika seiner Premierenfächer Physik, Chemie, Zoologie, Histologie und Anatomie ein.
Der große, breitschultrige Bursche neben Peter gab sich mit unverkennbarem Gleichmut der Betrachtung einer Traube aufgeregter Studenten hin, welche an diesem Samstagvormittag die Eingangstür des betongrauen Instituts für Anorganische Chemie belagerten. Ein spöttisches Lächeln umspielte seine Lippen.
„Erstsemester, pass auf, die Büffelherde stürmt gleich den Saal, ein sinnloser Eifer, keiner kommt zu kurz, primitiver Herdentrieb.”
In der Tat, kaum war die Tür geöffnet, ergoss sich rücksichtslos drängelnd die Menge in die Weite eines nüchternen Raumes mit langgezogenen Arbeitstischen, um einander erstaunt, verloren anzusehen.
Die konkrete Aufforderung des Lehrbeauftragten, sich paarweise zu formieren, schuf gesittete Normalität. Peter, von seinem zufälligen Nebenmann beeindruckt, verhielt sich wie dieser lässig abwartend, und nachdem all die anderen zueinander gefunden hatten, ergaben sie als letzte eine neue Zufallsgemeinschaft.
„Siehst du, die ganze Aufregung umsonst.”
Der von den Medizinern nicht gerade beeindruckte Chemiker gab Anleitung und Einweisung, erwartete selbstständige chemische Analysen und vergab Testate für gelungene, häufig genug abgekupferte Ergebnisse. Die allgemeine Anspannung verflog und der Vormittag verstrich. Nächsten Samstag ging es weiter, dazwischen eingebettet erfolgten die theoretische Vorlesungen des Faches.
Seinen Studienbeginn hatte sich Peter ehrwürdiger vorgestellt.
„Siegfried”, stellte sich der neue Kommilitone vor, dessen blaugraue Augen ihn intensiv musterten, „hast du Lust mit mir in die WiSo-Cafeteria zu gehen? Das ist die letzte Chance, Samstagmittag Kaffee und belegte Brötchen zu bekommen.”
Peters Zustimmung war ihm gewiss, auch dessen Neugier. Was bedeutete WiSo? Ganz sicher, hier war jemand, der sich auskannte im Unibetrieb, vertraut auch mit dem Schlendrian. Woher sonst nahm er seine Überlegenheit, die Peter so unbedeutend dastehen ließ?
Institut für Wirtschaft und Soziales stand auf dem Eingangsschild. Ein geschwätziges Stimmengewirr empfing sie, das reichhaltige Buffet und der Kaffeeduft trösteten über die bisherige Nüchternheit hinweg.
Ein paar Semester Jura hatte Siegfried seinem Bekunden nach in den Wind gesetzt.
„Stinklangweilig, endlose Fälle, die sich wie Kaugummi ziehen. Die Medizin ist schneller, effizienter, mit deutlich mehr Fällen.”
Eine durchaus glaubwürdige und einleuchtende Aussage, vorgetragen voller Selbstsicherheit.
„Am Mittwoch sehen wir uns im Seminar Experimentelle Physik für Mediziner wieder. Schulkram, Newtonsche Mechanik, Gas- und Strömungslehre, Optik. Steht auch alles in den Skripten, die Seminare sind Pflicht. Die Vorlesungen kannst du schwänzen.”
Eine glatte Verleumdung des universitären Lehrplans, zwar noch kein Erdbeben für Peter, aber eine Erschütterung. Dieser Siegfried bewies Überlegenheit durch sachkundige Kritik, oder spielte er sich nur auf? Tatsächlich, auch Letzteres lag in seiner Natur. Er reckte sich, strich mit einer Handbewegung über das glatte, in die Stirn fallende Haar, Spott und Lächeln verflogen, stattdessen zeigte sein Gesicht nun ergreifende Ernsthaftigkeit mit geschürzten Lippen.
„Ich wollte Schauspieler werden, habe Monologe gelernt und vorgesprochen, aber mir saßen nur desinteressierte, herzlose Ignoranten gegenüber, die mit sich selber beschäftigt waren. Wie eine Wand.”
Bitternis klang an, verflog rasch, die momentane Zufriedenheit setzte sich durch und prahlerische Überheblichkeit.
„Daraufhin habe ich dieser verbohrten Engstirnigkeit Paroli geboten und bin Seemann geworden. Ich habe die Ozeane befahren. Hab nie bei einer Liniengesellschaft angeheuert, sondern bin auf freien Schiffen mit stets neuen Routen und Häfen unterwegs gewesen. Der Käpt’n verhandelte die Ladung oder bekam eine neue Order. Da lernst du Land und Leute kennen, was sage ich, die richtige einheimische Welt. Am interessantesten waren die kleinen verborgenen Häfen, landestypisch, ursprünglich, in einem Fjord, im Dschungel oder Niemandsland verborgen. Dort gab es keinen Suff, keine Nutten, keine Schlägereien. Stattdessen sparte ich die Heuer für den Neuanfang in Berlin und besuchte eine Privatschule. Dann bestand ich das externe Abitur und studiere jetzt.”
Peter staunte, ein asketischer Globetrotter voller Dynamik und jetzt stolzer Akademiker, wie er. Ein wie es schien durch und durch anständiger Mensch, der es ausließ, die Sau rauszulassen, in den Tavernen rumzutoben, Weiber und Rum zu genießen, sich einem Seelenverkäufer auszuliefern, das krachende vulgäre Leben mitzunehmen. Stattdessen hatte er sittsam gefestigt bei der christlichen Seefahrt angeheuert und eine Karriere für die Zukunft geplant, während Peter im spontanen Entschluss gehandelt hatte. Zwar war er am Wasser der Nordsee aufgewachsen, hatte aber nie die Leidenschaft aufgebracht, sich der endlosen Weite der Ozeane hinzugeben, sondern im überschaubaren Terrain die Widerstandsfähigkeit einer Landratte erworben, welche dem heimischem Hafen den Vorzug gab.
Die in die Ferne schweifenden Augen seines Gegenübers nahmen noch intensiver die ihm eigene und auch vom Meer vereinnahmte graublaue Farbe an, seine Ohren gleichzeitig die hell leuchtende Morgenröte der aufgehenden Sonne, und eine erkennbare Ergriffenheit ließ ihn verstummen.
„Das nächste Mal mehr … meine Freundin wartet,” fast fluchtartig stob er davon.”
Peter war verblüfft, fragte sich, was er mehr bewundern sollte, wie Siegfried sich aus der Allgemeinheit heraushob, oder wie er die Kontrolle über sich behielt.
Streifzüge durch Westberlin
Samstagnachmittag, Beginn des Wochenendes, der Campus begann sich zu entvölkern. Wie jeder Maurer auch verließen die Studenten ihren Arbeitsplatz, kehrten der Wissenschaft den Rücken, wollten genießen. Peter nahm die U-Bahn zum Bahnhof Zoo. Filmpaläste lockten auf riesigen Plakaten mit markanten Köpfen. Western waren die momentanen Renner. John Wayne, Charles Bronson, Henry Fonda, Clint Eastwood, Klaus Kinski, Claudia Cardinale handelten und schossen. Wie seine Helden, lässig mit wiegendem Schritt, schlenderte Peter den Kudamm entlang, vorbei am Café Kranzler und Hotel Kempinski. Ein distinguiertes Publikum, bürgerlich bieder, gab sich hier Kaffee und Kuchen hin, konnte getrost ignoriert werden. Im BMW-Ausstellungsraum präsentierten sich sportliche Karossen und bullige Motorräder. Die Preise begrenzten ein weiteres Interesse. Im etwas weiter gegenüberliegenden Maison de France wurden kulturelle Veranstaltungen, Sprachkurse und der neueste Film von Asterix und Obelix angeboten. Diese barbarischen Helden kämpften gegen den römischen Imperialismus. Die Studenten heute nahmen den globalen aufs Korn. Damals verhalf ein Zaubertrank zur Stärke, die Westernhelden behalfen sich mit dem Colt, heute musste eine Ideologie dafür sorgen. Im Zoo-Palast lief Spiel mir das Lied vom Tod. Peter musste ihn sehen, die herzzerreißende Mundharmonikamelodie kroch in sein Ohr.
„Wer bist du?”
„Der Unbekannte.”
Ein Duell mit Todesserenade folgte. Der Gewalttätige wurde vernichtet.
Die noch blendende Abendsonne nach dem Dunkel des Kinos irritierte Peters Augen kurzfristig, ebenso der Duft aus Achingers Erbseneintopfpalast seine Nase. Hier wurden auch Verlierer gesättigt, wenn diese bei einem Glas Bier die kostenlos angebotenen Brötchen essen durften.
Peter schlenderte die Kantstraße entlang. Linkerhand entdeckte er einen Laden von Beate Uhse, der Gründerin des ersten Sexshop der Welt. Ein Blick in die Auslagen genügte; es fehlte ein Liebesobjekt zum Ausprobieren der angebotenen Utensilien. Am Savignyplatz lagen einige größere Lokale. Peter suchte jedoch nach einer Alltagskneipe, die Stammgäste umsorgte, bog in die Schlüterstraße ab und entdeckte auf der linken Seite das Wirtshaus Wuppke. Zwei große Fenster jeweils neben der Eingangstür gestatteten einen Einblick. Hinter dem linken Fenster war eine gut besetzte Theke zu sehen, rechts ein bebilderter Raum, dessen dunkle Holzvertäfelung und das Holzmobiliar einen urigen Eindruck vermittelten.
Eine Kultkneipe fand Peter, trat ohne zu zögern ein, kletterte auf den nächstbesten Barhocker und schaute sich um. Ein gemischtes, im Wesentlichen mit sich beschäftigtes, Publikum war anwesend. Ein kleiner zerknitterter Mann, der neben ihm thronte, nahm ihn in Augenschein. Mit Paul stellte er sich sofort vor, und auf Geselligkeit bedacht orderte er ungefragt zwei Bier und schlug Peter unverblümt vor, mit ihm zum Stutti, der Rotlichtidylle am Stuttgarter Platz, zu gehen. Im 77 Sunset Strip gäbe es die schönsten Mädchen. Hinter seinen verstaubten Brillengläsern funkelten zwei kleine Irrlichter.
„Komm mit, ich zahle. Habe heute meinen Wochenlohn bekommen, der kann draufgehen. Ich brauche ansonsten kein Geld, bin festangestellter Heizer in einer Dahlemer Villa, wohne im Keller und habe Kost und Logis frei.”
Peter war an eine Kellerassel geraten, die sich herausgewagt hatte, nach weiblicher Zuwendung gierte, nach heller Haut und fülligem Fleisch. Aber so wie er aussah, war die Hoffnung, geküsst zu werden, unwahrscheinlich und damit auch die Hoffnung dahin, dass aus ihm ein Prinz werden könne. Aber das schien ihm egal, sein Geld als Opfergabe gab ihm die Zuversicht auf weibliche Zuwendung.
„Sachte Kumpel, bleib auf dem Teppich. Putz deine Brille, geh zu einer Frisörin, unterhalte dich dort, wenn du herausgeputzt wirst. Vielleicht interessiert sich eine für dich. So wie du jetzt daherkommst, ist eine Kohlenzange zu schade, um dich damit anzufassen.”
Doch Paul, unbelehrbar, war entschlossen.
„Heute will ich den Anblick der Bardamen genießen. Um diese frühe Zeit widmen sie sich mir noch fast ausschließlich, ich weiß das. Du lässt dir etwas entgehen, und gleichzeitig können wir Freundschaft schließen.”
Peter wehrte ab. „Alles schön und gut, aber mir ist nicht daran gelegen zu sehen, wie du dein Geld verschleuderst. Aber sieh dich nur an üppigen Brüsten und strammen Schenkeln satt, ohne sie betatschen zu dürfen, träume den Rest der Woche davon, damit du im Heizungskeller überleben kannst, der dir die Kraft geraubt hat, an Alltagstagen deinen Mann zu stehen. Ein erster, besserer Versuch wäre es, mit der adretten Thekenbedienung hier zu plaudern, die auch sehr adrett ist und fast jeden Tag ansprechbar.”
Peters Bemühungen Paul zu dessen Vorteil zu bewegen, verliefen im Sande. Dieser glitt nach einem weiteren Bier vom Hocker, machte eine wegwerfende Handbewegung und folgte seiner triebhaften Begehrlichkeit. Wie die Sternschnuppe auch würde sein Geld verglühen und mit ihr sein Wunsch, geliebt zu werden. Was ihm blieb, war die Einsamkeit seines Kellerverschlages, bis der neue Wochenlohn ihn wieder ins Freie spuckte.
Zwei neu eingetretene junge Frauen hinter und neben Peter blickten sich unsicher um, reckten die Hälse, erkundigten sich bei ihm: „Gibt es hier etwas zu essen?”
Er wusste es nicht, erkundigte sich, eine Schiefertafel wurde ihm gereicht, das Angebot vermerkte Bouletten, Bockwurst und mit Käse überbackene Zwiebelsuppe, letztere als Spezialität des Hauses angepriesen. Diese Empfehlung kam an, auch Peter bestellte, durfte sich zu ihnen setzen.
Claudia und Rosi hießen die beiden. Gemeinsam löffelten sie ihre heißen Suppen, kamen ins Gespräch miteinander. Rosi mit unbändigem Kraushaar, offenem, energiegeladenem Gesicht, lachte, gestikulierte viel und sprudelte aus sich heraus. Sie studierte Geschichte, las marxistische Literatur und schwärmte von Rosa Luxemburg. Revolutionäres Rot überzog ihre Wangen, bildete den Kontrast zum makellosen Weiß der Zähne. Eifrig schüttelte sie ihre Haarpracht, nickte heftig beim Sprechen.
„Rosa wurde von soldatischen Reaktionären erschossen und in den Landwehrkanal geworfen. Ein trauriges Schicksal, und wir sollten ihrer gedenken, eine Hommage für die Herausragende vollbringen, eine Blume am Ort ihrer Vernichtung opfern.” Peter gab sich pathetisch.
Rosi schwieg augenblicklich beim Gedanken an das gruselige Ende ihres Idols. Eine unvorhergesehene Schweigeminute folgte. Dann rief Rosi hingerissen und begeistert dazu auf, an den Ort aufzubrechen, und zwar sofort.
„Du weißt wo?”
Doch Claudia, ein fransiger Kurzhaarschopf mit ernster Miene, funkte dazwischen: „Nichts da, heute keine obskuren Abenteuer mit Erinnerung an Grausamkeit und Mord, du hast mir den Abend versprochen.”
Schluss war es mit Peters Absicht, in unseliger Umgebung Held und Beschützer zu werden. Claudia drängte zum Aufbruch.
„Überlegt es euch, vielleicht ein andermal.”
Wehmütig warf Rosi Peter einen letzten Blick zu, der ganz im Widerspruch zu der abwertenden Handgeste von Claudia stand.
Peter nahm die U-Bahn nach Tempelhof. In der heimischen Eckkneipe lehnten zwei angetrunkene Männer am Tresen, echte Proletarier wie aus dem Bilderbuch, für die zu kämpfen sich lohnte. Der eine groß mit dickem Bauch, derbem rotem Gesicht, breiter Nase, lauter, dröhnender Stimme, der andere klein und kräftig, das Gesicht ein zerfurchter Acker. Sie nahmen Peter in Augenschein.
„Keine Frage, du bist ein Student, ein Randalinski.”
„Nein, Schlosser.”
„Dann sag mir, was ein M3 ist?”
„Ein Maschinengewehr.”
„Falsch, zweiter Versuch, du hast keine Ahnung.”
„Ein metrisches Gewinde, 3mm.”
Dem Dicken verschlug es die Sprache.
„Diesmal hat er recht, ich glaub ihm trotzdem nicht. Er sieht aus wie ein Student, aber egal, trinken wir. Eine Runde auf mich!”
Sie verbrüderten sich mit ein paar weiteren Bieren, bis Peter es erachtete, vom Tag ermattet, nach Hause zu gehen.
Eine Werkstatt als Zuhause
Peters Zuhause in Tempelhof, beziehungsweise seine Unterkunft, befand sich in einem hinfälligen Gebäudekomplex der Firma Rilke, die im Parterre des Vorderhauses ihre Büroräume hatte und gleich darüber im Dachgeschoss über mehrere Wohnkammern verfügte. Hier lebten außer ihm noch Lupo und Schweinebacke, die zur Kernmannschaft des Betriebes gehörten, ein Transportunternehmen mit Fuhrpark im Hinterhof und angeschlossener Autowerkstatt. Letztere war beim Anblick der altersverschlissenen Flotte zweifellos notwendig. Zusätzlich wurden in der Werkshalle alte Autos ausgeschlachtet, deren unbrauchbar gewordene Gerippe auf dem Hof herumlagen, und noch fahrtaugliche Wagen wieder auf Vordermann gebracht. Den Abschluss der Restaurierung bildete eine oberflächliche Lackierung, im betriebseigenen Jargon Händlerlackierung genannt, die dem alten Wagen neuen Glanz verlieh. Für den Verkauf dieser aufgepeppten Wagen war Geschäftsinhaber Rilke zuständig, ein kleiner, dicker und lebhafter Mann, überwiegend in abgetragene Alltagsklamotten gekleidet, stets jovial aufgelegt, mit vertrauensvollem, buschigem Oberlippenbart, listigen Äuglein und vereinnahmendem Lächeln. Immer mal wieder, wenn er im dunklen Anzug erschien, war jedem klar, dass dieser Rosstäuscher einen Gerichtstermin wahrnahm, um in ahnungsloser Unschuld zu bekunden, dass die beklagten Mängel des Autos keinesfalls ihm anzulasten seien, er habe als Händler den Wagen nur weiterverkauft.
Bronco, der Lacker war für die Lackierungen zuständig, ein uriger, muskulöser Geselle mit aufgezwirbeltem Oberlippenbart und wilder Löwenmähne, der Star der Belegschaft. Raubeinig und lauthals gab er auf dem Hof den Ton an. Im zwielichtigen Milieu Halbstarker, Rocker und leichter Mädchen, wo man auf seine körperliche Unversehrtheit achten musste, suchte er in seiner Freizeit das zumeist sexuelle Abenteuer.
Da ihm Peter als intelligenter Mensch geeignet erschien, sein Umfeld zu bereichern, lud er ihn zu einer Spritztour in seinem chromblitzenden, rosaroten Cadillac mit ausladenden Heckflossen und aufklappbarem Verdeck ein, sein berechtigter und unverkennbarer Stolz. Nach einigen Kneipenbesuchen mit dreister sexueller Anmache hielt Bronco Peter auch für geeignet, das Steuer zu übernehmen, da er bereits zu viel getrunken hatte. Peter war allerdings auch nicht mehr ganz nüchtern.
Das Malheur ereignete sich an einer Kreuzung. Mit falsch eingelegtem Rückwärtsgang und kräftigem Gasgeben schoss der Cadillac nach hinten in ein nachfolgendes Taxi, und ein erschrockener Bronco brüllte wutentbrannt: „Der Tölpel ist uns aufgefahren.”
Der Fahrgast im Taxi war zufällig ein Freund von Bronco. Sie fielen sich im Zeichen der Wiedererkennung um den Hals, und er bestätigte ohne zu zögern der Polizei Broncos Beschuldigung. Peter, alkoholbedingt nicht mehr ganz seiner Sprache mächtig, sagte zu seinem Schutze nichts, gab sich geschockt. Ein am Boden zerstörter Taxifahrer blieb zurück.
Ein paar Tage später kroch Peter während der Vernehmung auf dem Polizeirevier, um Richtigstellung des Unfalls bemüht, reumütig zu Kreuze. Aber genauso wie ihn die erlittene Scham gegenüber dem Polizisten kränkte, traf ihn Broncos Spott über seine dämliche Ehrlichkeit. Der musste nun auf eigene Kosten sein Fahrzeug wieder herrichten und verschwendete keine Gedanken mehr darauf verschwendete, ihn noch einmal einzuladen. Aber dies war ganz in Peters Sinne.
Die Hinfälligkeit eines Rilke-Autos hätte Peter einkalkulieren sollen, als er leichtsinnig für allerdings nur 100 DM einen noch nicht aufgemöbelten VW Käfer erwarb. Nach einigen selbst durchgeführten Reparaturen an den Achsschenkeln war der Wagen zwar fahrtüchtig, fiel aber einer Polizeistreife durch mangelnde Verkehrssicherheit bei der Signalgebung auf. Auch im Hinblick auf den etwas heruntergekommenen Eindruck des Wagens und trotz des Protestes „immer auf die Kleinen“ bestanden die Ordnungshüter auf einer unmittelbaren technischen Untersuchung. Deren Ergebnis führte zur Stilllegung des Wagens und Rückkehr auf Rilkes Betriebshof.
Rilke, daraufhin angesprochen, zuckte nur gleichgültig mit den Schultern, „so etwas kann passieren“.
Sich mit dem Gegebenen abzufinden, war auch die Denkweise von Lupo, Peters strohblonder Mitbewohner am Ende des Wohnflures, dessen gescheiteltes Haupthaar weit in die Stirn eines länglichen und knochigen Gesichts fiel und mit einer Handbewegung weggewischt werden konnte. Warum sich aufregen, Tatsachen hinterfragen, wenn sich doch nichts ändern ließ? Von seinem Rufnamen, wer auch immer ihn erdacht haben mochte, wusste er stolz zu erzählen, dass er sich vom lateinischen lupos ableitete und ihn berechtigte, sich als Leitwolf einer Mannschaft verwegener Möbelpacker anzusehen, die mit grüngelb lackierten Kleinlastern, versehen mit dem Schriftzug ihres Besitzers Rilke, im Transportgeschäft ihrer Arbeit nachging.
Leidenschaftlich gern kochte Lupo für alle und soff dabei bis der Rausch ihn niederzwang. Diesen schlief er anschließend in seinem Zimmer aus, das außer dem Gerichtsvollzieher, vor dem er den Fernseher versteckte – er besaß sonst nichts von Wert, kein – Fremder je betreten hatte. Stark, wie er war, galt seine Vorliebe Klaviertransporten, und selten wurde er in der Hoffnung betrogen, dass sich mit jedem erklommenem Stockwerk das Trinkgeld, von ihm genussvoll Schmalz genannt, jeweils erhöhte. Entsprechend glänzten seine triefblauen Augen.
Bei Umzügen wurde der fremde Fernseher von ihm solange in Verwahrung genommen, bis die Rechnung beglichen war.
Als einziger besaß er keinen Führerschein. Schweinebacke, der weitere Mitbewohner im Flur, war sein Fahrer. Sich seines Spitznamens zu erwehren, hatte dieser aufgegeben, auch im Hinblick darauf, dass er in gewisser Weise zutraf.
„Gut, dass du kommst, kannst heute Nacht mit mir auf Zeitungstour gehen. Ab drei Uhr zwei Stunden Zeitungspacken verteilen, Schweinebacke ist ausgefallen, Lohn wie üblich.”
„Dann leg ich mich noch ein Stündchen aufs Ohr. Weck mich.”
Wenig später erfolgte ein knochenhartes Anklopfen. „Los geht’s.” Das Stimmengewirr und Motorengebrumm vom Hof war unüberhörbar.
Drei Lkw fuhren Kolonne. Peter am Steuer des letzten wieder hellwach nach dem starken Kaffee, den Lupo gekocht hatte, der sich sichtlich vergnügt auf dem Beifahrersitz räkelte und fahrlehrerhaft nervte: „Rechts, links abbiegen, geradeaus, bremsen, Gas geben, grüner wird’s nicht. Pass auf. Halt Kontakt.”
Allmählich interessierte es Peter wohin die Fahrt ging.
„Kochstraße, Zeitungsviertel.”
„Springer? Kenne sonst keinen Verlag dort.” Und tatsächlich, in der Stadtbrache Kreuzbergs tauchte das höhnisch herausfordernde Hochhaus an der Berliner Mauer mit langgezogenem, hellerleuchtetem, hochmodernem Druckereigebäude auf.
„Fahr die Einfahrt runter und zwischen den hohen Zäunen hindurch”, kommandierte Lupo.
„Bist du eigentlich verrückt, mich hierher mitzunehmen? Springerverlag, in den Augen der Studenten das Böse schlechthin!”
„Stell dich nicht so an, tust mir einen Gefallen, Sippenhaftung.”
Eingeklemmt zwischen anderen LKW, im gleißenden Scheinwerferlicht, luden sie an der Rampe Stapel der gebündelten Sonntagszeitung auf. Knappe Zurufe erfolgten. Die Packen flogen auf die Pritsche. Lupo richtete ein Verteilsystem ein, schloss die Plane und sprang wieder auf den Beifahrersitz. Abfahrt, erneut zwischen hohen Zäunen hindurch auf die Straße. Die Scheinwerfer fraßen sich durch die Nacht. Im Zickzack ging’s durch die Stadt: Kreuzberg, hoch in den Wedding, Halt an Kiosken, Restaurants, Hotels, Einkaufshallen, und jeweils ein, zwei oder mehrere Bündel flogen vor die Eingangstüren. Mit der Geschicklichkeit eines Affen vollführte Lupo sein Werk.
„Fertig, geschafft, nach Hause.”
„Wenn wir den ganzen Kladderadatsch in die Spree geschmissen hätten, meine linken Freunde hätten gejubelt, und ich wäre in ihrer Achtung gestiegen.”
„Dafür gibt’s kein Geld, und du hättest Ärger bekommen.”
„Kein zweites Mal, das Geld kannst du behalten. Koch lieber ein paarmal für mich, muss mich im Spiegel wiedererkennen.”
„Rilke und wir müssen überleben, der Transport ist unser Geschäft. Du brauchst das Blatt ja nicht zu lesen, dafür tun’s Millionen, und die können gar nicht so unrecht haben. Nur ihr spielt euch auf.”
„Wir machen auf die Volksverdummung aufmerksam.”
„Seid froh, dass ihr was lernen und studieren könnt, derweil wir für euch arbeiten. Ich bin mit meinem Leben zufrieden.”
Peter gab auf, ließ den Wagen auf dem Hof ausrollen. Die anderen waren schon da, jeder mit einer Flasche Bier in der Hand. Zigarettenrauch umhüllte müde Augen.
„Schnapp dir den Nuckel, du Buckel, Schlummertrunk.”
„Die leere Flasche eignet sich gut zum Molotowcocktail.”
„Zu spät.”
Wie ein Stein schlief Peter bis weit in den Nachmittag hinein.
Als der Sonnenstrahl durch die schräge Dachluke wie ein weißsilbriger Balken voll Millionen kleinster Staubpartikel die leichte Düsternis erhellte und sein Gesicht traf, stand er auf. Ein Bad täte ihm gut, gab’s leider nicht, das Stadtbad war nur wochentags geöffnet, eine Waschschüssel der Notanker.
Unten in der Küche rumorte Lupo, scheuerte Töpfe. Gulasch hatte es gegeben, der Geruch war entsprechend.
„Die anderen sind ausgeflogen, Kaffee ist noch im Pott. Das Marmeladenbrot kannste selber schmieren. Prost.”
Er wedelte mit der halbleeren Bierflasche. Seiner Haltung nach nicht die erste.
Ausgemergelt sah er aus. Von dem viel zu langen Gürtel, den er stramm um die Hüfte geschnürt hatte, damit die zu große Hose nicht rutschte, hing das eine Ende verloren hinunter. Immer wieder griff er an den Hosenbund und zog ihn nach oben.
„Soldaten kennen ihre Pflicht, gehorchen, Tag und Nacht. Ich hau mich jetzt aufs Ohr”, ein stierer Blick, dann wankte er davon, um den Rest des Tages zu verschlafen, anschließend Fernsehen, bis er wieder einschlief.
Rosi und Rosa
Der Gedanke an ein Bier und die Hoffnung auf ein Gespräch waren für Peter Grund genug, das Wuppke anzusteuern. Tatsächlich, seine Überraschung war riesengroß, begrüßte ihn mit stürmischer Begeisterung Rosi und sprudelte los: „Claudia und ich leben zusammen. Dieses Wochenende ist sie zu ihren "Eltern nach Westdeutschland gefahren. Sie ist nicht so draufgängerisch wie ich, deshalb habe ich die Situation genutzt, etwas in geschichtlicher Anlehnung allein zu unternehmen, nicht ganz allein, sondern mit dir.”
Ein verschmitztes Lachen forderte ihn heraus, sie freute sich an seiner Verunsicherung.
„Du erinnerst dich, wir sprachen über Rosa Luxemburg.”
„Eine äußerst intelligente Revolutionärin mit dem Ausspruch Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.“
„Ja, und du zeigst mir den Ort ihres Todes. Ich liebe das abgründig Gruselige, bekomme dann eine Gänsehaut, dann erlebe ich die aufkommende hämmernde Angst, aber auch sofort den unbändigen Willen, mich mit aller Kraft zu behaupten und dem momentan Unabänderlichen zu begegnen. Dann wachse ich über mich selber hinaus, wie ich es früher in der Schule denen bewiesen habe, die mich einschüchtern wollten. Deswegen werde ich auch zu Demonstrationen gehen, engagiert mitmachen, dabei sein. Ich liebe die Revolution, so wie Rosa. Lediglich Claudia bremst mich und meint, dass ich spinne und mich allenfalls zu meinem Nachteil in Gefahr begebe. Aber ich werde es ihr beweisen, dass Mut zum Leben gehört. Verstehst du das?”
„Vollkommen, könnte von mir sein. Begeben wir uns zum nächtlichen Landwehrkanal, eine Mutprobe in einsamer Umgebung.”
„Ganz genau, du stimmst mit mir überein, lass uns aufbrechen, Hic Rhodos, hic salta.“
Ein entschlossener Aufbruch in die Abenddämmerung, eine glückliche Rosi am Arm, die Peter eine überraschende Gemeinsamkeit anvertraute. Sie, Rosi, war wie Rosa eine polnische Jüdin. Für Rosas Ideale wollte sie kämpfen, aber am Leben bleiben, deren Kampf fortsetzen, dies an ihrem Gedächtnisort schwören. Peter staunte über ihre Entschlossenheit. Vor dem hellerleuchteten Hilton blieben sie stehen, Nobelkarossen wurden von diensteifrigen Portiers umwieselt, Kofferberge auf Rollwagen gestapelt, deren elegante Besitzer mit ihren Damen durch das Eingangsportal schlenderten, während das Personal sich kümmerte.
„Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm1. Brecht kannte sich aus.”
„Der Klassenkampf wird dafür sorgen, dass es allen gut geht”, konterte Rosi.
Die Rückseite des Hilton war weniger imposant, lag ruhig zum Tiergarten hin, kein Straßenlärm mehr, träge floss das Wasser des Landwehrkanals, kaum wahrnehmbar. Vom Zoologischen Garten gab’s vereinzelte Laute schläfriger Tiere – oder nächtlicher Geister?
Kein Mensch weit und breit, außer zwei Neugierigen, die das Abenteuer suchten. In der Finsternis leitete sie das silbrige Wasserband, kaum waren ihre gedämpften Schritte zu vernehmen. Rosi drängte sich an Peter, vom Wasser weg. Irgendwo im totalen Dunkel einer Brücke umschlang sie ihn. Unter seinen Händen, die ihre Brüste umfassten, spürte er den hämmernden Herzschlag, er wollte sie küssen, sie beruhigen. Doch Rosi kam ihm zuvor. Mit einem Jubelschrei schwang sie sich kraftvoll an ihm hoch, umschlang seine Hüfte mit ihren Beinen, verschloss seinen Mund an ihrem Leib, und rief in die stockdunkle Nacht hinein, wieder und wieder: „Rosa, ich liebe dich.“
Peter, begeistert mitgerissen, begann sich wie ein Derwisch zu drehen, schneller und immer schneller, bis er taumelte und sie auf ihre Füße sprang und ihn hinderte, zu stürzen.
„Hier ist Rosi, hier tanze ich.”
Der Augenblick ihres großartigen Glücks.
Spät in der Nacht ein hingemurmeltes Geständnis: „Du bist ein toller Kerl, ich bin total berauscht, aber Claudia und ich sind ein Paar.”
Was blieb ihm übrig, als sich an ihrem Lob zu erfreuen und ein Abenteuer erlebt zu haben.
Ein Krankenpflegepraktikum
Unschwer und nicht ganz zufällig entdeckte Peter den stets gut über das Studium informierten Siegfried, einen unverbesserlichen Caféhausbesucher in seinem geliebten Stammcafé im sozialwissenschaftlichen Institut. Dessen Interesse war dem heutigen Streuselkuchen vorbehalten, und Peter hoffte auf ein paar allgemeine Hinweise des Tausendsassas zur weiteren universitären Ausbildung.
„Für das Studium ist während der Semesterferien ein Pflegepraktikum von vier Wochen im Krankenhaus erforderlich. Zum Nachweis, ob dir die Krankenhausluft, die Atmosphäre, ganz einfach das Ambiente gefällt und du außerdem die Arbeit der Pflegekräfte schätzen lernst. Jeder muss das einmal erlebt haben, der den Rest seines Arbeitslebens im Krankenhaus verbringen will. Ich hab mich im Westend-Klinikum beworben. Wie sieht es bei dir aus?”
„Null”, war die kleinlaute Antwort, „danke für die Auskunft, zweimal Schwarzwälder Kirsch auf mich. Hast du Lust auf Kino? Bud Spencer und Terence Hill verprügeln nach Herzenslust ihre Gegner in Gott vergibt, Django nie.“
Siegfried zeigte lediglich Interesse an seiner Torte. „Meine Freundin wartet, sie hat etwas gekocht, ich könnte dich einladen.”
Jetzt wiederum war Peter nicht enthusiastisch. Bloß keine Wohnzimmeridylle, auch schränkte der Konjunktiv ein. Er hatte von Siegfried eine ungefähre Beschreibung über dessen Untermieterbehausung bei einer Witwe, die gesittetes Benehmen, gepflegte Ruhe und gegenseitige Achtung erwartete. Ihm war heute mehr nach handfestem Haudrauf zumute, also Verabschiedung.
Der Film verursachte mindestens zwei bis drei Dutzend ärztliche Traumabehandlungen, je nach Schweregrad der zugefügten Verletzungen entweder ambulant oder stationär, aber das nur nebenbei. Die Protagonisten nahmen es in Kauf.
Sofort am nächsten Tag schlug er den Weg zum Bezirkskrankenhaus nach Neukölln ein, die nächstgrößere Klinik, und sprach bei der Oberin vor, einer gestandenen, aber freundlichen Matrone in tadelloser Schwesterntracht und mit weiß gestärktem Häubchen, unter dem die grauen Haare zu einem Dutt verdreht waren. Zwei gütige Augen musterten ihn dabei, wie er unsicher und befangen sein Anliegen vortrug. Ihr Kopfnicken bestärkte ihn darin, ungezwungener zu werden.
„Natürlich, Sie können sofort anfangen. Ich habe auch schon eine interessante Abteilung im Kopf, die Neurochirurgie. Professor Aalhus ist ein sehr netter und freundlicher Chef.”
Peter dachte an den gestrigen Film, sicherlich wäre Aalhus mit seinem Können im Wilden Westen ein brauchbarer Mann gewesen.
„Erscheinen Sie nächsten Montag pünktlich 7 Uhr hier im Büro, für die Einkleidung und um den Vertrag zu unterschreiben. Geld wird nicht gezahlt, Sie sind aber gegen Fehlverhalten versichert.”
Ein ergebendes Nicken. Von ihrem mütterlichen Charme beeindruckt, gelang ihm zum Abschied ein angedeuteter Diener.
Zu Dienstbeginn, nach einigen Anweisungen und zu befolgenden Regeln durch die Oberin belehrt, wurde er Schwester Bärbel von der Männerstation, einer erfahrenen Mitarbeiterin wie die Oberin sie lobte, übergeben, die sich sofort nach seinen pflegerischer Vorerfahrung erkundigte. Dabei musterte sie Peter mit strengen Augen und ernstem Gesicht, geprägt durch jahrelange und verantwortungsvolle Tätigkeit. Sein verneinendes Kopfschütteln wurde kommentarlos hingenommen. Der ihr zugeteilte Anfänger entfachte wenig Begeisterung. Resigniert nahm es Peter zur Kenntnis, er würde schon beweisen, dass er der Arbeit gewachsen war. So schwer konnte es auch nicht sein, Patienten zu waschen, sie zu betten, ihnen Essen zu bringen, sie auf den Topf zu setzen, sie zur Toilette und den Untersuchungen zu begleiten.
Nachdem er sich umgezogen hatte, trottete er Schwester Bärbel, die energisch voranschritt und am Ende eines Flures die Tür zu einem größeren Raum aufstieß, hinterher. Überrascht nahm Peter ein Dutzend halbnackter, bewusstloser Männer zur Kenntnis, alle, sofern nicht durch einen turbanähnlichen Verband verdeckt, mit kahlgeschorenen oder stoppelhaarigen Schädeln und an diversen piepsenden Geräten angeschlossen. Ein intensiver Geruch nach Desinfektionsmitteln lag in der Luft und raubte ihm den Atem. Nein, hier war keine wohlwollende Atmosphäre freundlich lächelnder, dankbarer Patienten, sondern ein wahrhaftiges die Sinne betäubendes Gruselkabinett, das Peter augenblicklich in die Knie zwang. Eine Vorwarnung wäre sicherlich angebracht gewesen. Ein Schwindel bemächtigte sich seiner, die Umgebung versank im Nebel, die Geräusche entrückten in weite Ferne, seine Knie wurden butterweich. Der Türrahmen war die letzte Hilfe.
„Verdammt.”
Nur nichts anmerken lassen, tief durchatmen, keine Schwäche zeigen.
Über seine Leichenblässe, den hier liegenden Patienten ähnlich, wurde kaltblütig hinweggesehen.
„Reine Routinearbeit, wir werden die Patienten neu betten.”
Deren Versorgung erfolgte mit klaren Anweisungen nach einem definierten Protokoll: entblößen, säubern, drehen, säubern, ein neues Stecklaken ausrollen, zudecken.
Eine heftige Hustenattacke erschütterte hin und wieder einen der Bewusstlosen, grüngelber Schleim flog aus der Beatmungskanüle auf die Bettdecke. Auch jetzt brachte Peter seine ganze Kraft auf, um nicht selber zum Patienten zu werden, die Blamage zu vermeiden. Er musste dem Schrecken der Krankheit trotzen.
Nach zwei Stunden hatten sie ihre Arbeit bewältigt.
„Pause, ein Kaffee gefällig?”
Ein wortloses Nicken, dankbar nahm er den dargebotenen Stuhl an.
„Das war schon starker Tobak.”
Die Spannung verflog. Ekel, das wurde ihm bewusst, gehörte zum Beruf. Aber auch später beschlich Peter immer noch ein unangenehmes Gefühl beim Absaugen des eitrigen Schleimes mit dem Schlauch aus den Lungen, häufig durch dessen Fremdkörperreiz begleitet von heftigen, abwehrenden Hustenattacken des Komatösen.
Nach und nach bekundete Schwester Bärbel, mit seiner Arbeit zufrieden zu sein und erlaubte ihm, wenn die Gelegenheit es ergab, bei Operationen zuzuschauen.
Vom glattrasierten Schädel wurde die Kopfschwarte gelöst und beiseite geklappt, im Halbmond Löcher in den Schädelknochen gebohrt und die verbliebenen Knochenbrücken mittels eines eingeführten Sägedrahtes durchtrennt, bis der Schädelknochen entfernt werden konnte. Dann erfolgte der Schnitt durch die harte Hirnhaut, ebenfalls zur Seite geklappt und festgenäht, darunter kamen die weichen Hirnhäute mit den sichtbaren Windungen des Gehirnes zum Vorschein, der Sitz des jetzt ausgeschlossenen menschlichen Geistes.
„Skalpell bitte.” Der operative Eingriff begann. Filigrane, langwierige chirurgische Arbeit.
Zuletzt Verschluss der Hirnöffnung und den Patienten kommen lassen.
Auf der Allgemeinstation zählte zu den pflegerischen Aufgaben, das Messen von Puls und Blutdruck, auch das Abfragen der Patienten nach ihrem Schlaf, dem Appetit und ihrer Verdauung. Besonders ältere Menschen waren übergebührlich auf diese Bedürfnisse fixiert. Das Essen war von der Küche vorgegeben, zum Ein- und Durchschlafen halfen Tabletten, auch für die Verdauung. Aber Letzteres verlangte auch immer mal wieder aktives Handeln und dabei kam es darauf an, bei diesem sorgenträchtigem Thema mit der notwendigen Ernsthaftigkeit vorzugehen und aufmunterndes Lachen zu vermeiden, das als sich lustig machen missverstanden werden konnte. Mit Geschick und entsprechender Würde setzte Peter alsbald Klistiere und beherrschte den erlösenden hohen Schwenkeinlauf, wenn alles andere versagte. In Anerkennung seines Bemühens spendierten die von dieser Arbeit entbundenen Schwestern Kaffee und Kuchen und freuten sich über Peters Eifer. Es war ihm ein Bedürfnis, ihnen in diesem Sinne zu beweisen, wie er ihren, mitunter niedrigsten Bedürfnissen nachkommenden, Beruf schätzte.
Ebenfalls, wenn auch verhalten, ihrer Art entsprechend, aber zunehmend wohlwollender, sprach Schwester Bärbel, von seinem Eifer angetan, ihm Mut zu, bei der Stange zu bleiben und ein guter Arzt zu werden.
„Du solltest Neurochirurg werden, hast geschickte Hände“, nickte sie anerkennend.
„Um den Sitz der Seele zu finden, würde ich es machen. Aber ich glaube, das ist mehr die Aufgabe eines Psychiaters.“
„Egal, auch das traue ich dir zu.“
Peter staunte, tatsächlich, hier war jemand, der ehrlich von ihm überzeugt zu sein schien, ihn bestätigte, der sich gerne seinen Selbstzweifeln hingab. Er spürte plötzlich eine Verbundenheit mit diesem ansonsten so verschlossenen Wesen, und gegen seinen Willen konnte er nicht anders, als Schwester Bärbel beim Abschied zu umarmen. Das Leuchten in ihrem ansonsten so herben Gesicht machte ihn glücklich.
Er fühlte sich auf dem richtigen Weg.