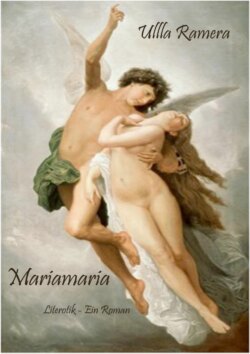Читать книгу MARIAMARIA - ULLLA RAMERA - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Jordan im Schoß
ОглавлениеDas Wasser rauscht, das Wasser schwoll
Da lag sie im Ufergras. Ihr rosaweißer, längsgestreifter Minirock war weit nach oben geschoben, ihre Füße baumelten im lauen Jordanwasser, dessen zarte Wellen in unendlichen und sanft plätschernden Bewegungen ihre schlanken Waden bis hin zu den Knien netzten. Die grelle Nachmittagssonne verschloss Mariamarias Augenlider, und ihre Tagträume begannen darunter zu blinzeln.
Tatsächlich versank sie in einen angenehmen Halbschlaf, in dem der Wind der Gedanken und Träume den Vorhang ihrer Erinnerungen vor und zurück wehte und sie bruchstückweise erahnen ließ, was sie in den letzten Wochen erlebt hatte. Oder meinte sie nur, dies erlebt zu haben?
Wieso war ihr aufgefallen, dass sich auf der Straße alle Leute nach ihr umdrehten, ja alle Leute, nicht nur die jungen Männer und deren halbwüchsige Vorgänger, auch Frauen, Mädchen, ältere Damen und Greise starrten sie an. Sie spürte es, dass alle die Köpfe nach ihr wendeten, sie musste sich gar nicht erst vergewissern.
Sie war Mariamaria, sicher, na und? War sie etwas Besonderes? Sie war ein bisschen größer als ihre Klassenkameradinnen und Freundinnen, gewiss, ein wenig dunkler im Teint, und ihre kastanienfarbenen Haare hatte die Natur leicht gekräuselt, ihre rehbraunen Augen waren selten mit ungeübter Hand geschminkt, und ihre eher dunklen vollen Lippen hatte sie kaum künstlich aufgerötet. Doch natürlich: Sie war schon ein Stück beseligt mit ihrem Erscheinungsbild, sie sah sich gar nicht arrogant, weiß Gott nicht, wie sie dachte - wer würde schon einer eingebildeten Schneegans hinterher blicken - sie war einfach nur zufrieden und glücklich.
Oder war es das, was die Blicke der Leute faszinierte?
Sie war sich plötzlich nicht mehr ganz so sicher, wenngleich sie nicht genau wusste, warum sie unsicher sein sollte, vor allem wenn ihr immer wieder in den Sinn kam, ob es nicht doch eine vielleicht ganz andere Bewandtnis haben sollte, weshalb die Menschen sie ansahen. Nach und nach fiel ihr ein, dass sie in den letzten Wochen unruhig geschlafen hatte, sich unter ihrer Decke hin und her gewälzt, ihr Gesicht ins Kopfkissen gepresst hatte, immer wieder. Wem konnte Mariamaria davon erzählen, wo sie selbst nicht genau wusste, was in ihrem Schlaf vor sich ging, und welche Schatten immer wieder hinter ihre Augenlider huschten?
Wahrscheinlich brauchte sie noch viele Tagträume am Jordanufer mit ihren baumelnden Beinen im Wasser, damit die Mosaiksteinchen ihrer Erinnerung - oder ihrer Phantasie? - sich zu einem einigermaßen ansehbaren Bild zusammenfügen könnten.
Für heute, an diesem sonnigen Nachmittag im August war es erst einmal ein Beginn von Gedankenfluten und Fantasieströmen, von denen sie glaubte, der Jordan würde um sie wissen, der Jordan würde sie ihr spenden, oder vielleicht zurückgeben. Was Flüssigkeiten alles bewirken konnten, sicherlich hatte sie in der Schule im Chemieunterricht schon einiges darüber gehört, aber heute Nachmittag fühlte sie es, wie der Jordan sie in die Pflicht nahm und seine schwimmenden Ahnungen an ihre bloßen Beine wies.
Und je länger sie im Ufergras schlummerte, Mariamaria fühlte es, sie fühlte den Jordan an ihren Sohlen und an ihren nackten Waden, sie spürte es im Halbschlaf, wie der Fluss ihre ungeordneten und schleierhaften Traumgebilde an den Knien vorbei an ihren Beinen hinauf in ihren Schoß schob.
Was für ein schleichendes Kribbeln, das sich über ihren nach wie vor flachen Bauch durch ihre atembewegte Brust irgendwie doch behaglich in ihre Stirne zog. Die vom Jordan entsandte verschlüsselte Botschaft entfachte nun wahrlich - noch - keinen Sturm unter ihrem krausen Schopf, vielleicht war es auch deutlich tiefer, das konnte sie in diesen Momenten nicht ausmachen, nein, keinen Sturm, aber ein sanftes Gedankensäuseln, das sie bisher so noch gar nicht empfunden hatte.
Wie lange mochte sie hier schon gelegen haben, mit ihren im Jordanwasser baumelnden Beinen? Nachdem die Sonne begonnen hatte tiefer zu stehen und ihre nun nicht mehr so grellen Strahlen Mariamarias Augen erlaubten unter den langen dunklen Wimpern langsam zu blinzeln, tasteten ihre Hände die Wirklichkeit der sie umgebenden Natur ab: die Linke fühlte das Gras unter ihren Hüften und den Übergang zwischen Haut und Stoff, die Rechte musste feststellen, dass ihre Beine gar nicht mehr von ihrem Rock bedeckt waren. Ihre Wangen röteten sich noch mehr, als es die Sommersonne schon getan hatte, sie stützte sich auf ihre Ellenbogen und sah sich vorsichtig um, aber sie konnte niemand um sich herum erkennen. Wer legt sich schon in die pralle Mittagssonne?
Auf jeden Fall war es Mariamaria fürchterlich peinlich, unter welcher Erscheinung sie ihren Tagtraum durchgemacht hatte. Wenn sie nur jemand gesehen hätte! Sie schämte sich wie eine ertappte Sünderin, schließlich hatten ihre Eltern sie von Kind auf zur Keuschheit erzogen, und sie hatte es sich bei jedem Nachtgebet vorgenommen, ein tadelloses Mädchen- und später Frauenbild zu bewahren. Daran sollte sich auch nichts ändern, und ausgerechnet heute Nachmittag war es ihr widerfahren, dass sie so erhitzt aufwachte, und womöglich hatte sie überdies noch liederlich und zügellos geträumt, aber das wusste sie gar nicht wirklich.
Sie nahm den Saum ihres hellblauen T-Shirts zwischen die beiden Daumen und Zeigefinger und begann die Schweißperlen auf ihrem Bauch und in der Kuhle ihres Nabels abzutupfen, auch zwischen ihren Beinen trocknete sie die zurückgebliebene Feuchte, die sie bislang noch nie bemerkt hatte, und letztlich wischte sie sich den letzten Schrecken aus ihrer gerunzelten Stirne.
Der hellblaue Stoff ihres Trägershirts hatte sich schweißdunkel gefärbt, und die schwüle Nachmittagshitze zauberte weiße Ränder um die getränkten Flecken. Hoffentlich stellten ihre Freundinnen keine beißenden Fragen wegen der Schweißränder und des krebsroten Gesichts. Den Eltern könnte sie immerhin erklären, dass sie mit den benachbarten Tischlerjungen noch eine Runde Basketball gespielt habe, aber nein, die Idee war vielleicht doch nicht so gut, denn schließlich spielt man mit den Nachbarsjungen nicht Basketball im Minirock und Sandalen, und außerdem war es sowohl dem Vater, aber schon längst der Mutter aufgefallen, dass Josip, der Ältere von beiden, mindestens ein Auge auf ihre Tochter geworfen hatte. Und dabei unterschied er sich überhaupt nicht von all den anderen Leuten, die Mariamaria auf Schritt und Tritt anstarrten. Aber Josip wäre immerhin noch - beinahe - der einzige gewesen, dem sie seine warmen und doch unruhigen Blicke nicht übel genommen hätte.
Also, irgendetwas musste passieren mit dem schweißspurenübersäten, nicht mehr ganz hellblauen T-Shirt. Mariamaria dachte unwillkürlich an ihre ältere Cousine Elsbet. An ihrem Haus musste sie sowieso vorbeikommen, ihr könnte sie wohl zu verstehen geben, sie zu nehmen wie sie ist, und Onkel und Tante waren sowieso ein wenig tappig, die sollten ihr beflecktes Oberteil gar nicht bemerken.
Was würden nur all die Leute, die sie unablässig mit ihren Blicken verfolgten, von ihr denken, wenn jene sie jetzt in diesem Zustand sehen könnten? Vielleicht würden sie mit ihrem Augenaufschlag etwas sparsamer umgehen?
Mariamaria hatte ganz vergessen ihre Beine wieder züchtig zu bedecken, sie holte das schleunigst nach, indem sie versuchte die Falten ihres Minirocks glatt nach unten zu streichen. Sie zog ihre nackten Beine aus dem Jordanwasser, stand auf und trocknete die Füße im Ufergras. Dann schlüpfte sie in ihre flachen braunen Sandalen, zog den Lederrucksack zu sich hin und stieg die Böschung hinauf.
Um zu Elsbets Haus zu gelangen und möglichst unerkannt zu bleiben, musste sie einen kleinen Schleichweg einschlagen, der sie durch den winzigen Stadtpark von Nazareths südlichem Viertel führte. Von dort aus gab es nur noch eine Querstraße zu durchlaufen.
Die Haustüre ihres Onkels war, wie immer im Sommer, nur angelehnt, und so schlich sie schnurstracks zu Elsbets Zimmer, das auf der hinteren Seite des Hauses lag. Durch die Hoftüre sah sie, dass Onkel und Tante, die schon ein wenig schwerhörig waren, im Garten saßen und Karten spielten.
Elsbet, auf ihr Schlafsofa gelümmelt, mit dem Notebook auf den Knien und Kopfhörern auf den Ohren, hatte sie nicht sofort bemerkt und erschrak, nachdem Mariamaria ihre Zimmertüre aufgedrückt hatte. Aber sofort legte sie ihrer Cousine die Hand auf den Mund, um sich und die Situation nicht zu verraten.
Elsbet riss sich die Kopfhörer von den Ohren, schaute Mariamaria mit weit geöffneten Augen an, legte ihre Stirn in tiefe Falten, presste dann die Lippen zusammen, spaltete sie wieder mit der vorgeschobenen Zunge und stammelte: Ja, wie siehst du denn aus? Mariamaria schoss die Schamröte ins Gesicht, was ihre Cousine auch sofort bemerkte und mit hochgezogenen Brauen quittierte.
Als wenn sie in einer heiklen Situation ertappt worden wäre, drückte Mariamaria ihre oberen auf ihre unteren Wimpern, nahm tief Luft, ließ sie ganz lange in ihrer Brust, bevor sie stoßend, laut und lange ausatmete, ohne irgendetwas zu entgegnen. Langsam richtete sie ihren Blick auf Elsbets offenen Mund mit dem hängenden Unterkiefer. Die Cousine sog ebenfalls ihren Atem tief durch die Nase ein, stieß ihn jedoch sogleich durch die Zähne aus und wollte gerade wieder zu einer weiteren Frage ansetzen.
Doch Mariamaria hatte schon damit gerechnet, sie streckte den rechten Arm vor in Richtung Elsbets Brust und hielt ihr die gespreizten Finger der offenen Hand entgegen. Elsbet ließ ihre ausgebreiteten Hände klatschend auf ihre Schenkel fallen, sah Mariamaria durchdringend, fragend in die Augen und konnte den wundersamen Anblick ihrer jüngeren Cousine nicht fassen.
Mariamaria biss sich schnell mit den Schneidezähnen auf die Unterlippe, fuhr dann mit der Zungenspitze hektisch über die trockene Oberlippe und legte nur den linken Zeigefinger darauf, um Elsbet zu bedeuten, sie möge jetzt nichts mehr fragen. Eine Zeitlang betrachteten sich die Beiden wortlos, bis Mariamaria seufzend das Schweigen brach und ihrer Cousine langsam und leise zuflüsterte: Bitte sag jetzt nichts mehr, ich weiß auch nicht genau, was mit mir los ist, bitte frage nicht weiter, ich werde dir ganz gewiss erzählen, sobald ich wieder einigermaßen klar denken kann.
Elsbet schloss den Mund, räkelte sich aus den Kissen, stand mühsam auf, machte eine hilflose Handbewegung, legte ihren Kopf zur Seite, strich sich die Haare aus der Stirne und nickte mehrfach vor sich hin. Lange standen sie sich mit hängenden Schultern gegenüber, bis Mariamaria endlich murmelte: Du siehst, meine Liebe, so kann ich auf keinen Fall nach Hause gehen und den Eltern unter die Augen treten, die fragen dann genauso unverständlich wie du, und ich kann ihnen, genauso wie dir, keine Antwort geben. Das Einzige, was ich jetzt unbedingt brauche, ich muss dringend mit dem verschwitzten T-Shirt unter die Dusche gehen und die Schweißflecken heraus waschen.
Elsbet überlegte lange, verschränkte die Arme unter ihrer üppigen Brust, runzelte die Stirn, blickte zur Decke und sah dann Mariamaria ratlos an, bis sie ihr entgegnete: Aber du kannst doch noch viel weniger mit dem nassen Hemdchen nach Hause kommen. Doch Mariamaria hatte sich ganz offensichtlich die Lösung blitzschnell zurechtgelegt: Das ist kein Problem, wir winden es gemeinsam aus, stecken es in den Wäschetrockner, und den Rest erledigen wir mit deinem Fön. Bis ich daheim ankomme, hat es der Sommerwind ganz und gar getrocknet.
Elsbet hatte den Plan ihrer Cousine verstanden, nickte beifällig, ließ sich, mit dem Po zuerst, auf ihr Schlafsofa fallen, suchte mit ihrem Rücken Halt an der Lehne, zog die Knie, die sie umarmte, bis an die Brust und legte den Kopf seitlich auf ihre Arme, abwartend, was die Cousine nun machen würde. Mariamaria blickte sich im Zimmer um, sodass ihr erst beim erneuten Hinsehen auffiel, dass Elsbet mit ihren hochgezogenen und vom Faltenrock unbedeckten Beinen viel zu viel blanke Haut frei gab und so einen - sicherlich ungewollten, ungewohnten - Anblick bot, der ihr bisher nicht aufgefallen war.
Elsbet betrachtete gespannt und neugierig, wie Mariamaria die Sandalen abstreifte, den rosa-weiß gestreiften Minirock über ihre Schenkel und Waden nach unten schob und erst mit dem linken und dann mit dem rechten Fuß heraus stieg. Was noch blieb, war der weiße Slip. Elsbet hob den Kopf, und ihre Augen wurden immer größer, als Mariamaria völlig unvermittelt, ohne zu zögern und gänzlich ohne Scham ihre Daumen auf Höhe der Hüftknochen in den Bund ihrer Unterhose steckte und diese Stück für Stück unter schlängelnden Bewegungen ihrer Hüfte zu den Oberschenkeln, über die Knie zu den Knöcheln schob. Sich vom Minirock zu befreien war leichter gegangen, ihre Unterhose blieb jedoch an den Fersen hängen, und sie musste sich mit den beiden Fußsohlen ruckartig herauswinden. Elsbet hatte Mariamarias Anstrengungen halb überrascht, halb belustigt verfolgt, automatisch glitt ihr Blick, als sich die Cousine wieder aufrichtete, ebenfalls mit nach oben und wurde von einer haarigen Hülle abgefangen.
Mariamaria drehte sich ganz schnell um und steuerte direkt auf die Duschkabine zu, die sich hinter der Tür am Eingang des Zimmers befand. Elsbet hörte, wie die Armaturen aufgedreht wurden. Mariamaria spielte mit dem warmen und kalten Wasser, pendelte sich schließlich bei einer lauen Temperatur ein und ließ das Nass über die Schultern auf ihre Vorderseite prasseln. Zwei Knospen blühten durch den nassgesaugten Stoff ihres triefenden Hemdchens, und sie spürte ihre Wölbungen unter den Händen. Immer wieder blickte sie auf die Spuren, die sie vom Jordanufer mitgebracht hatte, versuchte diese wegzustreichen und sah, wie sie langsam verschwanden.
Mit Wassertropfen zwischen den Zähnen rief sie nach ihrer Cousine: Komm, hilf mir, das Hemdchen hinten zu reinigen! Elsbet stand sofort vom Sofa auf, eilte herbei, öffnete die Tür der Duschkabine und begann die weißen Schweißränder auf der Rückenseite zu bearbeiten. Sie rubbelte mit ihren Fingerspitzen über die inzwischen tiefblaue Baumwolle, zupfte immer wieder den getränkten Stoff von Mariamarias Rücken und ließ neues Wasser darauf niedersprenkeln, so lange, bis die Flecken endgültig verschwunden waren. Dabei zog sie das Hemdchen hinten und vorne nach unten gerade, und unwillkürlich, beinahe absichtslos, streifte sie die dunkelbraunen Haarkringel, die sie schon beim Auskleiden ihrer Cousine verblüfft hatten und die sie selbst bei sich nicht mehr spüren konnte.
Mariamaria signalisierte, dass die Waschprozedur nun beendet sei, drehte sich zu Elsbet und zog sich das T-Shirt mit beiden Händen über ihren kastanienbraunen Wuschelkopf. Elsbet, die ihre Nase immer noch genau in die Mitte der Duschtürfüllung gehalten hatte, nahm das Hemdchen entgegen und konnte, wie angewurzelt, nicht anders, als ausgerechnet ihren Blick auf die triefenden festen Hügel ihrer Cousine zu richten, und sie war von dem Anblick dermaßen gefangen, dass es ihr nicht gelang, die Augen von dieser runden Schönheit abzuwenden, aus der noch zwei aufrichtige kleine Wunderdinge herausragten, die sie, so erhaben, bei sich im Spiegelbild nie wahrgenommen hatte.
Mariamaria stellte sich auf die Zehenspitzen und griff zum Badetuch, das Elsbet immer auf der Duschtüre liegen hatte. Sie zog es mit einem leichten Ruck zu sich herab, entfaltete es, schüttelte es aus und verknotete das Handtuch dann über ihrem Busen. Fast gleichzeitig fassten sie nach der blauen Wäsche, legten sie zusammen, drehten sie gegenläufig und begannen das T-Shirt auszuwinden.