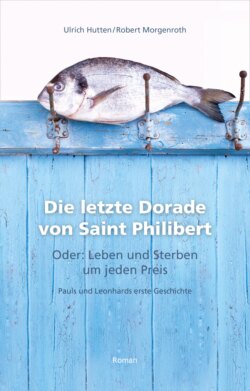Читать книгу Die letzte Dorade von Saint Philibert oder: Leben und Sterben um jeden Preis - Ulrich Von Hutten - Страница 6
Zweites Kapitel: Zwei Freunde und ein Besäufnis
ОглавлениеEs gibt Tage, die vergehen so spurlos wie eine Burg aus Sand, zu nah am Wasser gebaut. Man macht, man schaufelt, man hat auch seine Freude. Aber, kaum ist man weg, kommt die erste Welle, spült Burg und Graben zu Hügeln weich, die nächste ebnet Berg und Tal zu sanften Bodenwellen ein, die letzte wischt sie vollends weg, als wäre nie etwas gewesen. Sie mehren sich, seit er im Ruhestand lebt, solche Tage. Seit Merkwürdiges seltener wird, gehen sie unbemerkt verloren, zerrinnen unmerklich im Bewusstsein, verschwinden still und leise aus dem Gedächtnis, versinken wie Sand im Wasser und Wasser im Sand. Auch heute war so ein Tag und ist schon wieder vorbei.
Fernsehbilder dringen auf ihn ein, heftiger als sonst. Sie kommen von nah, aus Europa, die täglichen Fernsehnachrichten leben vom Maidan, Brandaktuelles schwarz-weiß gezeichnet, in farbigen Pixeln und HD-Qualität, Barrikaden, Rauch und Feuer, gepanzerte Fahrzeuge. Showdown, blutüberströmte Kämpfer, martialisch vermummte Frauen, Zöpfe unter Stahlhelm, tote Helden und fliehende Schurken. Europa sitzt auf dem Sofa und schaut zu, gespannt, wie in der Ukraine Menschen für Europa kämpfen und für sich selbst, für die Chance, dazu zu gehören, dabei zu sein. Das gibt es tatsächlich noch auf dem guten alten Kontinent, Sterben für ein besseres Leben, für eine Sehnsucht, für ein Zukunftsprojekt, für Grundrechte, für Mitbestimmung, für Freiheit. Derweil stehen in der EU freie Wahlen an. Und es interessiert kaum einen. Warum auch, wenn es nur noch um Zahlungen und Zahlen geht. Ein paar hundert Kilometer weiter wird dafür gestorben.
Die Wahrheit stirbt zuerst, Krieg ist ihr Karfreitag, auch wenn sie wieder aufersteht, nicht schon an Ostern, am dritten Tag, aber irgendwann, wenn Hinterbliebene, Journalisten oder Historiker, manchmal auch Polizisten, Querköpfe, Pazifisten oder Juristen keine Ruhe geben und sie wieder ausgraben. Menschen fallen auf dem Maidan und Aktien steigen auf dem Parkett. Im Fernsehbild die Toten. Nicht auf dem Schirm die Strippenzieher und die Oligarchen. Im Bild der fliehende Autokrat. Nicht im Bild die Schreihälse, die Neonazis, die Geheimdienste. Europa ohne Russland, das kann nicht gut gehen. Jedenfalls nicht lange. Kein gemeinsames europäisches Haus ohne ein Fundament, das alle trägt, ohne Räume, in denen sich alle aufgehoben fühlen. Eingriff, Angriff. Und Rückgriff auf alte Muster, Rückfall in vergangen geglaubte Zeiten. Maskierte Militärs, russische Milizen, Warnschüsse gegen Beobachter, Armee marschiert. Aufregung, nicht nur in Europa. Aus tiefen Schichten Geschichte kocht Magma hoch. Annexion. Das bequeme Sofagefühl wird brüchig. Angst kommt auf, kriecht tief in den Westen hinein. Und eine Stimmung, als wäre wieder kalter Krieg. Dünnes Eis.
Jetzt ist Dr. Leonhard Ross erleichtert, dass er nicht mehr Chef sein muss in einer Redaktion, nicht mehr dirigieren und formulieren muss, um im Blatt Linien und Orientierung vorzugeben, dass er auch nicht mehr einordnen und kommentieren muss für die sogenannte öffentliche Meinung, dass er sich nur noch seine eigenen Gedanken machen darf. Und die kann er für sich behalten. Oder heftig mit seinen Freunden diskutieren. Und seiner Freundin.
Er schaltet den Fernseher aus, stemmt sich ein wenig steif aus bequemer Sesseltiefe, holt seinen Black Bush aus dem Schrank, gönnt sich eine Daumenbreite dreifach aus Single Malt destilliertes, im Sherryfass gereiftes Goldgelb, schwenkt das Glas, erschnuppert die milde, aber verheißungsvolle Würze und tritt hinaus auf den Balkon. Es ist dunkel geworden draußen. Vogelstimmen mischen sich in Stadtlärm ein. Sein Blick wird magisch angezogen vom schimmernden Wasser, schweift hinüber zum See, verfängt sich in den Silhouetten der Hecken und Bäume. Deshalb wohnt er hier, weil er wassersüchtig ist, so wie andere nicht leben können ohne Weite oder ohne Berge oder ohne Mozart oder ohne Kneipen im Kiez. Eine Ente schnarrt vom Ufer herüber, findet Antwort. Der See hüpft im Wind. Er bewegt sich immer, aber immer anders, selbst wenn er stillzustehen scheint, bewegt er sich, unter spiegelglatter Oberfläche wie manchmal am frühen Morgen. Jetzt tanzt er silberschwarz unter dem halben Mond und die Trauerweiden baden ihre Zweige.
Am Uferweg streckt sich schräg ein Baum halb zur Erde, halb zum Himmel, sendet seine Äste aus und sein Gezweig, noch kahl, nackt, ins Leere. Tagsüber ist hier Getümmel, vor allem an den Wochenenden, ist alles auf Beinen oder Rad, Kinder hüpfen Trippeltrappel, Radler drängeln, Hunde streunen oder ziehen an der Leine, Väter schieben Kinderwägen, alte Frauen ihre Rollatoren, Jogger ziehen ihre Bahn. Jetzt ist Ruhe eingekehrt, niemand ist mehr unterwegs, das ferne Hochhaus schickt sein Fensterlicht herüber, eins überm andern, als stiege eine Lichterkette ins Dunkel hinauf. Über dem Horizont der Stadt mischt dunstiger Smog schwaches Rot und sattes Orange in den Himmel, aus der Luft malt irgendetwas bewegte Linien aus Licht hinein, darüber sitzen seidensilberne Sterne in durchsichtigem Schwarz.
Leonhard fröstelt ein wenig, nimmt einen Schluck, ergibt sich dem wilden Überfall auf seinen Gaumen, der sich brennend den Hals hinunterzieht, um sich warm und wohlig im Magen zu dehnen. Er träumt vor sich hin, denkt wieder, schon wieder an Karla, seine Freundin, fragt sich, ob er sie jetzt anrufen kann oder kurz zu ihr hinübergehen ins nahe Nachbarhaus, denkt nach, ob es gut war, sich hier niederzulassen im deutschen Nordosten, wo sich Weltkultur und Naturwelt, Ossi und Wessi, Hauptstadt und Residenz, Platte und Palast, Preußen und das neue Deutschland so innig berühren, freut sich, dass es so gekommen ist, dass er gekommen ist, hierher in diese Stadt, an diesen See, wo er seiner Freundin nah sein kann, dem Wasser und sich selbst.
Ein fast euphorisches Glücksgefühl überschwemmt ihn, das er dankbar empfängt und festhält für einen Moment. Und eine kurze Sehnsucht steigt in ihm auf, mit seiner Freundin verheiratet zu sein. Weil er sie so lieben kann wie noch keine Frau zuvor, in einer Leichtigkeit, die er nicht von sich kannte vorher und erst spät in seinem Leben zu entdecken begann. In Momenten wie diesem schmerzt es ihn zu wissen, dass er nicht zu Heirat taugt, dass er ein falscher Fünfziger ist als Ehemann, weil er nicht treu sein kann, sexuell. In solchen Momenten, wenn die Liebe zu seiner Freundin ihn so heftig überkommt, könnte er, sentimental wie er ist, weinen vor Glück und aus Schmerz. Und er wäre gerne monogam in diesem Augenblick. Aber so ist er nicht veranlagt, die meisten Männer sind es nicht. Und verlogen will er nicht sein, das muss nicht mehr sein in seinem Alter.
Er wirkt auf Frauen, immer noch. Mit seiner silbernen Künstlermähne, überhaupt mit seinem ganzen Äußeren, schlank, sportlich, groß, ein stattlicher, trotz seiner 68 Jahre energiegeladener Mann. Schon zu seinen Zeiten als Chefredakteur beeindruckte seine stets gediegene Erscheinung, elegant aber leger sitzende Maßanzüge, aktuelle Krawatten, die einen farbigen Akzent setzten. Boss, das war auch sein Label, Nino Cerruti sein Duft. Wenn er den Raum betrat, war ihm Aufmerksamkeit sicher. Inzwischen fühlt er sich tausendmal wohler in legerem Freizeitlook, freut sich an den Naturfarben seiner bequemen Leinen-Hosen, schlüpft in lockere Polohemden, zieht sich schicke, lässige Lederjacken über. Mit der unvermeidlichen Sonnenbrille, die seine Augen stets verdeckt, könnte er einen alternden Playboy geben. Aber er trägt die dunklen Gläser nicht zur Schau, nicht als modischen Gag, sondern auf Anordnung seines Arztes, zum Schutz seiner stets entzündeten Augen.
Ohnehin wirkt er nie wie ein flotter Lebemann. Davor bewahren ihn das leicht besorgte Mienenspiel, das seinen Gesichtszügen Ernsthaftigkeit verleiht, sein zugewandtes Wesen gegenüber jedem Gegenüber, die intellektuelle Nachdenklichkeit, die ihm auf die Stirn geschrieben ist, auch wenn unzählige kleine Lachfältchen um Augen und Mund eine angeborene Frohnatur offenbaren. Vielleicht hätte sein angenehm ebenmäßiges Gesicht ein wenig langweilig gewirkt, wäre es nicht in interessante Falten gelegt. Von den Spuren seines Lebens. Die Frauen haben ihn immer geliebt. Und er sie.
Irgendwo klingelt es, er will es nicht hören. Nicht jetzt. Er lächelt, weil ihm plötzlich die heftigen Diskussionen einfallen, als sie noch Schüler auf dem Gymnasium waren und darüber stritten, ob das geht, ob das überhaupt erlaubt ist, Sex ohne Liebe. Und er sich immer etwas geschämt hat, weil es ihm schon damals so ging, wenn er ehrlich war. Es gab einfach Mädchen, auf die er scharf war, die sein Glied versteiften, selbst wenn er von ihnen sonst nichts wusste. An sie dachte er, wenn er onanierte, unter der Bettdecke, auf dem Klo oder im Schuppen auf dem Dachboden, gemeinsam mit seinen Freunden aus dem Dorf. Und dann gab es die andere, immer nur die eine, für die er schwärmte und die auf keinen Fall vorkommen durfte in seinen Phantasien, die er verbannte aus seinem Kopfkino, wenn er sich anfasste, um sie auf keinen Fall zu beschmutzen, wie die blonde Katharina aus dem Schulchor, Tochter des Notars, um deren Haus er manchmal radelte mit Herzklopfen.
Wieder katapultiert ihn das Klingeln in die Gegenwart. Vielleicht ist es das Telefon in seiner Wohnung, vielleicht sind es aber auch Friedel oder Rolli. Es vibriert in seiner Hosentasche, aber nicht seiner Gedanken an Karla oder Katharina wegen. Er kramt sein Smartphone heraus.
„Ich bin’s, Paul.“
„He, caro amico, hast du gerade eben auf dem Festnetz angerufen?“ Leonhard hätte seinen Freund jetzt gerne bei sich gehabt und umarmt.
„Nein, ich war das jedenfalls nicht“, antwortet Paul belustigt, weil diese Rückfrage fast immer kommt, wenn er bei Leonhard anruft. „Kann es vielleicht sein, dass dich dein Liebespärchen schon wieder foppt?“
Leonhard lacht. „Ja, sie können es einfach nicht lassen.“
Elfriede, von ihm zärtlich Friedel gerufen und Rolli, sind eine Hinterlassenschaft seiner Mutter. Sie waren ihre letzten Gefährten und sie hatte sich glänzend mit ihnen unterhalten bis zu ihrem Tode. Die Graupapageien mit ihrem silbern meliertem Gefieder, im Farbton Leonhards Künstlermähne durchaus ähnlich, und dem strahlend roten Schwanz leben seither mit ihm, in einer Wohngemeinschaft der etwas anderen Art, so artgerecht, wie es eben möglich ist bei Tieren in Gefangenschaft. Ihr Zuhause, eine großzügige Voliere, füllt ein ehemaliges Gästezimmer fast zur Hälfte. Aber noch lieber fliegen sie umher in seiner ganzen Wohnung und jetzt ist es Leonhard, zu dessen Unterhaltung sie gerne beitragen, wenn sie nicht gerade untereinander kommunizieren, eine durchaus respektable Gegenleistung für ihren Unterhalt.
Schlau und sprachfertig haben sie sich neben der Fähigkeit, Farben zu erkennen und zu benennen, auf die perfekte Imitation von Klingeltönen spezialisiert. Und so sind sie es, die es des Öfteren klingeln lassen in seiner Wohnung, als rufe ihn die ganze Welt auf einmal an. Leonhard versuchte zunächst, sich durch das tägliche Umstellen auf immer neue Klingeltöne einen gewissen Vorsprung vor ihrer Lernfähigkeit zu verschaffen. Aber er musste erkennen, dass er damit das Repertoire von Elfriede und Rolli nur permanent erweiterte. Irgendwann war er mit den mehr oder weniger erfreulichen Melodien seines Smartphones von Andromeda und Basic Bell bis Ursa minor und Wine bottle ziemlich durch, mit dem Effekt, dass sowohl er wie seine beiden Vögel das ganze Programm auswendig kannten. Inzwischen hat er sein Gerät auf Stumm geschaltet und versucht, seine Anrufe allein an der Vibration zu erkennen. Dafür gönnt er sich die Lautsprecherfunktion, wenn er telefoniert. Dann hört er leichter und das Gerät drückt ihn nicht so am Ohr. Allerdings hören auch Elfriede und Rolli stets zu und geben ihre Kommentare ab.
„Was treibst du gerade?“, fragt er seinen Freund, der seine etwas speziellen Lebensverhältnisse ja kennt.
„Bin gerade erst nach Hause gekommen, koch mir was und bügle nebenher meine Hemden“, sagt Paul. „Aber jetzt ist es leider eingebrannt“.
„Ins Essen oder in die Hemden, oder in beides?“, spöttelt Leonhard. „Willst du dir nicht endlich jemand gönnen, der sich um deine Wäsche kümmert und dir vielleicht sogar beim Putzen hilft?“
„Warum sollte ich. Das Einzige, was ich wirklich brauchen könnte, ist eine Sockensortiermaschine, eine, die sucht und sortiert. Und du, was machst du so?“
„Ich stehe auf meinem Balkon, hab ein Glas Black Bush bei mir und meinen See vor mir, gucke in die Nacht hinaus … Es geht mir wunderbar.“
„Nicht mehr lange, mein Lieber. Ich hab ein Attentat auf dich vor.“
„Mein lieber Paolo, mir ist gerade überhaupt nicht nach Attentat“, entgegnet Leonhard seinem Freund Paul wahrheitswidrig.
„Attatat-tat-tat“, echoen seine Papagaien im Hintergrund.
*
Ihre Bedürfnisse nach Ruhe oder Aufregung liegen im Augenblick nicht unbedingt auf einer Linie. Berufsbedingt. Paul Wiesensee und Leonhard Ross sind altgediente Journalisten. Aber ihre Lebenssituation ist sehr verschieden. Paul, stets einfacher Lokalredakteur geblieben und in seiner südwestdeutschen Kurstadt immer noch beruflich gefordert, sehnt seinen letzten Arbeitstag herbei. Leonhard hingegen, der journalistisch eine Blitzkarriere als Blattmacher und Chefredakteur hinlegte, kommt selbst im Ruhestand nicht ohne Arbeit aus. Zumindest nicht ganz.
Beide könnten in ihren äußeren wie in ihren inneren Eigenschaften unterschiedlicher nicht sein und sind einander doch vertraut wie ein altes Ehepaar. Das bleibt mit den Jahren unter Freunden nicht aus, wenn man sich so lange kennt, fast ein ganzes Leben lang, seit der Zeit schon, als Paul in der kleinen süddeutschen Stadtredaktion auftauchte, um Dr. Leonhard Ross, dem neuen dynamischen Lokalchef, seine Talente anzubieten.
Leonhard quälte sich gerade mit dem Beitrag eines Bürgermeisters aus dem Umland ab, der unbedingt noch heute ins Blatt gehoben werden sollte, sich aber faktisch in nichts vom amtlichen Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung unterschied und im Wesentlichen die diversen Klassifikationsmerkmale für die Kanalisationsbeiträge im neuen Gewerbegebiet aufzählte. Da kam Paul, schelmisch braune Augen blitzten unter einem roten Wuschelkopf, eine Hand und ein Manuskript streckten sich ihm entgegen: der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Paul Wiesensee war noch Student damals und machte sich rasch unentbehrlich, ein freier Mitarbeiter, der auffiel mit seiner flotten Schreibe, sein Zeilenhonorar mehr als wert war und immer Zeit hatte, wenn Leonhard ihn bat, irgendeinen Termin wahrzunehmen, selbst wenn es ganz schnell gehen musste.
Sie waren in der Redaktion ein kleines Team und machten zusammen ein munteres Blatt, eine echte Crew, immer bereit, die konservative Konkurrenz zu ärgern und die Themen gegen den Strich zu bürsten. Berufliches und Persönliches gingen damals noch nicht so auseinander, wie es heute üblich ist und professionelle Distanz es zu Recht verlangt. Damals war für sie auch die Redaktion ein Zuhause, und zuhause war man nicht weniger beieinander als in der Redaktion.
So wuchs ihre Freundschaft ins Persönliche hinein und hielt, obwohl sich beruflich ihre Wege trennten. Bald waren sie enge Freunde. Beste Freunde. Intime Freunde. Ungewöhnliche Freunde auch, wie ihr Umfeld befand, weil sie in manchen Zeiten alles teilten. Selbst Geheimnisse. Selbst Frauen. Das mit den Frauen änderte sich später, als Paul Wiesensee seine große Liebe fand und mit ihr eine Familie gründete. Es war auch dann noch anders, als Pauls geliebte Frau schon nach wenigen Jahren starb und sie seine Trauer teilten. Aber es gab stets auch reichlich anderes, das sie miteinander teilen konnten.
Am Anfang waren es vielleicht gerade ihre Differenzen, die sie interessant machten füreinander und die sie anzogen gegenseitig. Leonhard, Bildungsbürger schon von Haus aus, zugleich aber kaum aus Süddeutschland herausgekommen und unterschwellig enger in sein familiäres Vermächtnis von Pietismus und Leistungsauftrag verhakt als ihm lieb war, Paul dagegen Arbeiterkind, der sich Bildung gegen Widerstand aus der eigenen Familie erst erkämpfen musste und sich mühsam genug aus seinem Milieu herausarbeitete in die Weite der Welt, in die Freiheit des Lebens, die es zu entdecken und auszukosten galt. Paul war es, der den noch ziemlich provinziellen Leonhard zu gemeinsamen Reisen nach Italien animierte und ihn entführte in mediterranes Licht und Leben. Das Arbeiterkind musste kommen, um dem Bürgerkind das Fliegen beizubringen, dem Nesthocker, der bis dahin vor allem in seinem Kopf auf Reisen war. Paul lehrte Leonhard, seine Arme auszubreiten und auszufliegen, etwas ängstlich zunächst, aber bald voller Lust und Begeisterung, über die Alpen und bald um die ganze Welt.
Seit diesen Reisen nach Italien sind sie italophil, wie fast alle Deutschen ihrer Generation. Seither reden sie sich bei Gelegenheit, also oft, freundschaftlich als Leonardo an und als Paolo, beschließen ihren meist nächtlichen E-Mail-Austausch mit il tuo amico Leonardo und il tuo amico Paolo, itaL und itaP abgekürzt. Ab und zu macht Paul aus seinem Freund Leonhard Ross auch einen Rosso, oder wegen seines ehemals ins Rötliche schimmernden, inzwischen grauweißen Bartes sogar einen Barbarossa. Dann kontert Leonhard mit einem leicht theatralischen, aber liebevollen Paolissimo.
Ihr Verhältnis ist keineswegs einfach, ja es konnte manchmal auch schwierig und kompliziert sein, setzte einmal sogar ganz aus über mehrere Jahre, und es war lange unklar, ob es je wieder einsetzen würde eines Tages. Vielleicht weil sie ihre Unterschiedlichkeiten immer nur genießen, von ihnen immer nur profitieren wollten und so manches ausgespart blieb, was sie sich hätten zumuten sollen. Vielleicht auch, weil in ihre Freundschaft unerfüllbare Erwartungen eingebaut waren, von denen sie selbst nichts wussten. Am Ende aber, mit der Hilfe einer alten Freundin, fanden sie wieder zueinander, wurden sich wieder gut, ja entdeckten sich neu, und verjüngten so ihre Verbundenheit, während sie selbst älter wurden und in die Jahre kamen.
*
„Hör mir doch erstmal zu“, sagt Paul. „Ich habe heute einen anonymen Brief bekommen, von einer Öko-Gruppe mit ziemlich vagen Hinweisen und Anschuldigungen, ganz schön wirr und diffus.“
„Um was geht´s denn?“, fragt Leonhard und fasst gleich journalistisch nach: „Vielleicht ist es ja eine Geschichte.“
„Ja, vielleicht. Aber es ist komisch, wer schreibt heute noch Briefe. Und dann lag der bei mir zuhause im Briefkasten, nicht etwa in der Redaktion. Die nennen sich ‚Ökologische Befreiungsaktion‘, abgekürzt ‚Öbefa‘, und sie schreiben von irgendwelchen illegalen Lieferungen, Schiebereien, falschen Papieren und so was.“
„Klingt wirklich wirr. Vielleicht sind es Spinner, vielleicht auch nicht. Anonyme Briefe sind übrigens heute mühsamer zu identifizieren als IP-Nummern und E-Mails. Der Name, was meinst du, ist der vielleicht Programm? ‚Öbefa‘ klingt ein wenig wie ‚Antifa‘, nur ökomäßig. Was hast du jetzt vor?“
Die Gruppe habe ihn um Hilfe gebeten, erzählt Paul. Das verwundere ihn einigermaßen, weil er mit Öko-Themen bislang kaum zu tun gehabt habe. In dem Brief stehe aber, und das sei ihm jetzt eher peinlich, dass die Gruppe ihn als kritischen, unabhängigen und mutigen Lokalredakteur anspreche, der offenbar in den lokalen Filz nicht so verstrickt sei wie die übrige Journaille. Und deshalb fordere man ihn auf, seinen journalistischen Pflichten nachzukommen und ihre Hinweise aufzugreifen und ans Tageslicht zu bringen. Wenn er helfe, das übliche Schweigekartell zu brechen, könne er auf ihren bisherigen Recherchen aufbauen und mit ihrer Unterstützung rechnen. Aus verständlichen Gründen müsse die Gruppe anonym bleiben. Die Macht dieser Verbrecher und ihrer Kartelle sei groß und ihr Arm sei lang. Aber wenn er bereit sei, den Skandal aufzudecken, werde er weitere Informationen erhalten. Das, sagt Paul, sei im Großen und Ganzen, was in dem Schreiben stehe. Sonst nichts Konkretes, nichts Handfestes.
„Und?“, neckt Leonhard, „gedenkst du deinem Image als wahrer Wahrer der Wahrheit gerecht zu werden?“
Paul lacht. Aber er gesteht auch, dass ihm die Komplimente schon schmeicheln, die in der Aufforderung der Gruppe stecken. Zugleich kommt ihm das Ganze ziemlich spanisch vor.
„Und vor allem“, sagt Paul, „ich weiß gar nicht, woher ich noch Zeit für irgendwelche aufwändige Recherchen nehmen soll, um der Sache nachzugehen. Die wollen doch offensichtlich, dass ich mich nicht in der Redaktion darum kümmere, jedenfalls nicht offiziell, sondern diskret nebenher, also nach Feierabend. Und wie es bei uns inzwischen jeden Tag zugeht, habe ich dir schon oft genug vorgejammert.“
Leonhard nickt. Er hat sich schon mehr als einmal anhören müssen, wie abgespannt sein Freund von einem redaktionellen Alltag ist, der sich seit Jahren immer stressiger und unerfreulicher gestaltet, weil kaum mehr Zeit bleibt, Themen in Ruhe zu recherchieren, sorgfältig zu schreiben und hochwertig zu gestalten, sondern journalistisches Fast Food geliefert werden muss, schnell, schnell, möglichst mehrfach multimedial und crossmedial verwertbar, im Blatt, auf den Online-Kanälen, in den Apps und im lokalen TV. Jetzt wird ihm klar, was es auf sich hat mit dem Attentat.
„Meinst du vielleicht, ich könnte dir bei dieser Geschichte helfen, wir könnten zusammen … du willst mich gewissermaßen hinzuziehen oder vielmehr hineinziehen in diese Sache?“
„Du hast es erfasst“, sagt Paul.
Äußerlich ziert sich Leonhard noch: „Dazu brauchst du mich doch nicht, das schaffst du doch gut alleine.“
Aber innerlich freut er sich bereits über die Idee seines Freundes und lässt sich gern und schnell überreden, verspricht eine gemeinsame Recherche doch neue Erlebnisse und vor allem die Gelegenheit, sich wieder öfter zu treffen. Ein gefundener Anlass, um sich sofort zu einem gemeinsamen Wochenende zu verabreden, das ohnehin längst überfällig war. Schon am nächsten Samstag kommen sie sich, so ist es Tradition bei ihnen, auf halbem Wege entgegen, im thüringischen Gotha diesmal, das sie gemeinsam schon vor der Wiedervereinigung besucht haben, damals noch als DDR-Touristen.
*
Natürlich kommt Leonhard von Nordosten her in seinem edlen, mattbraunen Jaguar schneller an als Paul, der in seinem betagten und ziemlich angerosteten VW-Käfer aus dem Südwesten anrollt. Deshalb wartet er auf ihn, hat die Formalitäten schon erledigt in dem ruhigen Hotel, das unmittelbar am Schlosspark liegt und zugleich ganz in der Nähe des alten Gothaer Stadtkerns. Sein Zimmer ist komfortabel und freundlich. Er fühlt sich wohl, blickt hinüber zum ehemals herzoglichen Schloss, die dunkle Tönung seiner Brille färbt es leicht ein, als stünde es im Schatten. Er ist beeindruckt von dessen barocker Wucht und davon, dass hier erleuchtete und erlauchte Häupter wie Goethe und Voltaire, Friedrich der Große und Napoleon verkehrten. Aber das Historische würde ihm Paul bald viel genauer erzählen. Er schaut hinunter auf die Parkallee, als er seinen Freund entdeckt.
Wie immer kommt Paul, eine alte Reisetasche über der Schulter, ein wenig geistesabwesend daher, als müsse er gar nicht auf den Weg achten, als fänden seine Füße von selbst über den Bordstein. Seine leuchtend karottenroten Locken kräuseln chaotisch über dem sommersprossigen und wie immer freundlich offenen Gesicht, kontrastieren das dunkle Blau des altbackenen, aber unvermeidlichen Dufflecoat, ohne den Paul nicht auszukommen scheint und mit dem er sich seit Urzeiten über jede Modewelle und allen Zeitgeist erhebt. Aber gerade das mag Leonhard an seinem Freund, oder besser auch gerade das. Er muss lächeln, als er ihn so ankommen sieht und eilt hinunter in den Empfang, um ihn in den Arm zu nehmen.
Wie immer, wenn sie sich treffen, lassen sie es sich gut gehen rund herum, erkunden die Stadt, schwadronieren, diskutieren über Gott und die Welt. Hier in Gotha pilgern sie am Haus für Versicherungsgeschichte vorbei hinüber zum Tivoli, wo sich 1875 im Kaltwasserschen Saal die Lasalleaner und die Eisenacher zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschland (SADP) vereinigt haben, der späteren SPD.
„Meinst du, es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen der Versicherungsgeschichte und der Geschichte der SPD?“, fragt Leonhard seinen Freund etwas hinterlistig. Er neckt ihn gern auf diese Weise, weil er weiß, für wen Paul trotz aller Unabhängigkeit gewisse Sympathien hegt, Rudimente seiner Lebenserfahrungen als Arbeiterkind.
„Da könntest du dir ausnahmsweise einen Rechthaberpunkt verdient haben“, entgegnet Paul, um sich jetzt nicht auf irgendeine Debatte über die Rolle der Sozialdemokratie in der deutschen Geschichte einlassen zu müssen.
Zurück am historischen Hauptmarkt bewundern sie die üppig verzierten Fassaden der gut erhaltenen Kauf- und Patrizierhäuser und lesen irgendwo von berühmten Männern wie Martin Luther und Lucas Cranach, die hier wohnten.
„Nicht nur wir, die waren also auch schon hier“, kommentiert Leonhard in einem Anfall leichter Selbstironie, die ihm sonst eher abgeht.
Vor allem das alte Rathaus mit seinem prächtigen Portal beeindruckt beide mächtig. Paul stupst Leonhard an, deutet auf eine Kopfskulptur mit beweglichem Unterkiefer und setzt zu einem seiner kleinen historischen Exkursionen an.
„Das hier hat jedenfalls mit Sozialgeschichte zu tun, reicht aber viel länger zurück als zu den Versicherungen der Sozialdemokratie. Das nämlich soll dem Volksglauben nach der Ritter Wilhelm von Grumbach sein, ein Schwager des tapferen Bauernführers Florian Geyer, was ihn aber nicht gehindert hat, kräftig dabei mitzuhelfen, um dem Mann seiner Schwester samt den aufmüpfigen Bauern den Garaus zu machen“, klärt Paul seinen Freund auf.
„Was du wieder alles weißt, Paolo.“
„Hab mich ein bisschen kundig gemacht“, fährt Paul fort. „Der Ritter Grumbach muss ein ziemlicher Schluri und Wendehals gewesen sein. Am Ende war er hier in Gotha als Günstling und Berater des Herzogs zugange, aber das hat ihm am Schluss nicht mehr geholfen. Er hat offenbar zu oft die Seiten gewechselt.“ Paul deutet auf eine Markierung im Pflaster vor dem Rathaus. „Hier soll man zuerst sein ‚falsches‘ Herz aus der Brust gerissen und ihn dann gevierteilt haben, sagt man. So brutal ging man damals um mit Verrätern oder Leuten, die zwischen die Fronten geraten sind. Und das konnte ganz schnell gehen.“
Die Freunde schaudert es. Sie reden darüber, wie schnell man zwischen den Stühlen sitzt, sobald man eigenen Wegen folgt. Vor allem in sogenannten verschworenen Gemeinschaften. Und wie schnell einen die eigenen Leute des Verrats bezichtigen und zum vogelfreien Feind erklären, sobald man irgendwem nicht mehr als lammfromm und linientreu gilt. Ein dunkelgrauer Schatten legt sich über den Platz und seine Kälte überzieht ihre Arme mit Gänsehaut. Die scheinbar selbstverständliche Sicherheit ihrer Gegenwart und das wohltuende Gefühl, in einem Land und in einer Zeit zu leben, in der mittelalterliche Grausamkeiten längst der Vergangenheit angehören, es ist eine löchrige Geborgenheit. Sie ist ihnen geschenkt in diesem Land, ihnen und ihrer ganzen Generation. Für einen Moment beschleicht sie eine Ahnung der dunklen Kräfte der Menschheit, wie sie immer und immer wieder eindringen in Gegenwart, weiter wabern, nah und fern, sichtbar und unsichtbar, subtil oder brutal.
Jetzt freilich, hier auf dem Marktplatz, ist es friedlich und, seit die Geschäfte geschlossen haben, fast still. Am Ende sind sie froh, sich dem herrlichen Rathaus gegenüber zum Speisen niederlassen zu können, hier und jetzt, im Gotha von heute.
Auch damals, als sie in Gotha Station machten, DDR-Touristen auf dem Weg nach Dresden, waren sie ganz friedlich auf der Suche nach Essbarem unterwegs und hatten einen Imbiss gefunden, wo sie sich im Straßenverkauf einen Broiler erstanden. Jetzt, eigentlich ist es immer noch unfassbar, sitzen sie an gleicher Stelle genüsslich beim Italiener und schlürfen Espresso nach dem Essen. So schnell kann Geschichte gehen, so kann sie ausgehen, wenn es gut geht, ob hierzulande oder in der Ukraine.
„So gut ging es uns seinerzeit nicht, als wir hier verhaftet wurden.“ Paul hängt seinen Erinnerungen nach.
„Ihr habt es überlebt“, wirft Leonhard in der sicheren Erwartung ein, Paul werde einmal mehr seine Geschichte aus dem Sommer 1976 zum Besten zu geben, als er mit zwei Kommilitoninnen auf der Transitstrecke vom Grenzübergang Herleshausen nach Berlin entgegen aller realsozialistischen Vorschriften von der Autobahn heruntergefahren war, um über Gotha, Eisenach und Weimar in die geteilte Stadt zu gelangen.
Natürlich tut ihm Paul den Gefallen. „Wir haben halt unterschätzt, dass so ein dunkelroter R4 unter den Trabis schon auffällt, auch der Volkspolizei.“
Zwei Stunden, einen gefühlten halben Tag, hatte ihn ein gestrenger Uniformierter auf dem Polizeipräsidium ausgequetscht, während Pauls Mitfahrerinnen draußen auf dem furchteinflößend kahlen Flur Blut und Wasser schwitzten. Erst zwei Tage vorher hatten DDR-Grenzsoldaten am Übergang Hirschberg den Lkw-Fahrer Benito Corghi erschossen.
Leonhard kennt Pauls Gothaer Heldengeschichte in- und auswendig. Auch den Umstand, dass die DDR-Grenzer mit Benito Corghi ausgerechnet einen Genossen der Kommunistischen Partei Italiens über den Haufen schossen, ein tödliches Missverständnis, das für reichlich Wirbel in den italienischen Parteizeitungen und im römischen Parlament sorgte. Ja, damals sei ein Besuch in der östlichen deutschen Hälfte noch ein Abenteuer gewesen, resümiert Paul, wie es in der heute so gemütlich wiedervereinigten Republik kaum mehr möglich sei.
„Ist das nicht ein bisschen zynisch?“, fragt Leonhard und in seinen Tonfall schleicht sich eine leichte Schärfe. „Heute wäre dir dein gemütliches Zuhause jedenfalls lieber als eine DDR-Zelle. Und für die Leute, die damals wirklich in die Zellen gesperrt wurden, in Bautzen oder sonst wo, war das ganz sicher kein Abenteuer.“
„So habe ich es doch gar nicht gemeint, das weißt du auch. Ich spendiere dir noch einen Rechthaberpunkt“, besänftigt Paul.
„Was kann ich eigentlich machen mit meinen Rechthaberpunkten?“
„Was immer du willst.“
„Toll“, lacht Leonhard.
Sie bestellen sich noch einen Nachtisch, einen zweiten Espresso und genießen die Abendsonne, spüren die sanfte Wärme, wie sie sich mild legt auf ihre Stirn und ihre Wangen.
„Sag mal“, erkundigt sich Leonhard und kommt zum ersten Mal auf den eigentlichen Anlass ihres Treffens zu sprechen, „hat sich diese komische Öko-Truppe noch einmal bei dir gemeldet? Oder hat sich das erledigt und wir können uns den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zuwenden und zum Beispiel einen Grappa bestellen?“
„Beides“, sagt Paul. „Du kannst für uns einen Grappa ordern. Und nochmal gemeldet haben die sich auch. Gestern Abend.“
Paul berichtet, dass er spät abends zuhause noch einen Anruf erhalten hat. Ein Mann sei dran gewesen, der von ihm wissen wollte, ob er das Schreiben gelesen habe und ob er einsteige. Paul habe ihm gesagt, er wisse das noch nicht und es seien schon noch konkretere Hinweise nötig, um zu sehen, ob das für ihn interessant sei. Der Mann habe daraufhin erzählt, dass er als Student während der Semesterferien als Lagerarbeiter in einer Internationalen Spedition gejobbt habe, die alle möglichen Lebensmittel quer durch ganz Europa transportiere, Geflügel oft, aber auch Fleisch, Fisch, alles Mögliche eben. Ihm sei aufgefallen, dass es da immer wieder Transporte gegeben habe, die ihm komisch vorgekommen seien, weil manchmal gar nichts ein- und ausgeladen worden sei und er den Eindruck gewonnen habe, dass irgendetwas mit den Papieren nicht stimme. Er sei zugleich in einer Umweltschutzgruppe aktiv, Paul kenne vielleicht Robin Wood, allerdings seien sie, die Öbefa, eben doch noch etwas konsequenter und beschränkten sich nicht nur auf symbolische Aktionen wie solche Ökopaxe und ihre gemeinnützigen Organisationen. In dieser Spedition seien jedenfalls ganz sicher erhebliche Schweinereien im Gange, die ans Tageslicht müssten. Wenn Paul ihnen helfe, könne er umgekehrt mit weiteren brisanten Insiderinformationen rechnen.
Paul unterbricht sich kurz, rührt nachdenklich imaginären Zucker in seiner leeren Espressotasse um. Und Leonhard nutzt die Pause ausnahmsweise nicht, um ihm ins Wort zu fallen. Er habe den Mann hingehalten, erzählt Paul weiter. Er habe ihm gesagt, er brauche zwei Tage Bedenkzeit. Und, Anonymität hin oder her, ohne einen persönlichen Ansprechpartner werde er in die Geschichte auf keinen Fall einsteigen. Das sei okay, habe der Mann gesagt, man habe das vermutet und bereits eine Mittelsperson ausgeguckt, an die sich Paul wenden könne und die weitere Informationen liefern werde, eine Sympathisantin namens Charlotte, die er vielleicht sogar kenne, weil sie in der Ökoszene der Stadt ja ziemlich engagiert sei und er ihr sicher vertrauen könne.
„Tatsächlich kenne ich diese Charlotte“, sagt Paul und richtet sich auf. „Sie ist bei den Grünen aktiv und mir bei Aktionen und Demos schon ein paar Mal aufgefallen. Ich finde sie eigentlich sogar ziemlich nett. Was meinst du, soll ich mich darauf einlassen?“
Leonhard wiegt den Kopf. „Klingt jetzt immerhin ein wenig handfester, das Ganze.“
Sie kehren zum Hotel zurück und richten sich an der Bar auf einen nächtlichen Umtrunk ein, dessen Verlauf ungefähr so absehbar ist wie der Wechsel von Ebbe und Flut.
„Klar, die Ökos sind schon ein bunter Haufen. Da gibt es nichts, was es nicht gibt“, fasst Leonhard zu fortgeschrittener Stunde, vom Rotwein bereits in einen Zustand klarster Erkenntnisfähigkeit und Hellsicht versetzt, als Fazit ihrer Analyse der Ökoszene zusammen. „Da tummeln sich natürlich etliche notorische Besserwisser und nervige Klugscheißer, auch ziemlich abseitige Typen, moralinsaure Wirrköpfe, abgesackte Aussteiger, fundamentalistische Eiferer, abgedrehte Spinner und durchgeknallte Psychos, die eher sich selber retten müssten als die ganze Welt. Aber die meisten sind wirklich engagierte Naturmenschen oder harmlose Freaks, oder ernsthafte Christen, denen es um Gottes Schöpfung geht, oder kritische Intellektuelle und sensibilisierte Bildungsbürger, die sehen, dass wir unsere eigene Lebensgrundlage auf Dauer kaputt machen, bürgerbewegte Leute, Gutmenschen, wenn du so willst, die nach Alternativen zum Scheitern der Menschheit suchen. Das belächelt man heute gern, weil es nicht so cool zu sein scheint, nicht so angesagt, und weil es nicht einfach mit ein paar locker ironischen oder zynisch witzigen Sprüchen erledigt werden kann. Aber das sind immerhin Leute, die gegen das angeblich unvermeidliche Ende der Zivilisation wenigstens ankämpfen.“
Leonhard hat sich heißgeredet.
„Ich dachte auch lange, die übertreiben doch mit ihren ewig depressiven Endzeit-Szenarien, denke immer noch, dass wir die Apokalypse und den Weltuntergang noch locker aussitzen. Aber nimm die NASA. Die NASA ist ja nicht unbedingt verdächtig, ökologische Propaganda zu verbreiten. Aber die haben eben aus dem Weltraum heraus so etwas wie den Außenblick auf die Erde, auf unseren kleinen blauen Planeten. Und die haben gerade prognostiziert, dass die Menschheit untergeht, wenn sie so weitermacht wie bisher. Das sagt jedenfalls eine neue NASA-Studie, verfasst von einem Mathematiker, einer Biologin, wenn ich es noch recht weiß, und einem Politikwissenschaftler. Die haben errechnet, dass es mit uns auf Dauer nicht gut geht bei allem, was man heute weiß über Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Wasserversorgung, Landwirtschaft, Energieverbrauch und …“
Leonhard will gerade so richtig einsteigen in eine ausufernde Situationsanalyse der Menschheitsentwicklung, als Paul ihn unterbricht.
„Trinken wir noch einen?“
Leonhard zieht die Augenbrauen hoch. „Was für eine Frage?“
„Meinst du, wir sollten vielleicht noch das Lokal wechseln?“
„Du meinst, weniger global denken, lieber lokal handeln? Ich fürchte, wir finden hier nichts mehr anderes.“
„Okay, wir bleiben.“
Irgendwann, sie sind vom Rotwein schon längst zum Grappa übergegangen, haben sich alles erzählt, was sie sich unbedingt noch erzählen müssen, was sie dringend noch voneinander wissen müssen, was ihnen noch am Herzen liegt und was sie noch bedrückt, irgendwann spät in der Nacht, als sie die Welt in ihren Gedanken, Worten und Diskussionen mindestens dreimal gerettet, sämtliche Probleme besprochen und gelöst, die Geduld des freundlichen Barkeepers längst überstrapaziert und ihn dann nach einer allerletzten Bestellung großmütig entlassen haben, irgendwann, bevor sie endlich zu ihren Zimmern wanken, versucht Leonardo seinem Freund Paolo zu erklären, dass die prinzipiell ökologischen Grenzen des Kapitalismus mit der Marxschen Warenanalyse und der Dialektik von Gebrauchs- und Tauschwert erklärbar sind. Und dass er darüber noch, irgendwann, ein Buch schreiben werde, auch wenn die Welt darauf nicht warte.
„Du bist immer noch ein unverbesserlicher Marxist“, stänkert Paul im Treppenhaus, als sie mühsam die Stufen nehmen, weil sich der Fahrstuhl merkwürdigerweise nicht öffnen lässt, und sie sich dabei gegenseitig stützen.
„Mit seiner sozioökonomischen Warenanalyse liegt der gute alte Karl einfach grundlegend richtig“, beharrt Leonhard störrisch. „Er hat das Problem in der Dialektik von abstraktem Tauschwert und konkretem Gebrauchswert begriffen. Und begrifflich auf den Punkt gebracht, verstehst du?“
Leonhard stupst seinen Freund in die Seite, sie geraten fast aus dem Gleichgewicht, fangen sich jedoch mit einem beherzten Griff zum Geländer. Derart gefestigt holt Leonhard mit großer Geste weiter aus. „Es ist doch so, ab einer bestimmten Stufe der gesellschaftlichen Arbeitsteilung machten und hatten die Menschen Sachen über ihren eigenen Bedarf hinaus. Sachen, die sie für sich selbst gar nicht brauchten. Umgekehrt brauchten sie Sachen, die sie selbst nicht hatten. Also fingen sie an, gegenseitig zu tauschen, aus diesen Sachen wurden Waren, es entstand ein Markt. Dabei mussten sie aber von den konkreten Eigenschaften dieser Sachen abstrahieren. Wie könntest du sonst zum Beispiel Fell, Handbeil, Trockenfrucht, Federschmuck, Salz und Bisonhaut auf einen Nenner bringen? Verstehst du? Das heißt, im Austausch von Waren vollzieht sich eine Abstraktionsleistung, die sich löst von der konkreten Sache und auf ihren gemeinsamen Wert abhebt. Tausch macht überhaupt nur Sinn zwischen Verschiedenartigem, aber Gleichwertigem.“
Paul will kurz dazwischenfunken: „Schon, nur …“
„Vielleicht liegt darin sogar das eigentliche Problem“, fährt Leonhard unbeirrt fort und deutet mit seinem rechten Zeigefinger zu einem Punkt in imaginärer Höhe, irgendwo zwischen Notbeleuchtung und Treppengeländer. „Abstraktes lässt sich nämlich im Gegensatz zu Konkretem unbegrenzt akkumulieren, und das ist der Anfang der Abkehr der Menschheit von ihren konkreten natürlichen Lebensgrundlagen. Das geht also noch eine Ebene tiefer als der gute alte Marx es sich gedacht hat. Hinein ins Anthropologische. Vielleicht ist also schon mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, des damit erforderlichen Austauschs von Warenwerten und der sich so anbahnenden Abstraktionsfähigkeit des Menschen seine Entfernung von der Natur programmiert und man müsste die Marxsche Analyse als theoretische Grundlage der roten Bewegungen ergänzen durch eine noch tiefer ansetzende anthropologische Analyse als Grundlage der grünen …“
Leonhard stockt, denkt angestrengt nach, vielleicht geht das jetzt doch zu weit? Ihm raucht der Kopf und er wendet sich Hilfe suchend seinem Freund zu: „Jedenfalls ist die Loslösung von jedwedem konkreten Gebrauchswert im gesellschaftlichen Austausch der Arbeitsergebnisse, ob lokal auf dem Gemüsemarkt oder global auf den digitalisierten Finanzmärkten, die tiefere Ursache der prinzipiellen Möglichkeit, materiellen Wert auf immaterielle Weise anzuhäufen. Bis ins Unendliche. Das ist ganz sicher so. Verstehst du?“
„Um ehrlich zu sein, ist mir das jetzt viel zu abstrakt“, brummelt Paul vor sich hin, als er endlich für einen Moment zu Wort kommt.
Aber nun steigert sich Leonhard in eine Art rauschhafte Wiederholungsschleife hinein. „Paolo, das ist doch klar. Von Geldwert kann man nie genug bekommen. Da gibt es nicht einmal mehr mathematische Grenzen.“ Leonhard dreht Paul auf einer Treppenstufe zu sich, um sicher zu sein, dass er ihm noch zuhört, und setzt seinen Vortrag fort. „Im Gegensatz dazu ist eine unendliche Anhäufung von Materie unmöglich. Das geht nicht mit konkreten Sachen, nicht einmal wenn du Gold oder Seltene Erden stapelst. Es geht aber mit der reinen Wertabstraktion. Die kannst du unendlich steigern, ins Unermessliche.“
Leonhard hält inne, um diesen gedanklichen Höhenflug trotz seines wolkigen Zustands zu stabilisieren. „Die prinzipiell unendliche Akkumulation von Kapital steht also im prinzipiellen Widerspruch zur Endlichkeit der Natur, jedenfalls auf unserer Erde. Und das führt letztlich zur Ablösung des abstrakten Finanzkapitals von der konkreten Realwirtschaft, die wir gerade mit der Weltfinanzkrise erlebt haben“, doziert Leonhard in seinem alkoholisch stimulierten Anfall von Klarsicht und Einfalt. „Es ist eigentlich ganz einfach. Die Natur und das, was der Mensch mit seiner Arbeit daraus macht, gleich Gebrauchswert, gleich konkret. Und das Finanzkapital, gleich Tauschwert, gleich abstrakt. Verstehst du mich? Wenn man das erkennt, muss man nicht gleich ein ideologisch bornierter Marxist sein.“
Endlich wieder etwas zu Kräften gekommen, gelingt es Paul, Leonhards Monolog zu stoppen. „Das ist mir jetzt zu abgedreht. Da halte ich es lieber mit Büchner. Die Welt ist das Chaos. Nichts ist berechenbar. Oder hättest du dir vor einem Jahr ausdenken können, dass die Krim über Nacht wieder russisch wird?“
„Nein. Aber es wundert mich auch nicht.“
„Mich auch nicht. Da hat sich seit Langem etwas zusammengebraut, ohne dass wir es gemerkt haben. Und Putin vollstreckt anscheinend Volkes Wille. Vielleicht aber auch völkischen Willen. Uns Westlern wird nicht viel anderes übrig bleiben, als zuzuschauen und zu protestieren“, sagt Paul und wirkt plötzlich so klar im Kopf wie morgens beim Zeitung lesen. „Oder willst du deshalb einen Krieg?“
In Leonhards Kopf beamt sich der Intellekt von den abstrakten Sphären der Marxschen Warenanalyse durch Myriaden alkoholischer Nebelschwaden hinunter in die Ebenen des politischen Zeitgeschehens. „Das ist doch eine rhetorische Frage. Nüchtern betrachtet …“
Er bricht ab, prustet, schüttelt sich und setzt ein zweites Mal an. „Also nüchtern geht gerade gar nicht. Immerhin weiß ich noch so viel: Wir Europäer machen leider chronisch viel falsch im Umgang mit Russland. Aber Putin hat ein Nachkriegs-Tabu gebrochen, er will das europäische Haus mit Gewalt umbauen. Das ist ein böser Rückfall ins letzte Jahrhundert. Wenn wir damit wieder anfangen, endet es schlimm, mit Mord und Totschlag. Und genau das erleben wir jetzt.“
„Hunnert pro“, stimmt Paul seinem Freund in dem von den Südhessen adaptierten Idiom zu. Endlich haben sie es bis zu ihrer Etage geschafft und zugleich die höchste Stufe ihrer vereinten Erkenntnisfähigkeit erklommen. Eine Leistung in ihrem Zustand. Solche Diskussionen hingegen führen die beiden Freunde selbst nach einer oder zwei Flaschen Grappa noch mühelos.
Nicht immer geht ihr Meinungsaustausch so sanftmütig und friedfertig über die Bühne wie an diesem Abend. Vor allem in früheren Jahren konnten sie, obwohl in der Sache kaum einen Millimeter voneinander entfernt, ganz heftig aneinandergeraten. „Wortfuchser“ warfen sie sich dann gegenseitig an den Kopf. So schalt Leonhard Paul, wenn der sich in interpretatorischen Winkelzügen oder etymologischen Bedeutungserklärungen verfing, um seine Position zu untermauern und selbst vor Zitaten von Konfuzius nicht zurückscheute, um die Unwiderlegbarkeit seiner Meinung zu beweisen. Umgekehrt musste es sich Leonhard oft gefallen lassen, als kalter Rationalist und grauer Theoretiker beschimpft zu werden, der am wirklichen Leben völlig vorbei argumentiere. Schlimm uferte es aus, wenn sie darüber stritten, wer von beiden der größere Schwätzer und Wortfuchser sei. Dann konnten sich ihre rhetorischen Florette in schwere Säbel verwandeln und verbale Raufereien in unnötige Verletzungen ausarten.
Aber sie hatte sich gelegt in den letzten Jahren, diese Art von Schattenboxen und Scheingefecht, auch weil sie sich irgendwann die Sache mit den Rechthaberpunkten einfielen ließen. Und strittige Entscheidungen führen sie inzwischen in beginnender Alterskindlichkeitsweisheit herbei, indem sie einfach Schnick-Schnack-Schnuck walten lassen, Papier hüllt Stein, Schere schneidet Papier, Stein schleift Schere. Meistens gewinnt Paul, weil Leonhard dabei zu viel denkt.
„Buona notte, Paolo.“
„Buona notte, Leonardo. A domani.”
Schon im Bett, aber immer noch leicht aufgekratzt, ruft Leonhard seine Karla an. Das muss noch sein. Es klingelt lang. Irgendwann hört er ein leises, müdes „Ja.“
„Hast du schon geschlafen, Liebste, wollte dich nur noch schnell küssen.“
„Ich schlafe schon und immer noch. Und du erscheinst mir gerade im Traum. Gute Nacht, schlaf du auch schön.“ Sie legt auf.
„Gut’s Nächtle“, sagt Leonhard noch. Aber Karla hört ihn nicht mehr.
Am nächsten Morgen, genauer am späteren Vormittag, erwartet sie ein ausgiebiges Frühstück, mit reichlich Kaffee, klarem Mineralwasser und frisch gepresstem Orangensaft. Paul erzählt von seiner unruhigen Nacht. Ein paar Mal sei er aufgewacht mit einem seltsam unheilschwangeren Gefühl. Irgendwie habe ihn der Ritter Grumbach im Schlaf aufgesucht und ihn gezwungen, mitzumachen bei seinen Machenschaften. Und dann habe man sie beide als Verräter verfolgt, um sie zu aufzuhängen. Es sei ein richtiger Albtraum gewesen.
„Es fühlte sich an wie ein Menetekel, wie eine Prophezeiung.“ Paul schüttelt sich, als könne er seine nächtlichen Ahnungen einfach wegschleudern.
„Das kommt davon, wenn man mehr in der Vergangenheit lebt als in der Gegenwart“, befindet Leonhard scheinbar ohne jedes Mitleid und beträufelt seinen Lachs mit frischer Zitrone. Aber dann tröstet er seinen Freund: „Mach dir keine Gedanken. Das war doch bloß ein Tagesrest von unserem Stadtrundgang gestern.“
Wieder in leidlich nüchternem Zustand verabreden beide, die Hinweise der Ökogruppe erst einmal ernst zu nehmen und ihnen gemeinsam, aber arbeitsteilig nachzugehen: Leonhard mit Recherchen im Internet und über seine alten beruflichen Verbindungen, Paul im Kontakt zu der selbst ernannten Ökologischen Befreiungsaktion und vor allem zu der ihm bekannten, offenbar hübschen und sympathischen grünen Aktivistin.
*
Bereits am nächsten Abend, Leonhard ist wieder zuhause und putzt die Voliere seiner Mitbewohner, meldet sich ein ziemlich aufgeregter Paul. Er hat sich schon mit ihr getroffen, mit dieser Charlotte. Das sei wirklich eine eindrucksvolle Frau. Es werde nicht sehr schwer für ihn sein herauszufinden, was mit den anonymen Hinweisgebern los sei. Und es werde ihm auch keineswegs schwerfallen, diesen Kontakt zu pflegen.
„Das lässt sich ja gut an“, belobigt Leonhard diesen unerwarteten Feuereifer, dessen Grund so offensichtlich Charlotte heißt. Es überrascht ihn, vor allem aber freut es ihn, dass Paul nach so vielen Jahren, nach all seiner Trauer und Abstinenz, wieder offen ist, offen für die Begegnung mit einer Frau.