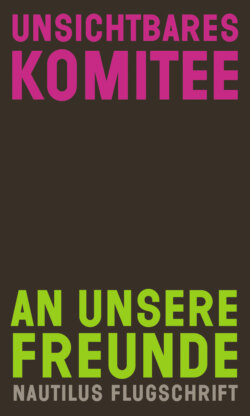Читать книгу An unsere Freunde - Unsichtbares Komitee - Страница 11
Merry crisis and happy new fear
Оглавление1. Dass die Krise eine Regierungsform ist
2. Dass die wahre Katastrophe existenziell und metaphysisch ist
3. Dass die Apokalypse enttäuscht
1. Wir Revolutionäre sind die großen Betrogenen der modernen Geschichte. Und in der einen oder anderen Form ist man immer mitverantwortlich für das eigene Betrogenwerden. Die Tatsache schmerzt und wird daher in der Regel verleugnet. Wir haben ein blindes Vertrauen in die Krise gehegt, ein so altes und blindes Vertrauen, dass wir nicht gesehen haben, wie die neoliberale Ordnung sie zum Herzstück ihres Arsenals machte. Marx schrieb nach 1848: »Eine neue Revolution ist nur möglich im Gefolge einer neuen Krise. Sie ist aber auch ebenso sicher wie diese.« Tatsächlich verbrachte er den Rest seines Lebens damit, bei den kleinsten Zuckungen der Weltwirtschaft die große, finale Krise des Kapitals vorherzusagen, auf die er vergeblich warten sollte. Noch immer wollen uns Marxisten die gegenwärtige Krise als »The Big One« verkaufen, damit wir weiter auf ihre seltsame Art von Jüngstem Gericht warten.
»Willst du eine Veränderung bewirken, dann löse eine Krise aus«, empfahl Milton Friedman seinen Chicago Boys. Das Kapital fürchtet Krisen nicht, ganz im Gegenteil. Es produziert sie inzwischen versuchsweise. So wie man eine Lawine auslöst, um sich die Wahl des Zeitpunkts und die Kontrolle über ihre Ausbreitung vorzubehalten. Wie man Steppen abbrennt, um sicherzustellen, dass die drohende Feuersbrunst mangels Brennstoff hier erlischt. »Wo und wann« sind Fragen der Zweckmäßigkeit und der taktischen Notwendigkeit. Bekanntlich ließ es sich der frisch ernannte Direktor des griechischen Amts für Statistik, Elstat, im Jahr 2010 nicht nehmen, die Schuldenbilanz des Landes nach oben zu fälschen, um ein Eingreifen der Troika zu rechtfertigen. Fakt ist also, dass die »Staatsschuldenkrise« von einem Mann lanciert wurde, der zu diesem Zeitpunkt noch offiziell im Sold des IWF stand, jener Institution, die den Ländern beim Ausweg aus den Schulden »helfen« sollte. Es ging darum, im 1:1-Maßstab in einem europäischen Land den neoliberalen Plan der kompletten Umgestaltung einer Gesellschaft und die Folgen einer guten »Strukturanpassungspolitik« zu testen.
Die Krise war, mitsamt ihrer medizinischen Konnotation, während der gesamten Moderne jener natürliche Zustand, der unerwartet oder zyklisch eintrat und eine Entscheidung erforderlich machte – eine Entscheidung, die der allgemeinen Verunsicherung über die kritische Lage ein Ende setzen würde. Die Sache ging gut aus oder auch nicht, je nachdem, wie angemessen die angewandte Medikation war. Der kritische Moment war auch der Moment der Kritik – das kurze Intervall, in dem die Diskussion über die Symptome und die Medikation eröffnet war. Davon ist heute nichts mehr geblieben. Das Mittel hat nicht mehr den Zweck, die Krise zu beenden. Die Krise wird im Gegenteil ausgelöst, um das Mittel einzusetzen. Fortan spricht man von »Krise« in Bezug auf das, was man umzustrukturieren gedenkt, so wie man diejenigen als »Terroristen« bezeichnet, gegen die man einen Schlag vorbereitet. Mit der »Krise der Vorstädte« wurde in Frankreich 2005 die direkt vom Innenministerium orchestrierte größte städtebauliche Offensive der letzten dreißig Jahre gegen ebendiese »Vorstädte« angekündigt.
Der Krisendiskurs der Neoliberalen ist ein doppelter Diskurs – unter sich sprechen sie lieber von »doppelter Wahrheit«: Einerseits ist die Krise das belebende Moment schöpferischer Zerstörung, sie schafft Möglichkeiten, Innovation, Unternehmer, von denen nur die besten, motiviertesten, wettbewerbsfähigsten überleben werden. »Im Grunde ist vielleicht das die Botschaft des Kapitalismus: Nur durch die schöpferische Zerstörung, die Abstoßung überholter Technologien und alter Produktionsweisen zugunsten von neuen lässt sich der Lebensstandard heben […]. Der Kapitalismus löst in jedem von uns einen Konflikt aus. Wir sind nacheinander aggressiver Unternehmer und Stubenhocker, der in seinem Innersten eine weniger wettbewerbsorientierte und stressige Wirtschaft bevorzugt, in der alle dasselbe verdienen würden«, schreibt Alan Greenspan, von 1987 bis 2006 Vorsitzender der US-amerikanischen Notenbank. Andererseits interveniert der Krisendiskurs als politische Methode der Verwaltung der Bevölkerung. Nur durch die permanente Umstrukturierung von allem – ob Organigramme oder Sozialhilfe, Unternehmen oder Stadtteile – lässt sich durch ständige Umwälzung der Existenzbedingungen die Inexistenz der gegnerischen Seite organisieren. Die Rhetorik der Veränderung dient dazu, jede Gewohnheit zu zerstören, jede Bindung zu lösen, jede Sicherheit zu erschüttern, jede Solidarität zu vereiteln, eine chronische existenzielle Unsicherheit wachzuhalten. Sie entspricht einer Strategie, die wie folgt beschrieben werden kann: »Durch die permanente Krise jede tatsächliche Krise verhindern.« Auf den Alltag übertragen, ähnelt dies der bekannten Praxis der Aufstandsbekämpfung durch »Stabilisierung mittels Destabilisierung«, in der die Macht absichtlich Chaos provoziert, damit die Ordnung wünschenswerter erscheint als die Revolution. Ob im Mikromanagement oder in der Verwaltung ganzer Länder, die Bevölkerung wird in einer Art von permanentem Schockzustand gehalten, der sprachlos macht und Verlassenheitsgefühle weckt, woraufhin man mit jedem Einzelnen nahezu alles machen kann, was man will. Die Massendepression, die die Griechen gegenwärtig befallen hat, ist das gewollte Ergebnis der Politik der Troika und nicht ihre Begleiterscheinung.
Weil er nicht verstanden hat, dass die »Krise« kein wirtschaftliches Phänomen ist, sondern eine politische Regierungstechnik, hat sich schon so mancher damit lächerlich gemacht, die Explosion des Subprime-Betrugs eilfertig als »Tod des Neoliberalismus« zu bezeichnen. Was wir erleben, ist nicht eine Krise des Kapitalismus, sondern im Gegenteil der Triumph des Kapitalismus der Krise. »Die Krise« bedeutet, dass die Regierung wächst. Sie ist zur Ultima Ratio dessen geworden, was regiert. Die Modernität beurteilte alles nach dem Maßstab der Rückständigkeit, der sie uns angeblich entreißen würde; fortan wird alles nach dem Maßstab seines nahenden Zusammenbruchs bemessen. Wenn die Gehälter der griechischen Beamten halbiert werden, dann mit dem Argument, man könne sie ja auch ganz streichen. Jede Anhebung der Beitragsjahre der französischen Arbeitskräfte erfolgt unter dem Vorwand, das »Rentensystem zu retten«. Die permanente, allseitige gegenwärtige Krise ist nicht mehr die klassische Krise, der entscheidende Moment. Sie ist im Gegenteil endloses Ende, dauerhafte Apokalypse, unbestimmte Unterbrechung, anders wirksam als der wirkliche Zusammenbruch und daher permanenter Ausnahmezustand. Die gegenwärtige Krise verspricht nichts mehr; sie neigt ganz im Gegenteil dazu, die Regierenden von jeder Beschränkung hinsichtlich ihrer Wahl der angewandten Mittel zu befreien.
2. Jede Epoche hat ihren Stolz. Möchte einzigartig sein. Der Stolz der unsrigen ist es, Zeugin des historischen Aufeinanderprallens einer globalen ökologischen Krise, einer verallgemeinerten politischen Krise der Demokratien und einer unvermeidlichen Energiekrise zu sein, gekrönt von einer schleichenden, aber »seit einem Jahrhundert beispiellosen« Weltwirtschaftskrise. Und das schmeichelt uns und erhöht unseren Genuss, in einer unvergleichlichen Epoche zu leben. Man muss nur die Zeitungen der 1970er Jahre aufschlagen, den Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums von 1972, den Artikel des Kybernetikers Gregory Bateson über »Die Wurzeln ökologischer Krisen« vom März 1970 oder den von der Trilateralen Kommission 1975 veröffentlichten Bericht The Crisis of Democracy lesen, um festzustellen, dass wir mindestens seit Anfang der 1970er Jahre unter dem dunklen Stern einer uneingeschränkten Krise leben. Ein Text von 1973 wie Apocalisse e rivoluzione von Giorgio Cesarano analysiert das bereits hellsichtig. Wenn das siebente Siegel in einem bestimmten Augenblick gebrochen wurde, dann jedenfalls nicht erst gestern.
Ende 2012 veröffentlichte das hochoffizielle amerikanische Center for Disease Control zur Abwechslung einen Comic. Sein Titel: Preparedness 101: Zombie apocalypse. Der Gedanke ist simpel: Die Bevölkerung soll für alle Eventualitäten gerüstet sein, eine Atom- oder Naturkatastrophe, ein allgemeiner Systemausfall oder ein Aufstand. Das Dokument endete so: »Wenn Sie auf eine Apokalypse von Zombies vorbereitet sind, sind Sie für jeglichen Ernstfall gewappnet.« Die Figur des Zombies kommt aus der Voodoo-Kultur Haitis. Im amerikanischen Kino werden regelmäßig Massen aufgebrachter Zombies als Metapher für die Gefahr eines allgemeinen Aufstands des schwarzen Proletariats verwendet. Auf das also gilt es vorbereitet zu sein. Jetzt, wo nicht mehr auf die sowjetische Gefahr verwiesen werden kann, um den psychotischen Zusammenhalt der Bürger sicherzustellen, sind alle Mittel recht, um die Bevölkerung in Bereitschaft zu versetzen, sich zu verteidigen, das heißt das System zu verteidigen. Einen Schrecken ohne Ende aufrechtzuerhalten, um ein Ende mit Schrecken zu verhindern.
Das ganze falsche westliche Bewusstsein ist in diesem offiziellen Comic vereint. Natürlich sind die wirklichen lebenden Toten die Kleinbürger der amerikanischen Suburbs. Natürlich kommt die platte Sorge ums Überleben, die wirtschaftliche Angst, alles zu verpassen, das Gefühl, die Lebensweise an sich sei unerträglich, nicht nach der Katastrophe, sondern beflügelt schon jetzt den verzweifelten Struggle for Life jedes Einzelnen in der neoliberalen Ordnung. Das im eigentlichen Sinn unaushaltbare Leben droht nicht, sondern ist bereits da, tagtäglich. Jeder sieht es, weiß es, fühlt es. Die Walking Dead, das sind die Salary Men. Unsere Epoche ist nicht allein des ästhetischen Vergnügens wegen, das diese Art von Zerstreuung bietet, vernarrt in apokalyptische Szenen, die einen guten Teil der Filmproduktion ausmachen. Schon die Apokalypse des Johannes hat übrigens alles, was eine fantastische Hollywood-Vision braucht, mit ihren Luftangriffen durch entfesselte Engel, ihren unbeschreiblichen Sintfluten, ihren spektakulären Plagen. Nur die allumfassende Zerstörung, der allseitige Tod kann dem Angestellten aus der Eigenheimsiedlung entfernt das Gefühl verleihen zu leben, ihm, der unter den lebenden Toten der toteste Lebende ist. »Genug davon!« und »Hoffentlich bleibt es so!« sind die zwei Seufzer, die von ein und derselben zivilisierten Hilflosigkeit abwechselnd ausgestoßen werden. Darein mischt sich eine alte calvinistische Lust zur Kasteiung: Das Leben ist Aufschub, niemals Fülle. Nicht umsonst hat man von »europäischem Nihilismus« gesprochen. Der sich übrigens so gut als Exportartikel eignete, dass die Welt seiner mittlerweile überdrüssig ist. Was die »neoliberale Globalisierung« betrifft, so gab es für uns vor allem die Globalisierung des Nihilismus.
2007 haben wir geschrieben, dass »das, dem wir uns gegenübersehen, nicht die Krise einer Gesellschaft, sondern das Erlöschen einer Zivilisation ist«. Mit derlei Aussagen galt man damals als Illusionist. Doch »die Krise« ist eingetreten. Selbst ATTAC hat gemerkt, dass es eine »Krise der Zivilisation« gibt, und das will etwas heißen. Pikanter ist, was ein amerikanischer Irakkriegs-Veteran und heutiger »Strategie«-Berater im Herbst 2013 in der New York Times schrieb: »Wenn ich nun in unsere Zukunft blicke, sehe ich, wie das Wasser ansteigt und das südliche Manhattan überflutet. Ich sehe Hungerrevolten, Hurrikans und Klimaflüchtlinge. Ich sehe Soldaten des 82. Fliegerregiments, die Plünderer erschießen. Ich sehe allgemeine Ausfälle des Versorgungsnetzes, verwüstete Häfen, die Abfälle von Fukushima und Epidemien. Ich sehe Bagdad. Ich sehe die Rockaways. Ich sehe eine seltsame, prekäre Welt. […] Das größte Problem mit dem Klimawandel ist nicht, wie sich das Verteidigungsministerium auf Rohstoffkriege vorbereiten sollte oder wie wir Deiche errichten sollten, um Alphabet City zu schützen, oder wann wir Hoboken evakuieren sollten. Es wird nicht damit getan sein, Hybridautos zu kaufen, Abkommen zu unterzeichnen oder die Klimaanlage abzustellen. Das größte Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist philosophischer Natur: zu verstehen, dass diese Zivilisation bereits tot ist.« Nach dem Ersten Weltkrieg hieß es noch, sie sei »tödlich«, was sie zweifellos in jedem Sinn des Wortes war.
In Wirklichkeit wurde die klinische Diagnose des Endes der westlichen Zivilisation schon vor einem Jahrhundert gestellt und durch die Ereignisse bestätigt. Das zu erörtern ist seither nur eine Art, sich davon abzulenken. Vor allem aber ist es eine Art, sich von der Katastrophe abzulenken, die da ist, und das seit Langem, von der Katastrophe, die wir sind, der Katastrophe, die der Westen ist. Diese Katastrophe ist zuerst existenziell, emotional, metaphysisch. Sie liegt in der unglaublichen Fremdheit des westlichen Menschen gegenüber der Welt, einer Fremdheit, die beispielsweise gebietet, sich zum Beherrscher und Besitzer der Natur zu machen – nur was man fürchtet, versucht man zu beherrschen. Nicht umsonst hat der Mensch so viele Schirme zwischen sich und der Welt errichtet. Der westliche Mensch hat das Existierende, indem er sich von ihm abschottet, in diese trostlose Weite, dieses triste, feindselige, mechanische, absurde Nichts verwandelt, das er ständig durch seine Arbeit, durch einen krankhaften Aktivismus, durch eine hysterische oberflächliche Geschäftigkeit verändern muss. Ununterbrochen von der Euphorie in den Stumpfsinn und vom Stumpfsinn in die Euphorie zurückgeworfen, sucht er in der Anhäufung von Expertisen, Prothesen, Beziehungen – all diesem letztlich enttäuschenden technologischen Krimskrams – Abhilfe für seine Absenz von der Welt. Immer deutlicher wird er zu diesem überausgerüsteten Existentialisten, dessen Geist unaufhörlich arbeitet, der alles neu schafft und eine Realität nicht ertragen kann, die ihm völlig unverständlich ist. »Die Welt verstehen heißt für einen Menschen: sie auf das Menschliche zurückführen, ihr ein menschliches Siegel aufdrücken«, gestand der Idiot Camus unumwunden ein. Seinem Bruch mit der Existenz, mit sich selbst, mit »den anderen« – dieser Hölle! –, versucht der westliche Mensch trivial neuen Zauber zu verleihen, indem er ihn seine »Freiheit« nennt, wenn schon langweilige Feste, debile Ablenkungen oder der massive Gebrauch von Drogen nicht helfen. Das Leben ist für ihn effektiv und emotional abwesend, denn das Leben widert ihn an; im Grunde bereitet es ihm Ekel. Vor allem, was die Wirklichkeit an Instabilem, Unlösbarem, Greifbarem, Körperlichem, Drückendem, an Hitze und Müdigkeit bereithält, konnte er sich schützen, indem er es auf die ideelle, visuelle, entfernte, digitalisierte Ebene des Internets projiziert, das ohne Reibung und Tränen, ohne Tod und Geruch auskommt.
Die Lüge der ganzen westlichen Apokalyptik besteht darin, auf die Welt die ganze Trauer zu projizieren, die wir für sie nicht aufbringen können. Nicht die Welt ist verloren, wir haben die Welt verloren und verlieren sie unaufhörlich; nicht die Welt wird bald zu Ende gehen, wir sind am Ende, amputiert, abgeschnitten, wir, die halluzinatorisch den lebendigen Kontakt mit der Wirklichkeit ablehnen. Die Krise ist nicht wirtschaftlicher, ökologischer oder politischer Natur, die Krise ist vor allem eine der Präsenz. Und dies so sehr, dass das Must Have unter den Waren – typischerweise das iPhone und der Hummer-Geländewagen – aus einer ausgeklügelten Apparatur der Absenz besteht. Das iPhone bündelt einerseits in einem einzigen Objekt alle möglichen Zugänge zur Welt und zu den anderen; es ist Lampe und Fotoapparat, Winkelmaß und Musikrekorder, Fernseher und Kompass, Touristenführer und Kommunikationsmittel; andererseits ist es die Prothese, die dem, was da ist, jede Verfügbarkeit verwehrt und mich in ein System ständiger bequemer Halbpräsenz versetzt, das einen Teil meines Da-Seins ständig zurückhält. Kürzlich wurde sogar eine Smartphone-App eingeführt, die dafür Abhilfe schaffen soll, dass »unsere Rund-um-die-Uhr-Verbindung mit der digitalen Welt uns von der realen Welt um uns herum abkoppelt«. Sie nennt sich hübsch GPS for the Soul. Der Hummer wiederum ist die Möglichkeit, meine autistische Blase, meine Undurchlässigkeit für alles bis in die letzten unzugänglichen Winkel »der Natur« zu transportieren; und wieder unbeschadet von dort zurückzukommen. Dass Google den »Kampf gegen den Tod« als neue industrielle Perspektive verkündet, ist bezeichnend dafür, wie man sich darüber täuscht, was das Leben ist.
In seiner perfekten Demenz hat sich der Mensch sogar zur »geologischen Kraft« erklärt; er ist so weit gegangen, eine Phase des Lebens dieses Planeten nach seiner Spezies zu benennen: Er hat begonnen, von »Anthropozän« zu sprechen. Ein letztes Mal weist er sich die Hauptrolle zu, auch wenn er sich beschuldigt, alles verwüstet zu haben – die Meere, die Lüfte, die Gründe und Untergründe –, auch wenn er sich für die beispiellose Ausrottung von Pflanzen- und Tierarten an die Brust schlägt. Bemerkenswert ist allerdings, dass er sich gegenüber der Katastrophe, die er durch sein katastrophales Verhältnis zur Welt verursacht, immer in derselben katastrophalen Weise verhält. Er berechnet die Geschwindigkeit, mit der das Packeis verschwindet. Er misst die Auslöschung nichtmenschlicher Lebensweisen. Über den Klimawandel spricht er nicht anhand seiner eigenen Sinneserfahrung – jener Vogel, der nicht mehr zur selben Jahreszeit kommt, jenes Insekt, dessen Zirpen man nicht mehr hört, jene Pflanze, die nicht mehr zur gleichen Zeit blüht wie eine andere. Er spricht darüber in Zahlen, Durchschnittswerten, wissenschaftlich. Er glaubt, etwas gesagt zu haben, wenn er feststellt, dass die Temperatur um soundso viel Grad ansteigen und die Niederschläge um soundso viel Millimeter abnehmen werden. Er spricht sogar von »Biodiversität«. Er beobachtet die Verminderung des Lebens auf Erden aus dem All. Als Gipfel seines Stolzes behauptet er jetzt sogar paternalistisch, »die Umwelt zu schützen«, die ihn darum nicht gebeten hat. Alles deutet darauf hin, dass dies seine letzte Flucht nach vorne ist.
Die objektive Katastrophe dient uns vorrangig dazu, eine andere, noch offensichtlichere und massivere Zerstörung zu kaschieren. Die Aufzehrung der Rohstoffe ist vermutlich deutlich weniger fortgeschritten als die Aufzehrung der subjektiven Ressourcen, der vitalen Ressourcen, die unsere Zeitgenossen erfasst hat. Wenn man sich so sehr darin gefällt, ausführlich die Verwüstung der Umwelt zu beschreiben, dann auch, um den ungeheuren Verfall der Innerlichkeiten zu verschleiern. Jede Ölpest, jede verödete Steppe, jedes Aussterben einer Art ist ein Bild unserer zerschlissenen Seelen, unserer Absenz von der Welt, unserer intimen Unfähigkeit, sie zu bewohnen. Fukushima bietet das Spektakel dieses perfekten Scheiterns des Menschen und seiner Kontrolle, die nur Vernichtung hervorbringt – und diese scheinbar intakten japanischen Landschaften, in denen jahrzehntelang niemand mehr leben können wird. Eine unendliche Zersetzung, die die Welt endgültig unbewohnbar macht: Der Westen hat letztlich seine Daseinsweise von dem übernommen, was er am meisten fürchtet – dem radioaktiven Abfall.
Fragt man die Linke der Linken, worin für sie die Revolution besteht, beeilt sie sich zu antworten: »den Menschen ins Zentrum stellen«. Was diese Linke nicht begreift, ist, wie sehr die Welt des Menschen müde ist, wie sehr wir der Menschheit müde sind – dieser Spezies, die sich für die Krone der Schöpfung hielt, die sich berechtigt fühlte, alles zu plündern, als ob ihr alles zustünde. »Den Menschen ins Zentrum stellen« war das westliche Konzept. Wohin es geführt hat, ist bekannt. Der Zeitpunkt ist gekommen, das Schiff zu verlassen, die Spezies zu verraten. Es gibt keine große menschliche Familie, die unabhängig von jeder Welt, jedem familiären Universum, jeder über die Erde verstreuten Lebensform besteht. Es gibt keine Menschheit, es gibt nur Erdenbewohner und ihre Feinde – die Westler jedweder Hautfarbe. Wir Revolutionäre mit unserem atavistischen Humanismus wären gut beraten, uns über die ununterbrochenen Aufstände der indigenen Völker Zentral- und Südamerikas in den letzten zwanzig Jahren zu informieren. Ihre Losung könnte lauten: »die Erde ins Zentrum stellen«. Es ist eine Kriegserklärung an den Menschen. Ihm den Krieg zu erklären, könnte eine gute Art sein, ihn auf die Erde zurückzuholen, wenn er sich nicht wie immer taub stellte.
3. Nicht weniger als 300 aus 18 Ländern herbeigeströmte Journalisten fielen am 21. Dezember 2012 in das kleine Dorf Bugarach in der Aude ein. Keiner der bislang bekannten Maya-Kalender hatte je für dieses Datum ein Ende der Zeiten angekündigt. Das Gerücht, dieses Dorf stünde irgendwie im Zusammenhang mit dieser Prophezeiung, die es gar nicht gibt, war ein offenkundiger Hoax. Dennoch schickten TV-Sender aus aller Welt eine Armada an Reportern dorthin. Man war neugierig, ob es wirklich Leute gibt, die an das Ende der Welt glauben – wir, denen es nicht einmal mehr gelingt, an die Welt zu glauben, und die wir größte Mühe haben, an unsere eigenen Lieben zu glauben. In Bugarach war an diesem Tag niemand, niemand anders als die große Schar Offizianten des Spektakels. Die Journalisten waren da, um sich selbst zum Thema zu machen, ihr gegenstandsloses Warten, ihre Langeweile und die Tatsache, dass sich nichts ereignete. In die eigene Falle getappt, boten sie ein Bild vom wirklichen Ende der Welt: Journalisten, Warten, Ausstand der Ereignisse.
Der Wahn der Apokalypse, der Hunger nach Armageddon, der die Epoche durchzieht, ist nicht zu unterschätzen. Ihre existenzielle Pornografie besteht darin, Dokumentarsendungen zu glotzen mit computergenerierten Bildern von Heuschreckenschwärmen, die im Jahr 2075 über die Weinberge von Bordeaux hereinfallen, oder Horden von »Klimaflüchtlingen«, die die südlichen Strände Europas stürmen werden – und deren Dezimierung sich Frontex schon heute zum Ziel gemacht hat. Nichts ist älter als das Ende der Welt. Die apokalyptische Leidenschaft erfreute sich bei den Machtlosen schon seit der frühsten Antike großer Beliebtheit. Neu ist, dass wir in einer Epoche leben, in der die Apokalypse vom Kapital vollständig vereinnahmt und in seinen Dienst gestellt wurde. Es ist der Ausblick auf die Katastrophe, von dem aus wir gegenwärtig regiert werden. Wenn nun aber etwas zwangsläufig unvollendet bleiben muss, dann die Vorhersage der Apokalypse, ob in Bezug auf Umwelt, Klima, Terrorismus oder Kernenergie. Sie wird nur angesprochen, um nach den Mitteln zu rufen, um sie abzuwenden, das heißt meist nach der Notwendigkeit der Regierung. Keine Organisation, ob politisch oder religiös, hat je ihr Scheitern eingeräumt, weil ihre Prophezeiungen nicht eingetreten sind. Das Ziel der Prophezeiungen ist nämlich nie, in Zukunft recht zu haben, sondern auf die Gegenwart einzuwirken: um im Hier und Jetzt Warten, Passivität, Unterwerfung durchzusetzen.
Nicht nur steht keine andere Katastrophe bevor als die, die bereits da ist, es ist auch offenkundig, dass die meisten tatsächlichen Desaster einen Ausweg aus unserem täglichen Desaster weisen. Unzählige Beispiele zeugen davon, welche Erleichterung die existenzielle Apokalypse durch die reale Katastrophe erfährt: das Erdbeben, das 1906 San Francisco erschütterte, der Wirbelsturm Sandy, der 2012 Teile New Yorks verwüstete. Normalerweise geht man davon aus, dass im Ernstfall die tiefsitzende, ewige Rohheit zwischenmenschlicher Beziehungen zutage kommt. Man hofft, mit jedem verheerenden Erdbeben, mit jedem ökonomischen Crash und jedem »Terrorangriff« bestätige sich das alte Hirngespinst vom natürlichen Zustand der Dinge und den daraus abgeleiteten unkontrollierbaren Ausschreitungen. Man möchte, dass, sollte das dünne Bollwerk der Zivilisation nachgeben, der »verächtliche Bodensatz des Menschen«, der Pascal keine Ruhe ließ, zum Vorschein kommt, die schlimmen Leidenschaften, die »menschliche Natur«, missgünstig, brutal, blind und hassenswert, die den Machthabenden mindestens seit Thukydides als Argument dienen – ein Trugbild, das durch die meisten bekannten Katastrophen der Geschichte bedauerlicherweise widerlegt wurde.
Die Auslöschung der Zivilisation erfolgt normalerweise nicht in Form eines chaotischen Krieges jeder gegen jeden. Dieser feindselige Diskurs dient in Situationen schwerer Katastrophen nur dazu, zu rechtfertigen, dass der Verteidigung des Eigentums gegen Plünderer durch Polizei, Armee oder notfalls Bürgerwehren, die sich bei dieser Gelegenheit bilden, Vorrang eingeräumt wird. Er kann auch dazu dienen, Veruntreuungen durch die Behörden selbst zu decken, etwa im Fall des italienischen Zivilschutzes nach dem Erdbeben von L’Aquila. Stattdessen eröffnet der als solcher akzeptierte Zerfall dieser Welt selbst inmitten des »Notstands« Wege für eine andere Art zu leben. So am Beispiel der Einwohner Mexikos 1985, die inmitten der Trümmer ihrer von einem verheerenden Erdbeben heimgesuchten Stadt in einem Zug den revolutionären Karneval und die Figur des Superhelden im Dienste des Volkes in Form des legendären Catchers Superbarrio neu erfanden. In der Folge der euphorischen Wiederaneignung ihrer städtischen Existenz in deren banalster Alltäglichkeit, stellten sie einen Zusammenhang her zwischen dem Zusammenbruch der Gebäude und dem Zusammenbruch des politischen Systems, entzogen die Stadt so gut wie möglich dem Einfluss der Regierung und bauten ihre zerstörten Häuser wieder auf. Nichts anderes meinte ein begeisterter Bewohner von Halifax, als er 2003 nach dem Wirbelsturm erklärte: »Eines Morgens wachten wir auf, und alles war anders. Es gab keinen Strom mehr, und die Läden waren geschlossen, niemand hatte Zugang zu den Medien. Deshalb fanden sich alle auf der Straße ein, um sich auszutauschen und zu berichten. Nicht wirklich ein Straßenfest, aber alle gleichzeitig draußen – eine Art von Glücksgefühl, all die Menschen zu sehen, obwohl wir uns nicht kannten.« Nicht anders die Minigemeinschaften, die in New Orleans in den Tagen nach Katrina spontan entstanden, nachdem sie die Geringschätzung durch die öffentlichen Behörden und die Paranoia der Sicherheitsdienste erlebt hatten; sie organisierten sich täglich, um für Nahrung, Pflege, Bekleidung zu sorgen, auch wenn dabei einige Läden geplündert wurden.
Die Idee der Revolution neu als etwas zu denken, das in der Lage ist, den Lauf der Katastrophe zu durchbrechen, bedeutet also zuallererst, sie von all dem zu reinigen, was sie bislang an Apokalyptischem beinhaltete. Es bedeutet zu sehen, dass sich die marxistische Eschatologie nur in diesem vom imperialen Gründungsanspruch der Vereinigten Staaten von Amerika unterscheidet, den man immer noch auf jeder Dollarnote aufgedruckt findet: »Annuit coeptis. Novus ordo seclorum.« Sozialisten, Liberale, Saint-Simonisten, Russen und Amerikaner des Kalten Kriegs, alle haben stets denselben nervösen Anspruch auf Errichtung einer sterilen Ära des Friedens und des Überflusses geäußert, in der nichts mehr zu befürchten sei, die Widersprüche endlich aufgelöst und das Negative überwunden wären. Durch Wissenschaft und Industrie eine prosperierende Gesellschaft zu errichten, die vollständig automatisiert und befriedet sei. So etwas wie ein Paradies auf Erden, organisiert nach dem Modell eines psychiatrischen Krankenhauses oder Sanatoriums. Ein Ideal, das nur von zutiefst kranken Wesen herrühren kann, die nicht einmal mehr nach Vergebung streben. »Heaven is a place where nothing ever happens«, heißt es in einem Lied.
Die ganze Originalität und der ganze Skandal des Marxismus war zu behaupten, es müsse zuerst die wirtschaftliche Apokalypse kommen, um das Millennium zu erreichen, während die anderen dies für überflüssig hielten. Wir werden weder auf das Millennium noch auf die Apokalypse warten. Es wird nie Frieden auf Erden geben. Der einzig wahre Frieden besteht darin, die Idee des Friedens aufzugeben. Angesichts der Katastrophe des Westens verfällt die Linke im Allgemeinen in eine klagende, anprangernde und folglich machtlose Haltung, die sie gerade in den Augen derer, die zu verteidigen sie vorgibt, hassenswert macht. Der Ausnahmezustand, in dem wir leben, ist nicht anzuprangern, sondern gegen die Macht selbst zu kehren. Wir sind nun unsererseits von jeder Rücksichtnahme auf das Gesetz befreit – proportional zur Straflosigkeit, die wir uns selbst zugestehen, zu den Kräfteverhältnissen, die wir schaffen. Wir sind absolut frei für jede Entscheidung, jede Machenschaft, sofern sie auf einem klugen Verständnis der Lage beruht. Für uns gibt es nur noch einen historischen Kampfschauplatz und die Kräfte, die sich darauf bewegen. Unser Handlungsspielraum ist unendlich. Das historische Leben streckt die Hände nach uns aus. Unzählige Gründe sprechen dafür, sich ihm zu verweigern, aber alle sind neurotisch bedingt. Ein ehemaliger Beamter der Vereinten Nationen kommt zur hellsichtigen Schlussfolgerung: »It’s not the end, not even close. If you can fight, fight. Help each other. The war has just begun.« »Es ist nicht das Ende, weit gefehlt. Wenn du kämpfen kannst, dann kämpfe. Helft euch gegenseitig. Der Krieg hat gerade erst begonnen.«