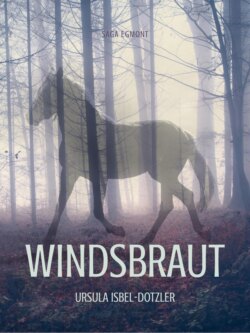Читать книгу Windsbraut - Ursula Isbel-Dotzler - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Grenze
Оглавление»Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr mitkommen wollt«, sagte meine Mutter.
Ich sah Simon an. Wie immer, wenn ich nicht wusste, ob ich etwas wollte, ob ich Ja oder Nein sagen sollte, überließ ich ihm die Entscheidung.
»Und welchen Zombies seid ihr diesmal auf der Spur?«, fragte mein Bruder. »Dracula und Frankenstein hatten wir ja schon. Mein Bedarf an Monstern ist für die nächsten hundert Jahre gedeckt.«
»Meiner auch«, echote ich.
Unser Vater schenkte sich einen Whisky ein. Er liebte Whisky – etwas zu sehr für meinen Geschmack. Das Glucksen und Plätschern der goldfarbenen Flüssigkeit war vermutlich Musik in seinen Ohren, aber ich wurde zunehmend allergischer dagegen.
»Diesmal ist’s nur ein Haufen stinknormaler Gespenster«, sagte er und lachte.
»Und wo in England?«, wollte Simon wissen.
»Irgendwo in Kent.« Mama legte die Füße auf den Couchtisch. Im milden Schein der Stehlampe sah sie aus wie ein junges Mädchen, schlank, lässig und von einer Anmut, die ich nicht geerbt hatte. »Wir können da ein Haus mieten, ein Cottage mit drei Schlafzimmern und genug Platz für uns alle.«
Wieder ging mein Blick zu Simon hinüber. Wenn er Ja sagte, würden wir mitfahren; wenn nicht, würden wir eben Freunde in Österreich besuchen, die für die Sommerferien eine Berghütte gemietet hatten.
»Wie lange wollt ihr bleiben?«
»Zwölf Tage vielleicht oder auch länger, je nachdem, wie schnell wir den Artikel schaffen. Es ist eine Auftragsarbeit, nicht schlecht bezahlt.« Das kam von meinem Vater. Seit wann kümmerte er sich um Geld? Das überließ er doch für gewöhnlich Mama.
»Also, kommt ihr mit?«, fragte meine Mutter.
Bis zur Abfahrt wusste ich noch immer nicht, ob ich wirklich mit auf diese Reise wollte. Doch ich hatte Simon für mich entscheiden lassen und er hatte Ja gesagt.
Eigentlich hatte ich genug von altem Gemäuer und Spukgeschichten, von düsteren Hallen und schaurigen Plätzen, an denen die Geister unglücklicher Grafen und Gräfinnen herumirrten.
Schon als Simon und ich noch klein waren, hatten unsere Eltern uns auf ihre Reisen mitgenommen – nach Schottland und Irland, nach Frankreich und in die Karpaten, zu den Überresten von Draculas Palast. Vor der Kapelle hatten wir gesessen und gewartet, während sie durch die Mauerreste des Palastes schlenderten, Vater mit der Kamera und Mama mit ihrem Notizblock.
Ich erinnere mich noch heute, wie erbärmlich ich geschrien hatte, als ein alter Mann auftauchte und uns in gebrochenem Deutsch erzählte, dass Dracula hier in seinen Folterkammern Männer, Frauen und Kinder blenden ließ, ihnen die Haut abzog oder sie bei lebendigem Leib begrub.
Wir waren dabei, als sie Castle Rising in Norfolk besichtigten, begleiteten sie zu Frankensteins Burg im Odenwald und fuhren mit nach Irland, ins Tullynally Castle, wo Simon die Masern bekam.
Und immer hatten uns alle beneidet, deren Eltern Bankbeamte und Hausfrauen, Apotheker und Zahnärzte waren. Jeder dachte, es müsste absolut göttlich sein, eine Mutter und einen Vater zu haben, die ihr Geld damit verdienten, an finstere Orte zu reisen und Fotoreportagen über kopflose Gespenster, Weiße Frauen oder Stimmen aus dem Jenseits für Zeitungen und Magazine zu machen.
Nur wenige wussten, dass mich die Vorstellung von Draculas Foltermethoden noch jahrelang in meinen Alpträumen verfolgt hatte, und dass ich mich als kleines Mädchen lange Zeit heulend geweigert hatte, nachts ohne Licht zu schlafen.
Wie unsere Eltern wirklich zu all den übersinnlichen Erscheinungen standen, die sie so ernsthaft »dokumentierten«, wie sie es nannten, hatten wir nie herausgefunden. Für sie war es wohl vor allem ein Job, der Freiheit und guten Verdienst bedeutete und die Möglichkeit, viel auf Reisen zu sein.
Während wir im Flugzeug nach Heathrow saßen, fragte ich mich wieder einmal, ob sie je einen Gedanken daran verschwendeten, ob es die Spukgestalten wirklich gab, von denen sie sich erzählen ließen und über die sie schrieben. Und hatte es ihnen je etwas ausgemacht, Räume zu fotografieren, in denen Menschen gelitten hatten und auf gewaltsame Weise umgekommen waren?
Eigentlich wirkten sie wie immer am Anfang einer solchen Reise: aufgekratzt und erwartungsvoll. Mein Vater trank einen kostenlosen Whisky nach dem anderen.
»Das Jagdfieber hat sie wieder gepackt«, murmelte Simon, der neben mir saß.
Ja, vielleicht war es das, was sie empfanden: die Spannung des Jägers, der auf Beutefang geht. Nur dass sie nicht nach Tieren jagten, sondern nach möglichst schaurigen Geschichten und sensationellen Fotos.
»Möglicherweise flattert mir ja diesmal ein Gespenst vor die Linse«, sagte mein Vater und lächelte dabei. Doch ich wusste, es war sein heimlicher Traum, den großen Coup zu landen, der ihn mit einem Schlag berühmt gemacht hätte.
»Wäre dir mit einem Geisterpferd auch geholfen?«, fragte Mama. »In Darkwood Hall sollen auch Pferde mit zum Spuk gehören.«
Ich dachte: Wenn sie jetzt eine Geschichte von Pferden erzählt, die dort umgehen, weil sie irgendwann gequält oder zu Tode gehetzt worden sind, stecke ich mir die Finger in die Ohren! Ich liebe Tiere, vor allem Pferde und Hunde.
Doch sie redeten nicht weiter darüber. Simon meinte: »Du könntest es doch mal mit einem Trick probieren.«
Vater schüttelte den Kopf. »Getürkte Fotos von Spukgestalten hat’s immer wieder gegeben und regelmäßig ist die Sache irgendwie aufgeflogen. Ich werde den Teufel tun, mit so einem Schwachsinn meinen guten Ruf aufs Spiel zu setzen.«
»Dann könnten wir unseren Job gleich an den Nagel hängen«, stimmte Mama zu. »Keiner würde uns je wieder eine Story abkaufen.«
Gleich am Flughafen nahmen wir einen Leihwagen, einen Rover. Simon faltete die Landkarte auseinander und dirigierte Mama durch das Gewirr von Straßen und Kreuzungen. Mein Vater saß neben mir auf dem Rücksitz; er war nie ein besonders guter Fahrer gewesen, hasste den Linksverkehr und hätte uns mit all dem Whisky in seinem Blut auch bei jeder Polizeikontrolle in Schwierigkeiten gebracht.
»Wie kommen wir eigentlich ins Haus?«, fragte er.
»Ins Cottage, meinst du? Der Schlüssel liegt unter einem bestimmten Pflasterstein im Vorgarten.«
Dann schlief mein Vater ein und benutzte meine Schulter als Kopfkissen. Sein Atem roch nach Alkohol. Ich wandte das Gesicht von ihm ab und sah aus dem Wagenfenster, in die üppige grüne englische Landschaft mit den sanft geschwungenen Wiesen, den Eichen, die von Efeu umrankt waren, den Bilderbuchhäusern und den verschwenderisch blühenden Gärten.
In einem winzigen, verschlafenen Dorf machten wir Pause. Es gab nur ein einziges Gasthaus, ein uraltes, windschiefes Gebäude mit geschwärzten Fachwerkbalken und einem Blechschild, auf dem eine Eule abgebildet war, die ein Auge zudrückte.
»Winking Owl« hieß der Gasthof, was nicht winkende, sondern blinzelnde Eule bedeutet, wie Vater erklärte. Es gab »cream tea« – heiße Scones mit Butter, Erdbeermarmelade und einer Art zähflüssiger Sahne und dazu jede Menge Tee.
Simon vertilgte fünf dick beladene Scones und ich drei; dann war uns etwas flau im Magen.
»Ich fühle mich wie der Wolf, dem sie den Bauch mit Wackersteinen gefüllt haben«, sagte Simon, als wir wieder im Auto saßen, und stöhnte.
»Kein Wunder bei diesen Unmengen, die du in dich hineingeschaufelt hast«, erwiderte Mama. »Sind wir nicht bald da? Es dauert nicht mehr lang, dann überfällt mich die Müdigkeit.«
Simon sah auf die Landkarte. »Etwa zehn Meilen noch, schätze ich. Lass mich doch mal fahren!«
»Du weißt genau, dass du noch keinen Führerschein hast.«
»Noch nicht, aber so gut wie. In ein paar Wochen hab ich den Lappen in der Tasche.«
»Kommt nicht in Frage! Wir können es uns nicht leisten, uns mit der englischen Polizei anzulegen«, knurrte mein Vater.
St. Mary in the Woods war kaum mehr als ein Dorf, eine Ansammlung alter Häuser um eine graue, gedrungene Kirche herum, eingebettet in Buckelwiesen, auf denen Kühe und Schafe weideten. Von Darkwood Hall, dem Herrenhaus, war nichts zu sehen, als wir über ein Flüsschen auf die Hauptstraße fuhren. Wir folgten der Beschreibung des Cottagebesitzers, die Mama auf einen Zettel gekritzelt hatte, und kamen schließlich zum Ortsende; da tauchten über einem Wall dunkler Bäume die viereckigen Türme eines grauen Gebäudes auf.
»Das muss Darkwood sein«, sagte mein Vater. »Es sieht viel versprechend aus, findest du nicht?«
Mama nickte. Ich hoffte insgeheim, dass unser Cottage möglichst weit von Darkwood Hall entfernt sein würde und dass wir von dort aus nichts davon sehen konnten – nicht einmal eine Zinne oder einen der drachenköpfigen Wasserspeier auf dem Dach.
»Wir müssen zur Parkmauer«, sagte Mama. »Dort ist das Cottage, das wir gemietet haben. Es war vermutlich mal eine Art Torwächterhaus. Es heißt ›Mousehole‹, ist das nicht ein putziger Name?«
Mousehole Cottage duckte sich praktisch im Schatten des Herrenhauses. Es klebte dicht neben einer Toreinfahrt an der alten Steinmauer. Es tröstete mich wenig, dass Darkwood Hall von dort aus tatsächlich nicht zu sehen war.
Ich musste zugeben, dass das Cottage eins der malerischsten Häuschen war, die ich je gesehen habe. Efeu, Geißblatt und Clematis kletterten von der Mauer herab oder an ihr hoch und überzogen des Schindeldach. Die Sprossenscheiben zwischen den Fachwerkbalken blitzten, das Mauerwerk war krumm und bauchig und um die Tür rankte sich ein Rosenstrauch, der über und über voll weißer Blüten war. Unter dem bröckelnden Torbogen, der in den Park führte, wuchsen Schmetterlingssträucher, und das Gras war hoch und blau von Glockenblumen.
Der Fehler war nur, dass das Häuschen ausgerechnet an der Parkmauer von Darkwood Hall stand. Obwohl die Steinquader den Blick aufs Herrenhaus verstellten, bildete ich mir doch ein, dass ich seine Gegenwart spürte. Ich suchte Simons Blick, aber er war schon dabei, die Gartenpforte zu öffnen, und wandte mir den Rücken zu.
»Ist es nicht absolut süß?«, schwärmte meine Mutter. »Ein Hexenhäuschen wie im Märchenbuch. Und ich glaube, dieses Tor wird nicht mehr benutzt. Die Einfahrt ist ja ganz zugewachsen. Es muss wohl noch einen anderen Zugang geben. Hier haben wir unsere Ruhe.«
Mousehole Cottage war nur spärlich möbliert und roch nach Moder, Staub und Mäusedreck. Wir schoben alle Fensterflügel hoch und schleppten unser Gepäck ins Haus. Es gab ein Wohnzimmer, eine Küche, ein winziges Bad und drei Schlafzimmer unter dem Dach, je eines für Simon und mich und eins für unsere Eltern.
Ich schlief wie ein Stein, trotz des Kinderbetts, bei dem ich meine Füße zwischen den Messingstäben durchschieben musste, wenn ich mich ausstrecken wollte. Doch irgendwann erwachte ich von einem seltsamen Geräusch, das lauter und lauter wurde, bis es richtig in meinen Ohren dröhnte.
Eine Weile lag ich da und lauschte, bis ich das Geräusch einordnen konnte und begriff, dass es Hufschlag war, das Getrappel vieler Pferdehufe. Es klang, als käme eine Schar Pferde in rasendem Galopp über einen gepflasterten Weg am Haus vorbeigestürmt.
Einen Augenblick lang war das Dröhnen und Klappern so heftig, dass ich das alte Haus unter mir erzittern fühlte. Dann wurde es leiser und schwächer, bis es nach und nach in der Ferne verklang.
Jetzt erst wurde mir klar, wo ich war. Der Raum war schwarz wie eine Höhle, aber ein Luftzug verriet mir, wo das Fenster sein musste. Ich tastete nach meiner Armbanduhr, stieß das Wasserglas auf dem Nachttisch um und sah auf die Leuchtziffern.
Es war zwei Uhr nachts. Wer mochte um diese Zeit am Cottage vorbeigeritten sein? Das Getrappel hatte nach vielen Pferden geklungen, einem Dutzend mindestens. Oder war es eine Herde von Pferden ohne Reiter, die in Panik geraten und irgendwo aus ihrer Koppel ausgebrochen waren?
Ich stieg aus dem Bett und tappte ans Fenster. Draußen herrschte stockfinstere Nacht, man sah weder Mond noch Sterne. Ein leichter Wind raunte in den Bäumen. Sonst war alles still.
Beim Frühstück, das mit Instantkaffee, Knäckebrot und Dosenstreichwurst nicht besonders üppig ausfiel, stellte ich fest, dass keiner außer mir das nächtliche Hufgetrappel gehört hatte.
»Vielleicht hast du’s nur geträumt«, sagte mein Vater.
Ich schüttelte den Kopf. »Könnte ja sein, dass irgendwo ein paar Pferde ausgebrochen sind«, meinte Simon. »Aber wieso sagst du, du hättest Hufgetrappel auf dem Pflaster gehört? In der Nähe des Hauses gibt’s doch nirgends einen gepflasterten Weg. Die Straße ist nur mit Schotter aufgeschüttet.«
Ich kam mir dumm vor. »Hm, vielleicht klingt es ja auf Schotter ähnlich«, erwiderte ich lahm. »Schotter ist doch auch Stein.« Plötzlich erschien alles unwirklich und ich traute meinen eigenen Wahrnehmungen nicht mehr.
Unsere Eltern hatten für den Vormittag einen Termin mit Lady Lukas, der Besitzerin des Herrenhauses, vereinbart, um sich von ihr die genaue Geschichte des Spuks von Darkwood Hall sozusagen »aus erster Hand« erzählen zu lassen. So blieb es Simon und mir überlassen, ins Dorf zu gehen und Lebensmittelvorräte einzukaufen.
»Bringt auch Spülmittel mit. Und Klopapier!«, rief Mama uns nach. »Und Streichhölzer. Vielleicht kriegt ihr auch Klemmlampen. Bei den paar Funzeln in diesem Haus kann man sich ja die Augen verderben.«
»Klemmlampen!«, sagte Simon. »So was gibt’s in diesem Nest doch nie und nimmer …«
Ich war froh, als wir außer Sichtweite des Herrenhauses kamen. Nur Simon schaute sich mehrmals um und meinte, es müsste dringend renoviert werden.
»Vielleicht würde das die Gespenster vertreiben«, sagte ich.
»Vermutlich haben sie einfach keine Knete. Die meisten Adligen sind doch heutzutage total pleite.«
»Geschieht ihnen ganz recht. Schließlich haben sie jahrhundertelang die kleinen Leute ausgebeutet.«
Ich hielt nach einer Koppel mit Pferden Ausschau, doch es gab nur Weiden mit Rindern und Schafen. Schließlich kamen wir an einem Backsteinhaus im Zuckerbäckerstil vorbei, zu dem ein Grundstück gehörte, auf dem ein weißes Pferd einsam und friedlich graste.
»War’s das vielleicht?«, fragte mein Bruder, der wie so oft meine Gedanken erriet.
Ich schüttelte den Kopf. »Es müssen mehrere gewesen sein. Mindestens ein Dutzend oder so.«
Der Laden war ein Supermarkt. Es gab keine Klemmlampen, also kauften wir stärkere Glühbirnen. Auf dem Heimweg waren wir so beladen mit voll gepackten Plastiktüten, dass uns fast die Arme abfielen.
Der Weg zum Mousehole Cottage zog sich verteufelt in die Länge. Irgendwann kam ein Mädchen auf dem Fahrrad an uns vorbei. Sie mochte ungefähr in meinem Alter sein und rief uns freundlich »Hallo!« zu. Dann sah sie sich zweimal um, blieb plötzlich stehen und wartete auf uns.
»Kann ich euch helfen?«, fragte sie. »Ihr könntet eure Tüten in meinen Fahrradkorb legen und an die Lenkstange hängen.«
Ihr Englisch war völlig akzentfrei und sogar für einen nicht besonders sprachbegabten Menschen wie mich zu verstehen. Wir nahmen ihr Angebot hocherfreut an und Simon begann in seinem besten Schulenglisch mit ihr zu palavern, während ich stumm nebenhertrottete und mich fragte, ob dieses Mädchen von Natur aus so hilfsbereit war oder ob ihre Freundlichkeit etwas mit Simons blauen Augen zu tun hatte. Simon sieht ausgesprochen gut aus. Schon seit er zwölf war, liefen ihm die Mädchen scharenweise hinterher.
Sie hieß Rebecca, hatte rotblondes Haar und milchweiße Haut und einen Sonnenbrand auf der Nase. Ihre Zähne standen etwas vor. Rebecca kam aus dem Zuckerbäckerhaus. Der Schimmel im Garten gehörte ihr und war ihr zweites Pferd. All das erfuhren wir, während wir vor ihrer Gartenpforte standen.
Sie lud Simon ein, sie doch einmal zu besuchen und auf ihrem Pferd zu reiten. Mich fragte sie nicht. Doch ich hatte mich ja auch nicht mit ihr unterhalten. Simon aber hatte ihr erzählt, dass er seit zwei Jahren regelmäßig Reitunterricht nahm.
Anfangs war ich mit ihm zusammen in die Reitschule gegangen, ebenso begeistert wie er. Doch das ist ein trauriges Kapitel in meinem Leben, an das ich nicht gern zurückdenke. Denn beim ersten Ausritt stürzte ich so unglücklich, dass ich mir die Schulter ausrenkte und den rechten Arm an drei Stellen brach. Seitdem hatte ich nie wieder den Mut, auf ein Pferd zu steigen.
»Gehst du hin?«, fragte ich, während wir das letzte Stück zwischen Steinmäuerchen und Brombeerhecken entlangwanderten.
»Vielleicht. Mal sehen. Warum hast du sie nicht nach den Pferden gefragt?«
»Keine Lust. Vielleicht tu ich’s ein andermal. Wir werden sie bestimmt noch öfter sehen.«
Die Sonne kam immer wieder zwischen den Wolken hervor, doch die kantigen Türme von Darkwood Hall lagen im Schatten, versunken zwischen Rotbuchen, Eichen und Nadelbäumen. Es sah aus, als würde nie ein Sonnenstrahl bis zu den alten Mauern vordringen.
Unwillkürlich überlief mich ein Schauder, als könnte ich die düstere Kälte spüren, die das Haus umgab. Und doch war Sommer, Mitte August, die wärmste Zeit des Jahres.
Mousehole Cottage sonnte sich im Schutz der Parkmauer. Ein Rotkehlchen flötete in den Geißblattranken und im Garten blühten weiße Malven.
Als unsere Eltern zurückkamen, waren sie total aufgekratzt und platzten vor Mitteilungsdrang. Wir kannten diesen Zustand. Er endete spätestens dann, wenn Mama sich an ihre Reiseschreibmaschine setzte und die Schauergeschichten zu Papier bringen musste. Dann hing sie stöhnend herum und benahm sich wie ein Huhn, das Probleme beim Eierlegen hat.
»Diese Lady passt wie angegossen in dieses Gemäuer«, sagte mein Vater. »Lang und dünn und pferdegesichtig. Die wird eines Tages selbst dort herumspuken, darauf gehe ich jede Wette ein.«
»Ich habe selten jemanden erlebt, der so glaubwürdig von einem Spuk berichtet hat wie sie«, bemerkte Mama. »Gut, dass ich daran gedacht habe, das Tonband mitlaufen zu lassen. Ich werde wortwörtlich zitieren, was sie gesagt hat.«
»Vielleicht ist sie ganz einfach geschäftstüchtig.« Mein Vater griff nach der Whiskyflasche. »Ein Teil des Hauses ist ja für Besucher geöffnet und der Spuk lockt jede Menge Leute an. Ohne das Geld, das die Familie mit ihren Gespenstern verdient, hätte die Lady ihren Besitz wahrscheinlich längst verkaufen müssen.«
»Worum geht’s denn überhaupt?«, fragte Simon. »Ein kopfloses Gespenst, das verzweifelt die Hände ringt? Gefangene, die mit Ketten rasseln und im Chor heulen?« Seine Stimme klang nur mäßig interessiert.
»Es scheint da verschiedene Phänomene zu geben«, erwiderte Vater mit großem Ernst.
An seinem Tonfall merkte ich, dass er eine längere Rede plante und uns in allen Einzelheiten schildern wollte, welche Geister Darkwood Hall heimsuchten und auf welche Weise sie es taten.
Vielleicht brennen die meisten Menschen ja nur so darauf, Gespenstergeschichten zu hören, noch dazu, wenn sie ganz in ihrer Nähe passieren und angeblich wahr sind. Ich aber wollte eigentlich nichts von all dem wissen und bemühte mich, meine Ohren auf Durchzug zu stellen.
Natürlich gelang es mir auch diesmal nicht. Im Gegenteil, ich lauschte wieder wie gebannt auf jedes Wort, das meine Eltern erzählten.
Sie liebten es beide, spannende und unheimliche Geschichten zu erzählen; das mussten sie wohl auch bei ihrem Beruf. Dass sie häufig gleichzeitig reden wollten, machte das Zuhören nicht gerade einfach. Es konnte passieren, dass sie immer lauter und lauter wurden, um sich gegenseitig zu übertönen, oder einer warf dem anderen vor, etwas auszulassen oder völlig falsch wiederzugeben.
»Diese Tussi …«, begann mein Vater; es war einer seiner Lieblingsausdrücke, er hatte ihn von Simon und mir.
»Die Herzogin«, verbesserte Mama. »Ihre Familie lebt schon seit mehreren Jahrhunderten auf Darkwood Hall …«
»Acht Generationen«, sagte Vater. »Und es muss eine ziemlich hinterhältige, blutrünstige Sippe gewesen sein. Wenn man sich nur die Porträts in der Ahnengalerie ansieht, kann einem schon das Gruseln kommen, auch ohne dass man weiß, was sich in diesem Gemäuer so alles abspielt …«
»Du musst unbedingt einige davon fotografieren«, warf Mama ein. »Das hat sie dir doch erlaubt, oder?«
»Nicht ausdrücklich. Aber ich denke, ich kann sie schon überreden.«
Mein Vater sah noch ganz gut aus. Vermutlich ist er Simon einmal sehr ähnlich gewesen, als er jünger war und den Whisky noch nicht entdeckt hatte. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man die Spuren des Alkohols schon in seinem Gesicht.
»Sie ist meinem Charme auf der Stelle erlegen, hast du das bemerkt?« Er lachte leicht und statt einer Antwort nutzte Mama die Gelegenheit, um mit ihrer Version der Spukgeschichten zu beginnen.
»In Darkwood Hall sind schon eine ganze Reihe von unheimlichen Erscheinungen beobachtet worden«, sagte sie. »Offenbar gibt es kaum einen Raum im Haus, in dem es nicht schon gespukt hat. Vor allem in zwei Zimmern passieren immer wieder unerklärliche Dinge.«
»Im Speisezimmer haben sich ja auch im vorigen Jahrhundert allerhand tragische Ereignisse zugetragen!«, rief mein Vater. »Die beiden Brüder zum Beispiel, die sich gegenseitig erschossen, weil sie die gleiche Frau liebten …«
» … Lady Lukas hat uns sogar den Blutfleck gezeigt, der angeblich seitdem auf dem Dielenboden ist und sich nicht mehr entfernen lässt«, redete Mama dazwischen. »Außerdem gibt es da hinter der Vertäfelung eine verborgene Nische, von der aus ein Geheimgang in die Kellerräume führt. An dieser Stelle soll mehrmals ein Mann aufgetaucht sein, sogar mitten am Tag, der durchs Speisezimmer ging und durch die Wand in der Nische wieder verschwand.«
»Hat ihn schon mal einer fotografiert?«, fragte Simon.
»Nein«, sagte Vater. »Aber ich werde Lady Lukas fragen, ob ich mich in den nächstenTagen mal für ein paar Stunden in ihrem Speisezimmer aufhalten darf. Ich muss den Raum sowieso genau ausleuchten und von allen Blickwinkeln fotografieren …«
»Und du denkst, dieser Typ taucht ausgerechnet dann auf, wenn du da herumtaperst?« Simon zwinkerte mir zu.
»Man kann nie wissen. Es ist immerhin eine Chance.«
Mama fuhr fort: »Viel interessanter ist meiner Meinung nach dieses Schlafzimmer, das Lady Lukas selbst als junges Mädchen bewohnt hat. Eines Nachts wachte sie durch das Zuschlagen einer Tür auf; sie war damals etwa so alt wie du, Bella. Die Vorhänge waren nicht zugezogen und im Mondlicht sah sie einen Mann zum Fenster stürmen. Er machte einen furchtbar wütenden Eindruck. Seine Schritte waren auf den Dielen deutlich zu hören. Sie erinnert sich auch an seine lauten, keuchenden Atemzüge.«
»Lady Lukas war natürlich wie gelähmt vor Schreck. Sie konnte sich nicht bewegen, schwört aber, dass sie bei vollem Bewusstsein war. Der Mann stand kurz am Fenster, kehrte dann um und ging in die Mitte des Zimmers zurück. Sie begriff, dass er sie nicht sah oder nicht sehen konnte. Sekunden später war er verschwunden«, erzählte Vater weiter.
»Aber was mich am meisten beeindruckt hat«, fügte Mama hinzu, »war ihre Bemerkung über den Boden und die Tür. Sie sagte, sie hätte deutlich erkannt, dass die Erscheinung über einen ›anderen‹ Boden ging. Sie hörte die Schritte des Mannes auf den Dielen eines Holzbodens, während der Raum, in dem sie schlief, mit Teppichen ausgelegt war. Und auch die Tür, die der Mann zugeschlagen hatte, gab es längst nicht mehr. Der Raum war im Lauf der Zeit mehrfach verändert worden; man hatte etwa ein Drittel davon durch eine Trennwand abgeteilt, um einen zusätzlichen Flur zu schaffen. Es war jetzt nur noch eine Glastür im Zimmer. Der Mann aber hatte eine schwere Eichentür zugeschlagen. In dieser Nacht, als die Gestalt erschien, war Lady Lukas der Raum auch bedeutend größer vorgekommen als für gewöhnlich.«
Vater unterbrach sie wieder. »Was ja bedeuten würde, dass Lady Lukas damals in eine frühere Zeit zurückversetzt war – in die Zeit nämlich, als dieser Mann lebte und der Raum noch anders aussah und anders eingerichtet war.«
Mir wurde immer unheimlicher. Ich wäre am liebsten aufgestanden und aus dem Haus gegangen, hinaus in den Sonnenschein, um nichts mehr hören zu müssen. Fast gegen meinen Willen blieb ich sitzen und Simon, den nicht so leicht etwas erschrecken konnte, fragte: »Das ist aber doch sicher schon mehr als zwanzig Jahre her. Schläft denn heute noch einer in diesem Zimmer?«
Mama schüttelte den Kopf. »Nein, es wird nicht mehr benutzt. Lady Lukas sagt, es sei nicht bewohnbar. Bedienstete behaupten, sie hätten manchmal auch das Schluchzen eines Kindes aus diesem Raum gehört.«
»Ich habe gefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass ich mal eine Nacht da verbringe, aber das wollte sie nicht«, fügte mein Vater hinzu.
»Vielleicht, weil es ja überhaupt nicht echt spukt«, meinte Simon. »Womöglich hat Ihre Gnaden Angst, man könnte nachweisen, dass die ganzen Schauergeschichten frei erfunden sind. Sie lebt schließlich davon.«
Mama zündete sich eine Zigarette an. »Nein, du, das glaube ich nicht. Erstens ist es sowieso fast unmöglich zu beweisen, dass es einen Spuk nicht gibt. Und zweitens ist an der Sache wirklich etwas dran, ich spür’s in meinen Knochen. Übrigens soll Darkwood Hall auf den Resten eines keltischen Heiligtums erbaut worden sein. Die Kelten nannten ihre heiligen Plätze ›Grenze‹. Es waren gefährliche Orte, wo man unversehens von der Wirklichkeit in eine übernatürliche Welt stolpern konnte, wenn man nicht aufpasste.«
Vater machte ein nachdenkliches Gesicht. »Der Herrensitz scheint ja tatsächlich eine Art Spukzentrum zu sein – es gibt da eine Menge von verschiedenartigen Erscheinungen, die offenbar nichts miteinander zu tun haben, sondern auf ganz unterschiedliche Begebenheiten aus mehreren Jahrhunderten zurückgehen. Zum Beispiel dieser Geist in Reitkleidung, der ab und zu durch eine Wand in der Bibliothek tritt, hinter der sich eine längst zugemauerte Treppe befindet.«
Während er Luft holte, fügte Mama rasch hinzu: »Unten in der Cafeteria, die Lady Lukas für Besucher eingerichtet hat, ist auch schon mehrmals das wilde Getrappel von Pferdehufen gehört worden.«
»Pferdehufe?«, wiederholte ich. Meine Stimme klang dünn.
Meine Eltern sahen mich an. Ihre Blicke waren plötzlich höchst interessiert, so als hätten sie eine ganz neue, überraschende Seite an mir entdeckt.
»Ja, das ist in der Tat recht merkwürdig«, äußerte mein Vater. »Du hast ja auch nachts dieses Hufgetrappel gehört …«
Wenn ich jetzt gesagt hätte, dass ich mich unbehaglich fühlte, wäre das gewaltig untertrieben gewesen. Simon merkte es als Einziger.
»Seht sie nicht an wie eine Henne, die goldene Eier legt!«, sagte er. »Und überhaupt, für heute reicht’s mit dem Horrorszenario. Komm, Bella, wir gehen ins Dorf, Eis essen.«
Unterwegs trafen wir Rebecca. Das heißt, wir trafen sie nicht, sie tauchte vielmehr hinter dem Gartentor auf, als wir vorbeigingen, und wir luden sie zum Eis ein.
Sie kam mit, wie sie war, in ihrer Reithose und in eine Wolke von Stallgeruch gehüllt. Klar, dass wir schon nach zehn Minuten über Darkwood Hall redeten. Rebecca kannte natürlich alle Gerüchte, die in St. Mary in the Woods über den Spuk im Herrenhaus verbreitet wurden.
»Die Lady ist selbst nicht ganz richtig im Kopf«, sagte sie und tippte sich dabei an die Stirn. »Meschugge, durchgedreht. Ihr Mann ist ihr schon vor Jahren weggelaufen, weil er in diesem Bunker nicht mehr leben wollte. Eins ihrer Kinder ist als Baby plötzlich in einem dieser komischen Zimmer gestorben. Und ihr Sohn ist nach Kanada abgedüst. Aber sie ist einfach nicht bereit, Darkwood Hall aufzugeben.«
»Vielleicht kriegt sie’s ja nicht los«, meinte Simon. »Und ich nehme an, sie lebt davon.«
»Klar würde sie die Hall loskriegen. Es waren schon allerhand Leute da, die ihr jede Menge Geld dafür geboten haben. Eine Filmfirma und irgend so ein stinkreicher Japaner …«
Ich feilte an einem Satz. Endlich brachte ich ihn heraus.
»Vielleicht gehören das Haus und der Spuk ja für sie zu ihrem Leben und ihrem Schicksal«, sagte ich.
Rebecca musterte mich überrascht. Vermutlich wunderte sie sich, dass ich überhaupt mehrere zusammenhängende Worte sprechen konnte, noch dazu in verständlichem Englisch. Dann schüttelte sie den Kopf.
»Wie kann man mit Gespenstern leben wollen?«, fragte sie.
»Die Menschen sind verschieden«, sagte Simon. »Glauben denn die Leute im Ort, dass an den Spukgeschichten etwas Wahres ist?«
»Sicher. Es gibt ja ein paar, die selbst schon einiges davon mitbekommen haben. Bedienstete aus der Hall, die im Dorf leben. Den Mann in Reituniform hat die Mutter unserer Putzfrau selbst gesehen, als sie noch jung war und da oben sauber gemacht hat.«
»Gibt es auf Darkwood Hall Pferde?«, fragte ich.
»Jetzt nicht mehr. Früher hatten sie wohl mal einen großen Reitstall. Die Überreste kann man noch sehen. Es gab bestimmt Platz für zwanzig Pferde. Der Urgroßvater von Lady Lukas war ein leidenschaftlicher Reiter. Vielleicht ist das ja auch der Typ, der ab und zu mal in der Bibliothek auftaucht.«
»Stimmt es, dass man in der Cafeteria gelegentlich Hufgetrappel hören kann?«, wollte Simon wissen.
»Ja, klar, eine Freundin hat es selbst gehört, als sie letzten Sommer mit ihren Eltern zu Besuch hier war und die Hall besichtigt hat. Sie sagt, es klang total gruselig, so, als würde ein ganzes Heer von Reitern über den Schlosshof galoppieren. Aber als sie aus dem Fenster sahen, war da kein einziges Pferd, nur die parkenden Autos.«
In der folgenden Nacht schlief ich kaum. Ich lag in dem zu kurzen Bett und wartete und lauschte. Das Licht ließ ich brennen.
Stunde um Stunde verging, doch nichts geschah. Ich hörte die Geräusche der Nachttiere – die Rufe der Käuzchen, das Gebell der Füchse, den entsetzten Schrei eines Vogels, der von einem Raubtier getötet wurde. Aber kein Hufschlag erklang, weder um Mitternacht noch später, als die Zeiger meiner Armbanduhr auf zwei standen. Und als gegen fünf Uhr morgens der erste Hahn krähte, wusste ich, dass die Nacht um war, und schlief endlich ein.
Beim Frühstück stand ich für kurze Zeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
»Hast du etwas gehört?«, fragte mein Vater, sobald ich noch ziemlich schlaftrunken auf die kleine Terrasse trat, wo Simon und meine Eltern in der Morgensonne saßen.
Ich schüttelte den Kopf und gähnte.
»Versprich, dass du uns sofort weckst, falls sich in den kommenden Nächten irgendetwas Außergewöhnliches tut!«, schärfte Mama mir ein und fügte, an meinen Vater gewandt, hinzu: »Vielleicht entwickelt Bella ja einen Draht für übersinnliche Dinge, jetzt, wo sie in der Pubertät ist.«
»Besten Dank, darauf kann ich gern verzichten«, murmelte ich.
Der Tee schmeckte scheußlich. Meine Mutter kann überhaupt nicht kochen, nicht einmal Tee oder Kaffee.
»Wenn man zur Spökenkiekerei veranlagt ist, ist man es, ob man will oder nicht«, belehrte mich mein Vater und biss genüsslich in sein Toastbrot.
Nachmittags ging Simon zu Rebecca, um auf ihrer Stute Lilybeth zu reiten. »Komm doch mit!«, sagte er, aber ich hatte keine Lust und fühlte mich auch nicht eingeladen. Ich nahm meinen Fotoapparat und wanderte los, wobei ich mich möglichst weit von Darkwood Hall entfernte. Doch als ich auf einen kleinen Hügel stieg, um die weiten, geschwungenen Wiesen, die sanften Anhöhen und die Schafweiden zwischen den Hecken zu fotografieren, sah ich das Herrenhaus unter mir aufragen.
Die Bäume bildeten eine Art kreisförmigen Schutzwall um die grafitgrauen Steinmauern. Das Haupthaus war sehr hoch; mit seinen zwei klobigen Türmen wirkte es wie eine Wehrkirche oder ein Kloster. Die niedrigeren Seitengebäude zur Rechten und Linken waren wohl erst später angebaut worden.
Der Widerschein des Sonnenlichts ließ einige der Fenster geheimnisvoll aufblitzen. Efeu überrankte die Türme. Ich sah Raubvögel darüber kreisen und irgendwo zwischen dem Gewirr von Erkern und Dachvorsprüngen verschwinden; vielleicht waren es Turmfalken, die dort ihre Nester hatten.
Ich versuchte in die andere Richtung zu schauen und das Flüsschen zu fotografieren, das sich friedlich zwischen Wiesen und Baumgruppen schlängelte, doch es gelang mir nicht. Immer wieder kehrte mein Blick zu Darkwood Hall zurück und schließlich fing ich an, drei oder vier Fotos davon zu machen, fast ohne es zu wollen, so als hätte jemand meine Hand geführt.
Abends kamen unsere Eltern sehr zufrieden von Darkwood Hall zurück. Vater hatte mehrere Filme verknipst und Mama suchte nach einem hellen Fensterplatz, um ihre Reiseschreibmaschine aufzustellen und ihren Schreibkram auszubreiten.
Simon roch nach Pferd und beklagte sich darüber, dass Vater die Hälfte des Badezimmers zu einer Dunkelkammer umfunktioniert hatte, sodass er die Badewanne nicht benutzen konnte.
»Spätestens heute Nacht kriege ich einen teuflischen Muskelkater«, sagte er. »Ich bin mindestens vier Wochen nicht mehr geritten.«
»War’s denn schön?«, fragte ich.
»Lilybeth ist ein gutes Reitpferd, aber ziemlich schreckhaft. Beinahe wäre sie über die High Street gebrettert, nur weil uns auf dem Weg zu Rebeccas Haus ein Huhn begegnet ist.«
Weil keiner von uns Lust hatte zu kochen, gingen wir in die Dorfkneipe und aßen Fisch und Pommes mit viel fetter Majonäse. Ein paar ältere Männer, die an einem Tisch beisammensaßen, musterten uns verstohlen. Meine Eltern überlegten, wie sie ihre Story vom Spuk von Darkwood Hall am besten aufziehen sollten.
»Ich bin für den keltischen Aufhänger«, sagte Mama. »Das gibt dem Artikel einen ganz besonderen, ungewöhnlichen Touch.«
»Dass Darkwood Hall an einem Ort steht, der den Kelten heilig war, meinst du?« Vater nickte nachdenklich. »Ja, das ist keine üble Idee. Heutzutage, wo die Leute so auf Mystik und Esoterisches abfahren …«
»Über die Pferde von Darkwood Hall gibt es eine alte Geschichte«, sagte Simon auf dem Heimweg, als wir den dunklen Pfad zwischen Brombeerhecken und Haselnusssträuchern entlanggingen. »Rebecca hat sie von ihrer Granny erfahren. Sie haben wohl gestern Abend noch darüber geredet, dass ihr hier seid, um diesen Artikel zu schreiben.«
»Davon hat Lady Lukas uns noch nichts erzählt. Was ist das für eine Geschichte?«, fragte Mama sofort.
Zwischen den Türmen von Darkwood Hall hing der Mond als bleiche Sichel. Es sah aus wie auf einem Gemälde, düster und verlassen, vor allem aber unwirklich.
»Zur Zeit des Bürgerkriegs, um 1650 herum, muss sich hier im Herrenhaus ein kleiner Trupp königstreuer Offiziere versteckt gehalten haben. Offenbar wurde ihr Aufenthaltsort verraten und eine Schar parlamentarischer Soldaten drang in Darkwood Hall ein. Die Royalisten flohen durch einen Geheimgang hinunter in den Stall, schwangen sich auf ihre Pferde und ritten davon, aber die Soldaten verfolgten sie. In einem Waldstück, nicht weit von der Hall entfernt, soll es dann ein wildes Gemetzel gegeben haben, bei dem alle königstreuen Offiziere erschossen und erstochen wurden. Auch ihre Pferde kamen im Kugelhagel um«, berichtete Simon.
»Vielleicht ist das ja die Erklärung für Bellas Hufgetrappel.« Das kam von meinem Vater.
Ich stolperte über eine Wurzel, fiel hin und schlug mir das Knie auf. Simon zog mich hoch und hakte sich bei mir unter.
»Nur keine Panik«, sagte er. »Falls du wirklich etwas von dem Spuk mitgekriegt hast, dann bist du nicht die Einzige. Offenbar haben schon jede Menge Leute das Getrappel gehört und noch keinem ist was passiert.«
Das beruhigte mich. Erst als ich in meinem Zimmer war, bekam ich es wieder mit der Angst zu tun. Ich schloss das Fenster, ließ die Nachttischlampe brennen und bereitete mich auf eine weitere schlaflose Nacht vor.
Simon hatte gesagt, ich sollte an die Wand klopfen, wenn sich etwas tat; aber ich wusste, wenn er einmal schlief, war er nicht so leicht wieder wach zu kriegen.
Und dann war ich selbst so müde, dass ich eindöste. Im Traum irrte ich durch ein Labyrinth unterirdischer Räume und floh schließlich vor einem bedrohlichen Wesen, das kein Gesicht und keinen Namen hatte, in einen dunklen Wald. Erst nach einer Weile merkte ich, dass es ein Wald unter Wasser war. Die Bäume wuchsen auf dem Grund eines tiefen Sees und mitten im Wald war ein Kreis riesiger Steine aufgerichtet, durch die Licht in silbernen Bündeln flutete.
Als ich zum Frühstück kam, saßen nur Mama und Simon am Tisch. Mein Vater war schon unterwegs.
»Er hat sich vorgenommen, den Stein im Park von Darkwood Hall zu jeder Tageszeit zu fotografieren«, erklärte Mama.
»Welchen Stein?«, fragte ich.
»Ach, da gibt es einen riesigen, behauenen Felsbrocken, der noch aus keltischer Zeit stammen soll. Er ist mit rätselhaften Mustern versehen, eingeritzten Sonnenrädern oder Augensymbolen. Lady Lukas meint, er hätte einmal zu einem magischen Steinkreis gehört«, sagte Mama, ehe sie sich an ihre Schreibmaschine setzte.
Ich musste sofort an meinen Traum denken, erwähnte aber nichts davon. Simon machte sich wieder auf den Weg zu Rebecca und Lilybeth. Diesmal, sagte er, hätte sie uns ausdrücklich beide eingeladen.
»Sehr gnädig und huldvoll«, murmelte ich. »Aber ich sehe mich lieber ein bisschen in der Gegend um.«
»Willst du nach Darkwood Hall?«, fragte Simon.
Ich schüttelte den Kopf. Obwohl ich es nie zugegeben hätte, ärgerte es mich, dass mein Bruder seine Zeit nicht mit mir verbrachte, wie er es sonst bei gemeinsamen Ferienreisen immer getan hatte. Ich fand Rebecca weder besonders hübsch noch interessant. Aber vielleicht ging es Simon ja wirklich nur um Lilybeth und die Gelegenheit zum Reiten.
Ziemlich verbissen marschierte ich in Richtung Dorf und schlug dann eine Abzweigung nach rechts über einen Feldweg ein. Eine Brücke führte über das Flüsschen, wo ein halb verfallenes Mühlengebäude mit eingesunkenem Dach stand. Zwischen lose aufgeschichteten Steinmäuerchen, überschattet von mächtigen Eichen, kam ich schließlich zu einer Buckelwiese, auf der Schafe weideten.
Ein leichter, linder Wind säuselte in den Baumwipfeln. Als ich am Zaun der Schafweide vorüberkam, trat plötzlich ein steinalter Mann aus dem Gebüsch, begleitet von zwei zottigen Hunden, einem braunen und einem schwarzen.
Die Hunde gaben keinen Laut von sich, beobachteten mich nur aufmerksam mit ihren bernsteinfarbenen Augen. Der alte Mann nickte mir zu und ich sagte »Hallo«, worauf er stehen blieb und mich ebenso eindringlich musterte wie seine Hunde. Er trug einen grauen Umhang und hatte verfilzte graue Locken. Haare wuchsen in seinen Ohren. Ein durchdringender Schafsgeruch ging von ihm aus.
Ich dachte, dass Menschen, die in der Natur leben, anders aussehen als Städter. Nicht nur wegen des unterschiedlichen Outfits. Ihre Gesichter, ihre Bewegungen, ihre ganze Ausstrahlung, einfach alles ist anders. Und noch während mir das durch den Kopf ging, begann der Schäfer mit mir zu reden. Das heißt, es war eher ein Selbstgespräch, denn ich verstand ihn nicht. Er hatte fast keine Zähne mehr und sprach noch dazu einen Dialekt, den man auf keiner deutschen Schule lernt. Das einzige Wort, das mir bekannt vorkam und das ich zu verstehen glaubte, war »beware«.
Zuletzt deutete er mit seiner braunen, schwieligen Hand in nördliche Richtung. Eine Warnung war in seinem Blick – oder bildete ich mir das nur ein?
Vermutlich machte er sich Sorgen um seine Schafe und wollte mir zu verstehen geben, dass ich keines der Gatter offen lassen durfte, die auf meinem Weg lagen. Damals reimte ich mir das so zusammen, aber heute glaube ich es nicht mehr. Heute bin ich sicher, dass er mich wirklich vor etwas warnen wollte. Und wenn ich ihn verstanden hätte, wäre ich wohl keinen Schritt weitergegangen.
Ich erinnere mich noch, dass ich wenig später an einen Zauntritt kam, über den ich klettern musste. Dabei schaute ich mich um und da stand er noch mit seinen Hunden und sah mir nach.
Die Schafe blökten, ich hörte den Wind in den Bäumen raunen und ein Raubvogel schrie, der über den Schafweiden kreiste. Doch als ich das Wäldchen erreichte, war unvermittelt alles reglos wie unter einer Glasglocke und seltsam dämmrig. Tau lag auf den Blättern und den silbernen Spinnwebfäden, die sich von Zweig zu Zweig spannten.
Das Wäldchen bestand aus einem dicht ineinander verwobenen Gespinst von Brombeerranken, Wildrosensträuchern und mit Waldreben verhangenen, riesigen Bäumen. Wie ein Tunnel führte der Pfad in dieses grüne, kühle Gewölbe aus Laub und Zweigen.
Obwohl ich gerade noch den Wind auf meiner Haut und in meinen Haaren gespürt hatte, war es hier vollkommen windstill. Kein Blatt bewegte sich, kein Vogel huschte im Geäst, keine Tiere raschelten im Laub, das den Waldboden bedeckte.
Unwillkürlich hielt ich den Atem an. Ich wollte umkehren, doch etwas zog mich weiter, ein Drang, der nichts mit Neugier oder Abenteuerlust zu tun hatte. Dann, in all der Stille und Reglosigkeit, an diesem Ort, der wie das Innere eines Zauberbergs war, nahm ich plötzlich einen Geruch wahr, den ich kannte: den scharfen, aber angenehmen Geruch nach Pferden.
Der Pfad führte jetzt steil bergab. Als ich um die nächste Wegkrümmung kam, sah ich in einer Senke, halb verborgen zwischen Eichen und Rotbuchen, eine Gruppe von Reitern mit ihren Pferden.
Die Pferde standen dicht gedrängt, streckten die Köpfe vor, kauten am Gebiss, tänzelten unruhig. Seltsam aber waren die Reiter. Sie trugen Uniformen und an Stelle von Reithelmen wunderlich geformte Hüte. Doch was vor allem meine Aufmerksamkeit erregte, war die Anspannung, die von ihnen ausging.
Stumm saßen sie auf ihren Pferden, sahen alle in eine Richtung, weg von mir, und schienen aufmerksam zu lauschen. Einer von ihnen hatte die Hand erhoben und deutete nach links. Mich nahmen sie offensichtlich nicht wahr.
Die Art, wie sie sich da im Dämmerlicht des Dickichts zusammendrängten, sich zwischen den Bäumen verbargen, jagte mir eine ganze Serie von Schaudern über den Rücken. Ich spürte, dass sie Angst hatten – ja, eine schreckliche Furcht ging von ihnen aus, hing wie eine Wolke über ihnen und übertrug sich auch auf mich.
Ich trat einen Schritt zurück, in den Schutz eines überhängenden Strauches. Mein Mund war plötzlich trocken, meine Hände zitterten. Eines der Pferde schnaubte.
Wieder wollte ich umkehren und den Weg zurücklaufen, so schnell ich konnte, doch aus Angst, mich zu verraten, blieb ich und beobachtete, wie einer der Reiter etwas Merkwürdiges tat: Er schwang sich vom Pferd, trat zwischen den Baumstämmen hervor, kniete auf dem Pfad nieder und legte den Kopf seitlich auf den Boden.
Ich dachte: Das gibt es nicht, das ist nur ein verrückter Traum! Und doch stand ich da, roch die Pferde, spürte die Zweige und taufeuchten Blätter in meinem Nacken. Und dann, während der Mann noch dort kauerte, hörte ich jäh das ferne Trappeln von Pferdehufen und begriff, was er da machte.
In der nächsten Sekunde schon sprang er auf. Die Reiter – es waren ungefähr ein Dutzend – wechselten geflüsterte Worte. Ich hörte nicht, was sie sagten, sah nur, wie sich ihre Lippen bewegten.
Dann hielten sie plötzlich Waffen in den Händen – lange, blitzende Degen oder Bajonette und auch ein paar altmodische silberbeschlagene Handfeuerwaffen, die wie eine Mischung zwischen Gewehr und Pistole wirkten.
Das Hufgetrappel wurde lauter, schwoll bedrohlich an wie eine Woge, die übers Meer rollt und gegen Uferfelsen donnert. Ein Teil von mir wusste, dass das Geräusch Unheil und Tod bedeutete, so, als wäre ich einer der Reiter dort unten und teilte ihr Geheimnis. Und doch hatte ich keine Ahnung, worum es ging, konnte die Panik nicht erklären, die sich immer stärker in mir ausbreitete.
Eines der Pferde wieherte schrill. Mich durchzuckte der Gedanke, dass es uns verraten hatte. Denn jetzt wussten sie, wo wir waren, und nichts konnte sie mehr aufhalten.
Endlich löste sich der Bann, der mich lähmte. Ich wandte mich ab und rannte den Weg zurück, den ich gekommen war, ohne mich noch einmal umzuschauen, ohne mich darum zu kümmern, ob die Reiter mich sahen, stolpernd und keuchend und nur von dem Gedanken beherrscht zu fliehen, ehe sie das Wäldchen erreichten.
Das Blut rauschte in meinen Ohren und übertönte das Klappern der Hufe. Doch als ich das Ende des grünen Tunnels vor mir sah und den Waldrand fast erreicht hatte, erklang ein Schuss.
Ein zweiter folgte, eine ganze Serie von Schüssen, die irgendwo hinter mir, in der Tiefe des Dickichts, mit pfeifendem, peitschendem Ton die sommerliche Luft durchschnitten.
Blindlings raste ich weiter. Und kaum hatte ich die Grenze des Wäldchens überschritten, war plötzlich alles wie verwandelt. Stille und Frieden umfingen mich; ich hörte nichts als das Singen der Lerchen und das ferne Blöken der Schafe. Die Sonne schien und ein warmer Wind, der nach Gras und Sommerblumen duftete, strich über mein Gesicht.
Kein Schuss war mehr zu hören, kein Getrappel von Pferdehufen, kein Gewieher. Trotzdem wagte ich noch immer nicht, mich umzusehen, jetzt nicht und auch nicht während der ganzen Wegstrecke zurück zum Mousehole Cottage.
Der Einzige, dem ich erzählte, was ich erlebt hatte, war Simon. Am selben Abend saßen wir auf der Bettkante in seinem Zimmer und er sagte: »Das muss ich mir ansehen. Gleich morgen früh gehen wir gemeinsam hin!«
Da gibt es nichts mehr zu sehen, sie sind alle längst tot!, ging es mir durch den Sinn, doch ich sprach es nicht aus. Ich wollte nicht wieder zum Wäldchen zurück; zugleich aber lag mir viel daran, dass Simon mir glaubte; und ich hoffte, dass ich vielleicht alles begreifen würde, wenn er bei mir war.
Doch manche Rätsel lassen sich niemals lösen. Wir gingen am nächsten Morgen den gleichen Weg, über die Brücke, an dem verfallenen Mühlengebäude und der Schafweide vorbei, kletterten über denselben Zauntritt. Das Wäldchen aber fanden wir nicht, so lange wir auch danach suchten.