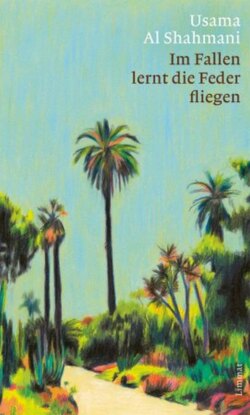Читать книгу Im Fallen lernt die Feder fliegen - Usama Al Shahmani - Страница 5
Bruchholz
ОглавлениеIch habe arabische Musik gehört, doch nach einer gewissen Zeit musste ich sie abstellen. Auch die Filmkomödie, die ich aus der Bibliothek mitgenommen hatte, brachte ich nicht zu Ende. Drei Tage sind vergangen, seit Daniel abgereist ist. Die Wohnung fühlt sich fremd an ohne ihn. Alles scheint seltsam und distanziert, sogar mein Lieblingsstuhl, auf dem ich immer lese. Ich bin einsam wie ein Stein, der von der Decke einer dunklen Bühne fällt.
Auch meine Bücher helfen mir dieses Mal nicht. Das Lesen als Rettungsring habe ich früh entdeckt. Meine Mutter hatte nur erstaunt zugesehen, wie ich mich über die Bücher beugte und eins nach dem anderen verschlang. Damals vor allem Jugendromane, aber ich las alles, was mir unter die Augen kam, ich vertiefte mich so auch in die deutsche Sprache. Mein Vater ärgerte sich, wenn meine Schwester und ich mit einem Gemisch aus Deutsch und Arabisch untereinander sprachen. «Ihr müsst richtig Arabisch reden und nicht ständig in dieser Sprache palavern.»
Ich liebe es mehr, auf Arabisch zu schreiben als zu lesen. Wenn ich den Kugelschreiber von rechts nach links gleiten lasse, versuche ich, den Buchstaben viel Raum anzubieten auf dem weiten Papier. Mein Vater hatte uns viel von der Kunst der arabischen Kalligrafie beigebracht. Er hatte kleine Texte und Gedichte gezeichnet. «Jedes Mal, wenn ich einen Text mit dem Wort watan, Heimat, schreibe, habe ich das Gefühl, dass der Euphrat mitten durch das Papier fließt. Der Euphrat bewässert die Buchstaben, reißt die traurigen Worte in seinem Strom mit und lässt die Verben leuchten wie das Spiegelbild der Sterne auf dem Fluss, wenn er zur Ruhe gekommen ist», schrieb er. Ich beobachtete ihn und las wie er. Einmal betrat mein Vater den Raum, als ich gerade einem imaginären Publikum eine seiner Handschriften vorlas. Ich fühlte mich ertappt, und es war mir peinlich. Aber er lachte nur herzlich, weil er bemerkt hatte, dass ich meine Kuscheltiere als Publikum versammelt hatte und ihnen das arabische Gedicht vortrug.
Heute noch tue ich das manchmal. Ich sage laut Gedichte auf und stelle mir das Publikum dazu vor. Oder ich trage sie Bäumen vor oder Spielzeugen, welche die Kinder in einem Sandkasten vergessen haben, oder leeren Stühlen im Gruppenraum der Bibliothek oder Tieren auf einem Spaziergang. Hauptsache ein Publikum, das mich nie fragt, seit wann ich in der Schweiz bin oder wo meine Familie ist. Ein Publikum, das versteht, dass das Wort watan für mich trocken bleibt, egal wie viele Flüsse hindurchfließen. Beim Vortragen sehe ich das Gesicht meines Vaters vor meinen Augen.
Gestern Abend habe ich diese alte Gewohnheit wieder aufgenommen. Ich habe meinen arabischen Gedichtband hervorgeholt und darin gelesen. Aber auch hier fand ich keine Ruhe, ein Gefühl der Entfremdung hatte mich erfasst. Ich nahm mein Handy und schrieb Daniel eine SMS: «Lieber Daniel, ich hoffe, du bist gut angekommen. Danke für deine kurze Nachricht. Ich vermisse dich, doch das ist nicht das Einzige, was mich antreibt, dir jetzt zu schreiben. Deine Worte beschäftigen mich. Dass die Ehrlichkeit selten sei und dass eine Beziehung ohne diese es nicht wert sei, weiterzubestehen. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin ehrlich. Was willst du denn von mir wissen? Die Vergangenheit schreit in meinem Kopf wie ein verletzter Wolf, jede Nähe zu ihm signalisiert mir Gefahr.»
Doch anstatt «Senden» zu drücken, löschte ich die Nachricht wieder. Ich musste nach Frauenfeld, sagte ich mir und beschloss, Beyan und Katrin anzurufen. Ich brauchte jemanden, der mir zuhörte. Und wer konnte das sein außer Beyan?
Beyan ist Künstler und Geigenspieler. Wie er sich kleidet, macht ihn auffällig, unübersehbar. Als Nosche und ich Kinder waren, wünschten wir, dass Beyan unser Vater wäre. Am Wochenende gingen wir oft abends in Begleitung von Vater zu ihm, und er unterstützte uns in Mathematik und Deutsch. Nach der Lektion erlaubte er uns, die Fotoalben in seiner Bibliothek anzuschauen. Geduldig beantwortete er alle unsere Fragen. Auch diejenigen, die mit seiner eigenen, wohl schmerzhaften Kindheit zu tun hatten.
Beyan war 1980 geflohen, weil er nicht in den Krieg wollte. Ein paar Monate lebte er mit gefälschten Papieren in Bagdad, dann gab die Partei sein Todesurteil bekannt, und der militärische Geheimdienst begann, ihn zu suchen. Er tauchte unter und verließ bald den Irak. «Dank der mutigen Hilfe einer Verwandten gelang mir die Flucht. Ich glaube, ich war der erste irakische Flüchtling hier im Thurgau», erzählte uns Beyan.
Er erzählte uns auch von Bagdad, von seiner Liebe zu Kunst und Musik, dass er studieren wollte, aber leider nicht zugelassen wurde, weil er kein Baath-Parteimitglied war. Er arbeitete als Straßenkünstler in alten Quartieren der immer moderner werdenden Stadt. Mit seinen Verwandten bastelte er Drachen aus buntem Papier, die er jeden Freitagmorgen im Vogelpark verkaufte. Damit schlug er sich durch.
Wenn Beyan von Bagdad erzählte, sah er aus, als würde er von einer Geliebten sprechen. Beyan ist mutig; einmal mischte er sich ein, als mein Vater sich weigerte, Nosche und mich ins Winterlager in die Berge gehen zu lassen. Es war für uns beinahe ein Weltuntergang, weil wir die Einzigen in der Klasse waren, die zu Hause bleiben mussten. Erfolglos versuchte Beyan, unseren Vater zu überzeugen. Am Schluss sagte er zu meinem Vater: «Dein Festhalten an den irakischen Traditionen kann Schaden anrichten und die Zukunft deiner Kinder zerstören.» Dass Beyan sich auf die Seite unseres Klassenlehrers schlug, hat mein Vater ihm nicht verziehen, und er beschränkte die Beziehung zu ihm auf das Nötigste. Wir waren enttäuscht, vor allem, weil die Wochenendbesuche abrupt aufgehört hatten. Die Distanz zwischen den beiden wurde noch größer, als Beyan mit seiner Schweizer Freundin Katrin zusammenzog.
Beyan konnte die Beziehung zu Vater mit der Zeit wiederherstellen. Er besuchte uns, als Vater aus dem Spital zurückkam. Er musste sich einige Lymphknoten entfernen lassen. Vater schätzte seinen Besuch wenig und blieb zurückhaltend. «Ich will nicht, dass Katrin unser Leben von innen sieht. Wir kennen sie nicht. Wieso sollten wir ihr vertrauen? Ich mag keine Fremden in meinem Haus.»
Vater war immer auf Beyan angewiesen und hielt Respekt. Gleichzeitig war er jederzeit bereit, darauf zu verzichten. Ich hörte einmal unfreiwillig einen Dialog zwischen zwei Menschen im Zug. Ich weiß nicht, ob sie betrunken waren, es kam mir vor wie ein Theaterstück.
Der eine schrie den anderen an: «Was? Hast du mir das geschrieben, weil ich Ausländer bin?»
Der andere schwieg einige Sekunden und erwiderte dann gleichgültig: «Nein, ich hasse dich nicht, weder dich noch sonst jemanden auf dieser Welt. Doch gleichzeitig habe ich auch niemanden lieb. Das ist alles.»
Oh mein Gott! Sprach diese Person jetzt von sich oder von meinem Vater? Vater hasste niemanden. Aber ich sah ihn nie jemanden lieben. «Wir kennen uns schon seit der Kindheit. Beyan ist der einzige Freund, der mir blieb. Viele Freunde sind wie die Splitter einer Rakete, einfach verstreut und versunken», sagte Vater.
Die Freundschaft mit Beyan ist der Schatz, den mir mein Vater in der Schweiz vererbt hat.
Eine SMS von Daniel weckte mich früh auf. Er schrieb begeistert, dass ihm das Leben auf dem Hof gefiel. «Es ist nichts los hier, das macht das Leben interessant, ich freue mich sehr. Kuss, Daniel.»
Ich freute mich auf das Treffen mit Beyan und Katrin, sie hatten mich eingeladen, den Samstag bei ihnen zu verbringen.
Auf dem Weg zum Bahnhof trank ich meinen Kaffee bei einer Frau aus dem Sudan. Sie führte ein kleines Café und war immer nett, trug bunte, afrikanische Oberteile und hatte ihre Haare zu Cornrows, der afrikanischen Flechtfrisur, geflochten. Wir sprachen hocharabisch. «Hocharabisch sprechen ist komisch, es lässt Frauen männlich tönen», meinte Mutter. Diese Frau jedenfalls nicht.
Im Zug begann ich, die Menschen zu beobachten, die auf dem Bahnsteig vorbeischlenderten, vor allem die Gesichter. Eigentlich mochte ich das Beobachten anderer Leute nicht, aber diese Gewohnheit verfolgt mich seit ein paar Jahren, als wäre ich auf der Suche nach einem verschwundenen Gesicht. Versuche ich, meines in den Gesichtern anderer wiederzuerkennen? Wie fremd bin ich aus ihrer Sicht?
Beyan hatte schon am Telefon gemerkt, dass es mir nicht gut ging, ich hätte es ihm gar nicht sagen müssen, meinte er. Wie kann die Stimme dich sogar über das Telefon verraten? Ob das der Grund war, weshalb sich meine Mutter nach jedem Anruf in den Irak erst einmal zurückzog und für sich allein sein wollte?
Kurz vor Mittag kam ich in Frauenfeld an. Beyan schickte mir eine Nachricht: Er komme zehn Minuten zu spät. Die Sonne schien auf den Bahnhofplatz. Ich stand eine Weile vor dem Gleis der Wilerbahn. Wo blieb nur dieser alte, rote Zug? Offenbar hatten sie ihn durch einen modernen ersetzt? Ob noch immer ständig die Durchsage «Nächster Halt auf Verlangen» wiederholt wurde? Auf der Suche nach einer Lehrstelle fuhr ich eine Woche in ein Pflegeheim in Münchwilen. Mit diesem alten, roten Zug, der durch die Stadt fuhr und sowieso an jeder Haltestelle anhielt. Ich verstand nie, warum der Satz ständig durch die Lautsprecher schallte.
Ich mag Frauenfeld. Hier lebte ich manche Jahre. Einige Geschichten sind schön, andere eher traurig. In meinem Kopf gleichen sie herumliegendem Bruchholz, und doch gehören sie zu meinem Leben. Ich versuche, daraus ein kleines Boot zu bauen und damit zum Rhein zu segeln. «In jedem Trümmerhaufen finden sich Gegenstände, die man für einen Neuanfang brauchen kann», sagte Karima, meine Tante mütterlicherseits. Als der alte Nussbaum in ihrem Hof vom Blitz getroffen und gespalten wurde, beschloss sie, daraus eine Tür zu schreinern, um den Stall für die Tiere verschließen zu können.
Mein Blick wanderte über den Bahnhofplatz und folgte den Menschen mit ihren vollbeladenen Einkaufstaschen in den Stadtbus. Ich hatte das sichere Gefühl, dass ich das, wonach ich suchte, nie finden würde. Niemals.
Beyan erschien in einem leuchtend gelben Hemd und einer Jeansjacke und winkte mir bereits aus der Ferne mit seinem natürlichen Lachen zu.
«Ahlan wa sahlan amo Aida – herzlich willkommen!», begrüßte er mich.
«Hoi, Onkel», rief ich, und er umarmte mich. Es sei in unserer Kultur unanständig, enge Freunde der Familie mit Namen zu nennen, hatte uns Vater eingeschärft.
«Wie geht es dir? Du hast besorgt gewirkt am Telefon.» Er umarmte mich von der Seite und hielt meine Schultern fest. «Ist alles in Ordnung? Hör zu, wenn du mir etwas unter vier Augen erzählen möchtest, kann ich Katrin mitteilen, dass wir erst in einer Stunde zu Hause eintreffen.»
«Es geht mir gerade nicht so gut. Aber darüber können wir auch zu dritt reden.»
«Pass auf – wir gehen zum Wochenmarkt. Magst du noch immer das Gemüse direkt bei den Bauern kaufen? So etwas habt ihr in Basel doch sicher auch, oder?»
«Ja, ja, das mag ich noch, wir waren grad letzten Samstag dort, nicht in Basel, sondern hinter der Grenze.»
«Wie geht es Daniel, was macht er jetzt?»
«Er ist letzten Sonntagmorgen nach Graubünden gereist für den Rest seines Zivildienstes. In letzter Zeit streiten wir uns ständig. Ich glaube, unsere Beziehung wird nicht mehr lange halten.»
An der Bushaltestelle begegneten wir einer älteren Dame, und Beyan hatte ein kurzes Gespräch mit ihr.
«Sie ist unsere Nachbarin, ihre Tochter lebt aus beruflichen Gründen jetzt im Ausland und hat Heimweh, sie wollte wissen, was das beste Mittel dagegen sei.»
«Und was hast du ihr geraten?»
«Ich kenne dieses Gefühl nicht, ich weiß nicht mehr, wie es ist.»
Zu Hause empfing uns Katrin warmherzig. Sie trug eine hellgrüne Bluse und einen schwarzen Rock. Ihre Haare waren zu einem «Pferdeschwanz» hochgebunden, so wie sie meine Mutter immer trug. Sie hatte dickes Haar, und wenn sie lachte, sah man sympathische Grübchen, und ihre blauen Augen lachten mit. Ganz selten nur sah ich sie geschminkt, ihre feinen Falten im Gesicht standen ihr gut, das Alter hat ihr mehr Schönheit geschenkt. «Ein persischer Teppich ist je älter, desto schöner», sagte man von schönen Frauen im Iran. Auch wie sie ihre Wohnung eingerichtet hat, gefällt mir, jedes einzelne Stück vermittelt Stabilität in ihrem Haus, das sie von ihren Eltern geerbt hatte.
Katrin erzählt nicht viel von ihrer Familie, aber einmal erzählte sie, dass ihr Großvater Russe war. Er war als Kunsthändler in die Schweiz gekommen. In St. Gallen habe er ihre Großmutter kennengelernt. Irgendwann war er dann zurückgekehrt nach Russland. «Das Einzige, was von ihm geblieben ist, war ein Kind, das mein Vater wurde und die Liebe zu Kunst und Antiquitäten im Blut hatte.» Vielleicht hatte sie selbst deswegen Kunst und Musik studiert.
«Wie geht es dir, meine Süße? Fast ein halbes Jahr haben wir uns nicht gesehen.»
Katrin umarmte mich.
«Ja, es ist lange her, ich vermisse euch und bin froh, jetzt hier zu sein.»
Wir gingen direkt in die Küche, sie hatten Biryani gekocht, ein irakisches Gericht. Beyan meinte, er habe das Gericht ein bisschen modernisiert. Reis mit verschiedenen Gemüsesorten, Kardamom, Pistazien und irakischen Gewürzen, die er aus Bagdad geschenkt bekommen hatte. Die Joghurtsauce war mit Minze, Thymian und Koriander garniert.
«Biryani bringt Wärme, auch in der Liebe», sagte Beyan und gab Katrin einen Kuss.
«Die meisten Iraner kochen es zum Nouruz-Fest. Sie meinen, dass genau diese Mischung zum Frühling passt», sagte ich.
«Ja, das stimmt», antwortete Beyan. «Nouruz war in der alten mesopotamischen Kultur der Tag, an dem Gott Tammus geboren wird und Ischtar, die Göttin der Erde, heiratet, die dann den Frühling gebären wird. An diesem Fest wurden die Unterschiede zwischen Sklaven und Herren vorübergehend aufgehoben. Der König von Babylon gibt seinen Stolz auf, erkennt seine Fehler an und erhält eine Ohrfeige von der höchsten religiösen Autorität. Es gibt sumerische Platten, die den großen Marsch im Park des Königs zeigen, bei dem im Feuer farbige Puppen verbrannt wurden. Diese Puppen sollen den Winter repräsentieren.»
«Wie das Sechseläuten in Zürich», unterbrach Katrin lachend, «aber der Böögg hat sicher nichts mit Babylon zu tun».
«Ich weiß es nicht, aber nach der Besetzung Babylons durch die Perser wurde Naurus ein Fest in vielen Kulturen. Die Perser feierten dreizehn Tage lang, wer dieses Fest feiert, wird das ganze Jahr von Sonnenschein begleitet, sagen sie. Bei den Kurden heißt es Newroz», sagte Beyan.
«Hast du noch Erinnerungen an den Iran? Hat deine Familie dort dieses Fest gefeiert?», fragte mich Katrin und hakte gleich nach: «Wie lange habt ihr eigentlich in Ghom gelebt?»
«Ich bin ja in Ghom geboren und habe bis zu meinem sechsten Lebensjahr im Iran gelebt. Meine Erinnerungen daran sind etwas verblasst. Aber manche Bilder sind noch sehr präsent, und eines davon ist eben Nouruz. Wir feierten es mit einem irakischen Nachbarn. Es begann immer mit einem gründlichen Hausputz, dann bereitete meine Mutter ein großes Tablett vor. Man nennt es ‹Tablett der sieben S›. Alle sieben Dinge darauf beginnen auf Persisch mit dem Buchstaben S.»
«Wieso S?», fragte Beyan.
«Weil dieser Buchstabe in der persischen Kultur Liebe und Glück bringen soll. Auf dem Tablet soll sebse, also Spinat, in eine Art Vase gestellt werden und dazu semnou, eine Süßigkeit aus Weizen und Honig. Sier ist Knoblauch, was in diesem Glauben das Böse vertreibt und die Stärke fördert. Serke ist Essig, als Symbol der Geduld, senged sind Blätter der Linde, Symbol der Liebe, soummak sind Gewürze als Symbol für Wasser, damit das Jahr reich an Niederschlag ist. Das Letzte ist syeb, der Apfel, als Symbol für Fruchtbarkeit. Meine Mutter hatte dieses Tablett immer in die Mitte des Wohnzimmers gestellt, und daneben las Vater sieben Verse aus dem Koran vor, die alle mit dem Wort salam begannen. Am letzten Tag nahm uns Vater mit zu einem Park, in dem sich viele Familien versammelten und picknickten. Meine Schwester und ich gaben an diesem Ort unsere Münze aus, die wir zu diesem Anlass geschenkt bekommen hatten.»
«Was für ein schönes Fest. Du kennst alle diese Gebräuche und führst sie nicht weiter?», fragte mich Katrin.
«Na ja, wir haben jetzt Herbst», entgegnete Beyan lachend.
«Ja, vielleicht müsste ich das wirklich machen. Wer weiß, vielleicht helfen die Blätter der Linde der Liebe zwischen mir und Daniel wieder etwas beim Gedeihen.»
«Ich kenne keine Liebe ohne Schwierigkeiten. Manchmal stelle ich mir die Liebe als ein schönes Denkmal vor. Eines von denen, die ich in Rom oft gesehen habe. So schön wäre es gar nicht, wenn es die Schläge des Hammers eines Bildhauers nicht ertragen hätte. Ich bin kein guter Ratgeber in der Liebe, aber woran ich fest glaube, ist, dass die Liebe oft sehr wenig mit Vernunft zu tun hat. Weißt du, Aida, kurz nach meiner Ankunft in der Schweiz habe ich mich in eine Frau verliebt, die beim Arbeitsamt tätig war. Sie half mir sehr, einen Job zu finden. Ich füllte die Formulare entweder falsch oder unvollständig aus, damit ich länger bei ihr bleiben und ihre Augen betrachten durfte, während sie mir alles erklärte. In dieser Zeit begann ich die unerträgliche schweizerische Bürokratie zu lieben. Dank ihr konnte ich jede Woche vor meiner Geliebten stehen wie mein Kater vor mir, wenn ich aß.»
«Selbst Kater!», sagte Katrin lachend.
«Aber was ist denn bei euch los? Eure Liebe ist doch großartig! Möchtest du etwas erzählen?», fragte mich Beyan.
«Die Streitereien zwischen uns häufen sich, weil Daniel einen unerträglichen Druck auf mich ausübt. Er will mehr über meine Vergangenheit, die Geschichte meiner Familie und alles, was mich in die Schweiz brachte, erfahren. Und das in einem Ton, der wie ein Ultimatum wirkt. Das hat er zwar nicht gesagt, aber weil er mir immer und immer wieder diese Fragen gestellt hat, fühlt es sich so an. Ich habe mir meine Zukunft immer mit ihm vorgestellt. Aber jetzt hat er auch aufgehört, auf meine Wünsche einzugehen, zum Beispiel nach einem gemeinsamen Kind. Er hat mir, als wir vor vier Jahren zusammenzogen, versprochen, dass wir es nach seinem Studium versuchen werden. Aber jetzt hat er seinen Master gemacht und denkt nur an seinen Zivildienst und seinen Beruf. Ich bin verzweifelt.»
«Verzweiflung ist handgemacht», schob Beyan ein.
«Was habe ich denn gemacht?»
«Ganz am Anfang habe ich dir schon gesagt, dass Schweigen kein Panzerglas ist. Themen, die sich in Schweigen hüllen, werden immer attraktiver. Du solltest versuchen, ihm zu erzählen, wieso du es nicht kannst.»
«Nur daran zu denken, lässt das Entsetzen in mir hochsteigen. Wie kann ich die Unsicherheit, die seit den vielen Jahren des Schweigens in mir nistet, besiegen? Ich habe jahrelang an mir gearbeitet, um das ganze Gefäß richtig zu schleifen und irgendwo in mir verschlossen zu halten. Es fällt mir nicht leicht, es wieder zu berühren. Ich lebe mein jetziges Leben. Ich kann die Zukunft nicht mit der Tinte der Vergangenheit schreiben.»
«Ja, es ist nicht einfach, darüber zu sprechen. Aber weißt du, Schweigen ist manchmal gefährlicher als Reden, und die Liebe lebt vom Reden. Sie hat eine Lunge, und diese kann nicht ohne einen ehrlichen Mund atmen.»
Ich schwieg.
«Ja, du erklärst ihm alles. Daniel liebt dich, und er wird verstehen, warum du bis jetzt nichts erzählen konntest. Und er wird es schätzen, dass du dich ihm anvertraust», unterbrach Katrin die Stille.
«Seit wir in dieser neuen Wohnung in Basel wohnen, wurde der Druck noch größer. Ich weiß nicht, wieso ihm das so wichtig geworden ist. Ich fürchte, er hat beim Umzug mein blaues Heft gesehen.»
«Was für ein blaues Heft?», fragte Katrin.
«In diesem Heft habe ich damals Tagebuch geführt. Das war in der Zeit, als ich nach Nosches Tod kein Wort über die Lippen brachte. Mein Psychiater schlug mir vor, das aufzuschreiben, was ich nicht aussprechen könne. Ich habe auf Arabisch, Deutsch und manchmal auch auf Persisch geschrieben oder gewisse Dinge gezeichnet.»
«Hast du auch über die Flucht geschrieben?»
«Nein, und ich habe keine chronologische oder vollständige Geschichte niedergeschrieben, oft nur Stichworte, manchmal kleine Texte oder Dinge notiert, die ich dem Psychiater mitteilen wollte.»
«Ja, ich erinnere mich gut an diese schwierige Zeit. Du hast es erstaunlich gut überwunden», sagte Beyan und machte eine anerkennende Kopfbewegung.
«Ich weiß nicht, ob ich es hinter mich gebracht habe. Ich will einfach nicht stehen bleiben, auch wenn die Richtung nicht immer klar ist. Jetzt will Daniel, dass ich zu einem Punkt zurückkehre, von dem ich mich befreien will. Ich verstehe nicht, warum er die Gegenwart an die Wand der Vergangenheit nageln will?»
«Ich kann dich gut verstehen, bin aber nicht der Meinung, dass eure Liebe daran scheitern soll», sagte Katrin.
«Weißt du, Aida, ich glaube, der Mensch muss jede Gelegenheit, die sich ihm bietet, nutzen, um besser leben zu können. Besser heißt nicht unbedingt immer glücklich. Ich habe viel Schlimmes im Irak erlebt. Ich konnte vor dem Krieg fliehen, aber er will nicht von mir ablassen. Ich spüre ihn manchmal und sehe sein Gesicht. Ein Gesicht mit vielen Augen, die mich durchdringend anstarren. Immer, wenn ein Auge einschläft, wacht ein anderes auf. Mit der Zeit habe ich mir beigebracht, den Blicken auszuweichen. Zeichnen hat mir sehr geholfen, du wirst es mir nicht glauben, es hat vieles in mir rhythmisiert, und ich weiß jetzt auch, wie ich mit dem größten Trauma in meinem Leben, dem Krieg und der Flucht und dem Leben in der Fremde, umgehen kann.»
Ich erwiderte nichts und versank in meinen Gedanken. Wieso scheiterte ich immer wieder, meinen Eltern ganz zu verzeihen? Mir war einiges klar, aber warum sie in die Schweiz flüchteten, obwohl sie kein Interesse an diesem Land hatten, verstand ich nicht. Ich fand immer neue Antworten, aber die Frage blieb. Als blickte ich bei Regen durch eine Windschutzscheibe. Die Scheibenwischer klären kurz die Sicht, doch das Wetter ändert sich trotzdem nicht. Ich war zufrieden mit dem, was ich in der Schweiz erreicht hatte. Ich schätzte die Freiheit und das Leben und mochte meine Arbeit. Das Vakuum, das Nosches Tod in mir verursacht hatte, konnte ich mit Hoffnung füllen.
Katrin bemerkte, dass ich geistesabwesend war und dem Gespräch auswich. Sie schaute mir in die Augen und lächelte freundlich. Ich betrachtete ihr Haar im Sonnenschein. Es war grauer geworden, dennoch erinnerte es mich an ihr Haar, als sie noch neben mir am Computer saß, um meine Französischhausaufgaben zu korrigieren. Damals hatte das Blond noch die Überhand.
«Die Zeit zerrinnt rasch, wir müssen darauf achten, sie wahrzunehmen, bevor sie verschwindet», sagte mir Daniel an meinem letzten Geburtstag. Wie recht er hatte. Als Teenager in Frauenfeld schnitt ich mit meiner Schwester Bilder aus Zeitschriften aus. Meistens waren es irgendwelche Stars. Dass wir in den Irak zurückgehen würden, wäre uns nicht im Traum eingefallen. Wir klebten die Bilder in ein Heft, der Geruch des Leims hängt mir noch immer in der Nase. Ich höre das Lachen meiner Schwester und unsere Diskussionen darüber, welchen Star wir einmal heiraten würden, als säße sie noch immer neben mir. Die Trauer um meine Schwester bleibt in mir, auch wenn sie stillzustehen scheint wie die Wanduhr im Elternhaus im Irak. Aber jeden Tag kommt ein Augenblick, in dem die tatsächliche Zeit mit derjenigen auf dem Zifferblatt übereinstimmt.
Katrin und Beyan begleiteten mich bis zum Bahnhof. Bevor ich in den Zug stieg, gab mir Katrin einen kleinen Umschlag. «Öffne ihn, wenn du im Zug sitzt», sagte sie mir, während sie mich zum Abschied umarmte.
«Komm bald wieder, sonst wird Onkel Beyan böse auf dich», sagte er mit einem wehmütigen Lächeln im Gesicht.
«Aber natürlich», erwiderte ich.
Im Umschlag war ein Bild von Nosche und mir. Beyan hatte es im Wald geschossen, als wir 2008 den 44. Geburtstag von Katrin feierten. «Schnapszahl», sagte Beyan. Ich wusste nicht, was das bedeutet, aber wir haben auf jeden Fall bis um Mitternacht gefeiert. Neben Essen und Trinken hatte Beyan viele Spielsachen mitgebracht. Eines davon war «Wikingerschach», das ich immer noch gerne spiele. Beyan hatte bei unserem Flüchtlingsheimleiter die Erlaubnis eingeholt, dass Nosche und ich das Wochenende außerhalb des Heimes verbringen durften. Das Heim lag nicht weit von der Wohnung, in der wir als Kinder mit den Eltern als anerkannte Flüchtlinge lebten.
Nosche stand neben mir, strahlend vor Freude und voller Leben. Ihr Lachen wirkte, als wollte sie mir durch dieses Bild aus der Vergangenheit etwas mitteilen.
Wir sahen uns sehr ähnlich. Unser schwarzes, gelocktes Haar hatten wir von unserem Vater geerbt, die kleinen Augen von der Mutter.
«Euer Lachen habt ihr vom Euphrat erhalten», behauptete Vater immer.
An diesem Geburtstag wollte Katrin, dass wir ihr ein arabisches Lied vorsingen. Beyan spielte Geige, und gemeinsam hatten wir ihr diesen Wunsch erfüllt. Laut sangen wir: «Jedes Mal, wenn ich dich vermisse, pflücke ich einen Stern vom Himmel. So lange habe ich dich vermisst, dass der Himmel dunkel wurde.» Nosche, Beyan und ich, alle andern waren Schweizer. Sie fanden, die arabische Sprache höre sich ohnehin an wie ein Lied.
Nosche konnte besser Arabisch als ich. Im Iran musste sie viel aus dem Koran auswendig lernen. Sie schrieb auch kleine Gedichte. Mein Vater meinte, sie hätte es von ihm geerbt. Ich erinnere mich gut an eine Diskussion zwischen Nosche und meinem Vater.
«Die deutsche Sprache wirkt viel bescheidener als die arabische», sagte meine Schwester zu ihm.
«Wie kommst du auf diese Idee?», fragte er.
«Auf Deutsch sagt man: Meine Schwester, du und ich gingen zusammen. Auf Arabisch ist es unmöglich, den Satz mit der dritten oder zweiten Person zu beginnen. Der Sprecher nennt sich immer zuerst», sagte Nosche.
«Die Logik des Arabischen ist in diesem Fall, mit dem Sprecher zu beginnen, weil der Sprecher den Anspruch hat, sich als Ersten zu erwähnen. Das hat nichts mit Demut zu tun, meine Liebe», erklärte Vater.
«Aber Papa, manchmal ist deine Sprache unlogisch», mischte ich mich ein.
«Wieso meinst du?», fragte mich mein Vater verwundert.
«Bevor du ein Auto hattest, sagtest du uns, wenn du zu spät nach Hause kamst: Der Zug hat mich verpasst, nicht umgekehrt. Meinst du damit, der Zug hätte auf dich warten müssen oder was?»
Nosche schaute mich beifällig an.
«Nein, nein, meine Liebe, es ist nicht so. Wir Iraker sagen der Zug und meinen die Zeit», antwortete er nachdenklich und ging in sein Zimmer.
Bis nach Basel beschäftigte mich Beyan und wie er mit Zeichnen Distanz von seinem Leiden schaffte. «Glücklichsein liegt in dir und wird nie von außen kommen. Die alten Ägypter glaubten, wenn der Mensch stirbt und seine Seele zur Tür des Himmels aufsteigt, werden ihm von Engeln zwei Fragen gestellt. Warst du glücklich in deinem Leben? Hast du andere Leute glücklich gemacht? Je nach Antwort erlauben sie ihm, für immer in das Königreich einzutreten oder zu flüchten», sagte Beyan.
Basel empfing mich mit leichtem Regen. Dennoch ging ich zu Fuß nach Hause. Auf dem Weg erinnerte ich mich an das blaue Heft. Auch daran, wie ich das Sprechen verlor, als würde meine Zunge mit einem Seil nach hinten gezogen, sodass ich keinen Ton herausbrachte. Im Irak ist es ein Tabu, zu dieser Art von Ärzten zu gehen. Ich aber war froh, als ich die Überweisung vom Arzt, den wir Asylsuchende besuchen durften, erhielt.
Im Wartezimmer des Psychiaters war ich nicht die einzige Jugendliche. Vielleicht die Einzige, die sich wunderte, dass alles in dieser Praxis glänzte, selbst der Psychiater. Sein samtiger Anzug, seine Schuhe, die Brille, ja selbst seine Glatze und der wertvoll aussehende Füller auf dem Tisch. Er begrüßte mich, gab mir seine Hand, führte mich ins Zimmer, bot mir einen Stuhl an und setzte sich mir gegenüber. Er schwieg, und ich war irritiert. Wer sollte nun wem helfen, wieder zu sprechen? Hinter ihm auf der Fensterbank waren kleine Tierfiguren und Schiffsmodelle. Sie allein glänzten nicht.
«Du bist hier, weil du Hilfe brauchst, die ich dir gerne anbieten möchte.»
Sein erster Satz erinnerte mich an eine Geschichte, die ich zuvor im Asylheim gelesen hatte. Darin begann ein Psychiater das Gespräch mit der Protagonistin immer damit, wie sie auf ihn wirkte. «Du siehst besorgt aus», «du hast nicht gut geschlafen» und so weiter. Sie hatte immer genickt, um ihm zu bestätigen, was er über sie dachte. Ich tat dasselbe, obwohl ich in dem Moment eigentlich nur noch wegwollte. Der Psychiater begann, sich auf meine Hände zu konzentrieren und vorsichtige Blicke zu werfen. «Vielleicht möchtest du mir etwas erzählen. Egal was», sagte er.
Ich war hilflos, verzweifelt und schwach. Ich zuckte mit den Schultern und schwieg.
«Dann nenn mir etwas, was du besonders magst. Oder etwas, was es wert wäre, gehört zu werden.»
Nach einer kurzen Pause fuhr er fort: «Du bist frei, du musst natürlich nicht.»
Ich wünschte mich nur weg von diesem glänzenden Ort.
Während zwei Monaten war ich einmal wöchentlich bei ihm in Therapie, danach immer unregelmäßiger. Er redete viel mit mir, um mich zum Sprechen zu bringen, und einmal flüsterte er mir leise ins Ohr: «Schreibe, wenn du nicht reden kannst. Oder zeichne auf, was dir Kummer macht. Schreiben ist kein Ersatz, aber es wird dir helfen.» Er gab mir ein Papier mit Fragen, die ich zur nächsten Sitzung beantworten sollte. Ich tat es nicht. Ich kaufte mir in Frauenfeld ein blaues Heft und begann, für mich zu schreiben, ohne den Zwang, das Geschriebene jemandem zeigen zu müssen.
Kleine Texte von ein paar Zeilen verstreuten sich im Heft. Es entstanden auch kurze Briefe an Nosche. Ich weiß nicht, ob Daniel das alles gesehen hat. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Auf einer Seite stand neben einer Zeichnung, dass ich mich am Tod von Nosche schuldig fühle. Hätte sie die Flucht aus dem Irak auch ohne mich gewagt? Wäre sie ohne mich gar nie gegangen?
Auf einer anderen Seite schrieb ich über meinen Vater, über das Versteckspiel, das wir immer mit ihm in der Wohnung machten. Wie seine Augen strahlten, wenn er uns suchte. Es war uns schon bewusst, dass er unser Versteck schnell finden konnte, er tat nur so. Dieses Spiel konnte er im realen Leben nicht spielen. Er wollte nichts übersehen, und manchmal warf er seine Worte gleichgültig um sich. Sie fielen in unsere Herzen und Ohren wie Feuerbälle.
Ich fing an, mehr in meinem blauen Heft als in meiner Trauer zu leben. Ein Schreibfluss durchströmte mein Leben und ließ mich vorwärts gehen. In mir keimte die Hoffnung, dass das Reden bald zurückkomme.
Nach etwa drei Monaten musste ich die Therapie beim Psychiater abbrechen, da diese nicht mehr genehmigt wurde und ich weitere Therapiestunden hätte selbst bezahlen müssen. Wie hätte ich das als Asylbewerberin gekonnt? Ich hatte ja meine Zunge wieder, meinten sie.
Im Herbst 2008 verließ ich die Praxis des Psychiaters und war eigentlich froh, die Behandlung nicht mehr weiterführen zu müssen. Ich fühlte mich reif genug, um zu begreifen, wo ich stand. Es würde nicht mehr lange gehen, bis ich aus diesem Zustand herauskam. Viele Wunder hatten mich in die Schweiz zurückgebracht. Jetzt musste ich die Verantwortung für mich selbst übernehmen, sagte ich mir.
Beyan unterstützte mich, indem er mir viel aus seinem Leben erzählte: Wie er im Irak gelebt hatte und wie ihm die Flucht bis in die Schweiz gelungen war.
Einmal machten wir eine Radtour von Frauenfeld nach Kreuzlingen und dann einen langen Spaziergang am See. In einem Restaurant in Kreuzlingen tranken wir Kaffee.
«Wollen wir hoch? Die tolle Aussicht vom Seeburgturm über den Bodensee ist unverzichtbar», sagte Beyan.
Katrin blieb unten, weil sie Höhenangst hatte. Beyan und ich stiegen die Treppen hoch. Eine wunderschöne Seelandschaft.
«Schau, viele Menschen haben auf der Holzbrüstung Namen und Botschaften in verschiedenen Sprachen hinterlassen. Möchtest du auch etwas schreiben?», sagte er und gab mir einen Bleistift. Er trat zwei Schritte zurück, und es war, als ob Nosche auch dabei wäre. Ich nahm den Stift und schrieb auf Arabisch: bayt, Haus.
Viel Zeit war vergangen, seit ich das letzte Mal in dieses Heft geschaut hatte. Ich wusste, dass es mich in Lebensabschnitte zurückführen würde, die ich nicht gerne mochte. Trotzdem ging ich in der Wohnung, ohne meine Schuhe auszuziehen, direkt ins Schlafzimmer und zu meinem Kleiderschrank, in dem sich eine kleine Truhe befand. Ich zog das Heft hervor, setzte mich auf den Rand des Bettes und begann darin zu blättern. Mehrmals hatte ich Bienen gezeichnet, sie bringen Glück. Meine Mutter meinte, jede Biene würde eine Botschaft tragen, die zum Glück führe. «Bienen lügen nicht, betrügen nicht, und sie schaden niemandem. Wenn du eine Biene siehst, lache und denke an das Wunder, das sie tragen.»
Ich brachte das Heft an seinen Ort zurück und begann, Daniel eine SMS zu schreiben. «Wie geht’s dir? Habt ihr überhaupt ein Wochenende? Was hast du gearbeitet? Ich habe deine Postadresse gar nicht, ich wollte dir deinen E-Reader schicken. Ich war in Frauenfeld bei Beyan und Katrin, und meine Arbeit hier tue ich wie üblich. Es ist schwierig, ohne dich hier zu sein. Ich habe dich lieb, Aida.»
Der Duft der Croissants im Café der sudanesischen Frau kündigte einen neuen Tag an. Die Frau war glücklich, da ihre Tochter heute ihr erstes Konzert als Cellistin in Basel gab. Stolz überreichte sie mir den Flyer. Er erinnerte mich an den irakischen Cellisten, der auf den Straßen gegen Terror protestierte. An Schauplätzen kurz nach Anschlägen, Autobomben, Sprengstoffattentaten tauchte dieser Künstler auf und begann zu spielen. Trotz der Blutflecken und Trümmer fühlten sich diese Schauplätze durch seine Musik wieder lebendig an.
Bei der Arbeit begann die Woche mit vielen Aufgaben. Meine Chefin gab mir eine lange To-do-Liste. Sie ist freundlich, spricht aber wie ein Roboter, und das ist es, was mich an ihr und manchen Schweizern stört, ihre neutrale Sprache. Sie kann viel reden, ohne ein einziges Gefühl zu zeigen. Ich kann meine Gefühle dem gegenüber, was ich sage, nicht verstecken.
Nach der Arbeit ging ich am Rheinufer spazieren. Wie ein Maultier trottete ich mit gesenktem Kopf meinen Lieblingsweg entlang, den ich fast auswendig kannte. Auf einmal überkam mich das Gefühl der Traurigkeit. Sie berührt meine Seele immer wieder anders, auch wenn ihre Hand dieselbe ist.
Der Herbst vermischte sich mit der Kälte des Oktobers. Mein Spaziergang endete in einem großen Kaffeehaus. Ich suchte einen Platz in einer Ecke. Die großen Hallen verwirren mich, die Mehrheit hat wie ich die falsche Hautfarbe.
Auf meinem Tisch lag ein Wettbewerbsformular für einen Sprachaufenthalt, ich begann es auszufüllen. Bei der Rubrik «Nationalität» machte ich zuerst einen Strich, aber dann schrieb ich «Schweizerin» hin. Ein seltsames Gefühl ergriff mich. Ich fühlte mich wie ein Zauberer, der auf einer Bühne steht und stolz präsentiert, wie er eine Frau trotz unzähliger Messerstiche unversehrt hält. Ich wusste nicht, ob ich der Zauberer oder die Frau war, auf jeden Fall war ich eine Lügnerin. Ich zerriss das Formular, holte mir meinen Kaffee und begann über den Weg, der mich in die Schweiz gebracht hatte, nachzudenken. Wer wäre ich ohne die Flucht geworden und was hat die Flucht aus mir gemacht? Ich war wie ein Affe auf einem dünnen Ast – man denkt, er würde fallen, aber er nutzt den Schwung des federnden Astes, um zum großen Stamm zu springen.
In diesem Café hatte Daniel häufig an seiner Masterarbeit geschrieben. Hier passe es am besten, über das Thema Heimat zu schreiben, «ich fühle mich wie im Ausland», sagte er zu seiner Mutter und mir. Sie war zu Besuch gekommen für die Museumsnacht und hatte uns zum Essen eingeladen. Von einem Nebentisch war Arabisch zu hören. Daniel schaute mich an und fragte: «Was denkst du, können Menschen ohne Heimatverlust verstehen, wie schwierig es ist, sich eine neue Heimat zu erschaffen?»
«Ich kann es nicht beurteilen», antwortete ich. Seine Mutter schaute mich an.
«Was heißt: Du weißt es nicht? Warum tust du so, als ob es dich nichts anginge?», bohrte Daniel weiter. Ich schwieg einen Moment, seine Mutter merkte, dass sich die Stimmung anspannte.
«Muss das denn jetzt sein?», fragte sie.
Daniel schaute wütend. «Das war eine ganz normale Frage», sagte er, «und es ist unpassend, dass Aida sie als eine Zumutung empfindet.»
«Ich bin nicht empfindlich, aber in deiner Sprache ist manchmal etwas Unangenehmes. Es vermittelt mir das Gefühl, dass ich ewig fremd bleiben werde.» Ich stand auf, und ging. Weder er noch seine Mutter verloren ein Wort, sie starrten mich bloß mit den größten Augen der Welt an. Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten.
In der Wohnung verschwand ich im Schlafzimmer und weinte. Mein Körper begann zu zittern. Ich vergrub meinen Kopf zwischen meinen Beinen. Als Kind tröstete mich mein Vater, wenn er mich betrübt sah. Einmal nahm er mich auf seinen Schoß und sagte mir ins Ohr: «Wenn du groß bist, wirst du darüber lachen.» Wie sehr vermisste ich ihn. Ich hörte seine Stimme in meinem Ohr, spürte seine Handfläche auf meinen Schultern.