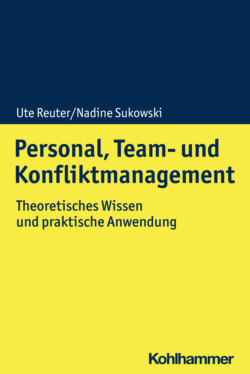Читать книгу Personal, Team- und Konfliktmanagement - Ute Reuter - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1.2.3 Die systemtheoretische Perspektive auf Kommunikation
ОглавлениеIm Regelfall betrachten die Ansätze des Personalmanagements die Mitarbeiter einer Organisation aus der psychologischen bzw. Individuum-zentrierten Perspektive. Nicht zu vergessen ist jedoch, dass Mitarbeiter auch Mitglieder einer Organisation sind. Und Organisationen sind soziale Systeme, die mit ihren Strukturen und Prozessen den Mitarbeiter beeinflussen. An dieser Stelle wird die systemtheoretische Perspektive als Kontrast eingefügt. Die Kommunikation und deren Einfluss auf die Mitglieder werden im Folgenden als einer der Hauptprozesse in Organisationen unter die Lupe genommen.
Wenn der Akt der Kommunikation aus der systemtheoretischen Perspektive näher betrachtet wird, fällt ein entscheidender Unterschied zu anderen Modellen der Kommunikation auf. In Sender-Empfänger-Modellen wird angenommen, die Kommunikation übertrage Informationen vom Absender auf den Empfänger. Damit suggerieren sie, dass der Absender etwas weggibt, was der Empfänger erhält. Darüber hinaus liegt der Fokus auf der Geschicklichkeitsanforderung des Mitteilenden.
Niklas Luhmann, der Vater der deutschen Systemtheorie, gibt diese Metapher auf. Nach Luhmann ist »diese Dingmetaphorik des Habens, Gebens und Erhaltens ungeeignet« (Luhmann, 1984: 193). »Die Mitteilung ist nichts weiter als ein Selektionsvorschlag« (Luhmann, 1984: 194).
Niklas Luhmann macht das deutlich mit seinem Kommunikationsmodell: Kommunikation ist die Einheit von
• der Selektion der Information,
• der Selektion der Mitteilung und
• der Selektion des Verstehens (vgl. Luhmann, 1987: 194).
Luhmann bezeichnet in seinen Erläuterungen den Adressaten einer Mitteilung als »Ego« und den Mitteilenden als »Alter« (Luhmann, 1987: 195). Dieses Verstehen – als selektive Aktualisierung einer Differenz von Mitteilung und Information – ist etwas anderes als ein psychisches Verstehen. Verstehen innerhalb der Operation Kommunikation heißt: Eine Mitteilung und eine Information werden unterschieden und zugeschrieben. Verstehen heißt nicht, die Gefühle, Motivationen, Gedanken des anderen zu erfassen, wie es in den psychologischen Ansätzen gemeint ist.
Die Selektion der Annahme des Verstehens liegt beim Ego. Das Ego kann die Mitteilung annehmen oder auch nicht. D. h. das Ego nimmt die Mitteilung als solche an und deklariert das, was es hört, nicht als Rauschen. Erst im Verstehen, nicht schon bei der Mitteilung, kommt Kommunikation zustande. Die dritte Selektion bedeutet: verstehen, dass es sich um eine Mitteilung handelt, nicht jedoch richtig verstehen, welchen Inhalt einem jemanden mitteilt bzw. welchen Sinnvorschlag jemand macht. Ego versteht das, was er von Alter hört oder sieht, als Mitteilung. Er interpretiert es als Mitteilung und damit als gewollt – nicht etwa als versehentliches Geräusch oder zufälliges Verhalten. Im Extremfall sogar: Er unterstellt, dass der andere die Absicht hat, ihm etwas mitzuteilen. Egos Selektion enthält Alters Selektionen eins und zwei. Es ist eine Synthese, also etwas völlig anderes als eine Summe der Handlungen von zwei Akteuren. Eine Mitteilung verstehen bzw. eine mitgeteilte Information verstehen ist damit immer Verstehen von Differenz. Das trägt den Hinweis auf eine mögliche Irritation, ein Defizit, einen Risikofaktor in sich: Was hat der andere zur Mitteilung ausgewählt und warum? Was hat er nicht ausgewählt? Warum sagt er mir das gerade jetzt und gerade so?
»Daher setzt Kommunikation einen alles untergreifenden, universellen, unbehebbaren Verdacht frei« (Luhmann, 1987: 207). Jedes psychische System holt sich Informationen auf dem Weg über einfache, direkte, unmittelbare Wahrnehmungen. Das Ergebnis sind wahrgenommene Informationen. Von denen muss man den Eindruck haben, sie seien vollständig und unbedingt zutreffend: Schließlich traut man ja seinen eigenen Augen und Ohren, seinem Wahrnehmungsapparat. Auf dem Weg über Kommunikation bekommt man ebenfalls Informationen. Das Ergebnis sind mitgeteilte, d. h. durch eine andere Instanz selektierte Informationen. Es liegt nahe, das, was diese andere Seite vorher wahrgenommen und davon aus irgendwelchen Gründen mitgeteilt hat, keineswegs zweifelsfrei für vollständig und unbedingt zutreffend zu halten. Für das Bewusstsein der Beteiligten sind die Wege grundverschieden, die Ergebnisse grundverschieden und die Konsequenzen grundverschieden. In der dritten Selektion sind die erste und zweite Selektion enthalten. Darum ist sie die entscheidende. Und das ist der Grund, warum Luhmann den Hörenden als Ego bezeichnet. Der Sprecher ist Alter, der andere, obwohl er zeitlich als erster agiert. Die Kommunikation wird sozusagen von hinten her ermöglicht, gegenläufig zum Zeitablauf des Prozesses. Ego versteht oder unterstellt, dass es etwas mitgeteilt bekommt. Es bedeutet nicht inhaltliche Verständigung. Alter und Ego müssen die Mitteilung, das, was mitgeteilt wird, nicht gleichsinnig verstehen. Sie müssen sich nicht einig sein. Konsens ist nicht erforderlich. (vgl. Fürst/Sukowski, 2018: 14 ff)
Charakteristisch für Kommunikation ist ihre Selektivität. Kommunikation heißt, zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen zu müssen. Dabei ist jede Selektionsentscheidung kontingent und damit auch immer anders möglich. Kommunikation ist Prozessieren von Selektion. Kommunikation ist ganz allgemein dazu da, eine Information mitzuteilen, die auch anders ausfallen könnte. Die ersten beiden Selektionen liegen bei Alter, die Dritte bei Ego. Zwei Akteure in drei Akten lassen sich beobachten und beschreiben. Die Selektion bezieht sich sowohl auf das Was als auch auf das Wie. Eine Mitteilung ist also immer eine Selektion: eine Entscheidung für eine bestimmte Information, gegen andere mögliche, für bestimmte inhaltliche Sinnvorschläge und formale Darstellungsweisen gegen andere mögliche. (vgl. Luhmann, 1987: 195)
Kommunikation ist robust, sie ist nicht unterzukriegen und gleichzeitig so formelastisch, dass sie passt, so lange es Gesellschaft gibt. Kommunikation ist stabil genug, um sich durchzusetzen, was immer nun passiert, ob sich ein Börsencrash ereignet oder was auch immer. Es kann immer noch darüber geredet werden, es kann immer noch kommentiert werden (vgl. Fürst/Sukowski, 2018: 13). Die Kommunikation ist wie das Leben eine sehr robuste, qua Autopoiesis formelastische Erfindung der Evolution. Ein autopoietisches System ist ein selbstreferentiell- zirkulär geschlossener Zusammenhang (vgl. Krause, 1999: 198).
Daher ist Kommunikation von zentraler Bedeutung für den Fortbestand einer Organisation. Aus systemtheoretischer Perspektive besteht eine Organisation nicht aus Mitarbeitern, sondern aus dem, was sie miteinander teilen; nämlich Kommunikation und Entscheidungen. Ein Mitarbeiter (= das psychische System) kann wahrnehmen. Die Organisation (= das soziale System) kann nicht wahrnehmen. Eine Organisation muss sich auf das verlassen, was die Mitarbeiter an Wahrnehmungen in der Kommunikation zur Verfügung stellen. Mitarbeiter nehmen Fehler wahr und können Prozesse optimieren, wenn diese Wahrnehmung in der Kommunikation geteilt wird. Mitarbeiter haben Vorstellungen von Zielen, die, wenn sie kommunikativ geteilt werden, zu Zielen für die Organisation werden können.
Nun gibt es einen interessanten Unterschied in der Kommunikation. Das psychische System, der Mitarbeiter, erwartet in der Kommunikation bei der Annahme also, dass das Gegenüber, der andere, ihn versteht. Für das soziale System ermöglicht eine Nicht-Annahme in der Kommunikation, dass die Kommunikation fortgeführt wird. Psychische Systeme kommunizieren solange, bis die Erwartung, dass das Gegenüber versteht, gelingt. Für das soziale System bedeutet dies Fortbestand, weil die Kopplung über Kommunikation gelingt. Wenn psychische Systeme sich in der Kommunikation schnell angenommen fühlen, also verstanden werden, gibt es keine Anschlusskommunikation und das soziale System der Organisation verliert seinen Klebstoff.
Luhmann weist darauf hin, dass auch die Sprache als fundamentales Kommunikationsmedium keineswegs dem Konsens den Vorzug gibt: Sprachlich ist es ganz gleichgültig, ob man ja oder nein sagt. Anders als bei konventionellen Definitionen und in der Alltagsauffassung ist bei Luhmann eine erfolgreiche inhaltliche Verständigung keineswegs Ziel von Kommunikation. Kommunikation ist nicht auf Konsens angelegt, auch nicht auf Dissens. Kommunikation ist Differenz. Diese Theorie muss vor allem offenlassen, ob man zu dem Verstandenen Ja oder Nein sagt. (vgl. Luhmann, 1987: 209 ff)
Kommunikation ist praktisch immer ein Missverstehen – ohne Verstehen »des Miss«. Wenn Kommunikation Konsens zum Ziel hätte, was wäre die logische Konsequenz, wenn Ziel und Zweck erreicht sind? Der Lauf würde enden! Konsens hergestellt – Kommunikation fertig! Das soziale System, das nur durch Kommunikation existiert, hätte sich selbst das Ende bereitet (vgl. Fürst/ Sukowski, 2018: 16). Kommunikation führt immer in einen Raum, mit offenem Ausgang und erst diejenigen, die ihre Wahrnehmungen in diesem Akt zur Verfügung stellen, tragen zu diesem Akt und seinem Fortbestand bei. Die systemtheoretische Perspektive ist für das vorliegende Buch insofern weiter relevant, weil sie die in Kapitel C.5 beschriebenen Dynamiken im Konfliktgeschehen in ein anderes Licht rückt. Die Ansätze der Verhandlung werden bereits im folgenden Kapitel betrachtet, weil sie einen methodischen Ansatz liefern, den Akt der Kommunikation wirksam zu gestalten.