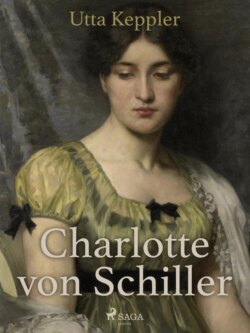Читать книгу Charlotte von Schiller - Utta Keppler - Страница 5
1. Kapitel
ОглавлениеJugend in Rudolstadt
Die Magd vom Heisenhof rannte in den Stall und schrie: „Hannes! Hannes! Anschirren – den Doktor – der Herr …”
Die beiden Kinder liefen aus der Haustür, hinter ihnen Frau von Lengefeld. Sie stolperte an der Schwelle und fiel der Magd in die Arme.
Der Kutscher zerrte das Pferd aus dem Stall; es sträubte sich, weil es den Aufruhr spürte.
Droben am Fenster – ein Schattenriß vor dem erleuchteten Zimmer, schwankte eine dunkle Gestalt hin und her, geisterhaft, zuckend, unbeholfen; einen Arm als schwarzen Strang sahen sie von unten, die Hand ans Fensterkreuz geklammert, dann fiel die Erscheinung zusammen und verschwand.
Frau von Lengefeld hatte alles beobachtet, soweit sie dazu imstand gewesen war; sie rannte, wie gepeitscht vom Schrecken, zur Treppe und hinauf, die Magd ihr nach. Die Töchter am Eingang hörten die fliegenden Röcke rauschen.
Die Stimmen der Frauen klangen wie Schluchzen von oben, die Kinder liefen nach, Charlotte vorweg, die Neunjährige, hinter ihr die rasche rundliche Karoline; alle standen sie dann im Halblicht der Kerze, die die Magd – noch glostend – aufgehoben und hingestellt hatte: Auf das Bett gesunken hing der Freiherr, der Vater, Carl Christoph von Lengefeld, den Mund offen, die Augäpfel weiß: sie wußten gleich, daß er tot war.
Luise von Lengefeld, geborene von Wurmb, war nach einer fünfzehnjährigen Ehe Witwe, Mutter ihrer zwei kindlichen Töchter, und dabei Pachtherrin auf Roschwitz und Pippelsdorf, einem Steinschen Gut, das Heisenhof hieß und nicht viel mehr war als ein großer Bauernhof mit mäßiger Wirtschaft und einiger Schuldenlast.
Es gab Kühe und Pferde, auch die in bescheidener Zahl, nicht üppig gepflegt, und Wiesen und Felder, über die Luise kaum den rechten Überblick hatte.
Was sie kannte und wußte, war ihr von Kindheit an tief eingeprägt worden, als Verpflichtung, als Lebensgefühl: daß sie adlig sei und das darzustellen habe, was der Hof erwartete.
Der großherzoglich Schwarzburg-Rudolstädter Hof war von je das Maß aller Dinge für die kleinen Gutsbesitzer, den Landadel der Gegend, und Luise sah deshalb für sich und die Töchter, nachdem das bescheidene Vermögen verbraucht war, keine Zukunft außer einer Stellung bei der fürstlichen Familie.
Ihre Lage war ihr nicht gleich klar gewesen, als der Mann, befürchtet wohl, aber dann doch überraschend, gestorben war: Sie hatte den viel Älteren geheiratet, wie es ihr vorgeschrieben und angelegentlich geraten worden war. Und da sie als arme Adlige wenig Möglichkeiten hatte für eine eigene, vollends für eine Liebeswahl, hatte sie sich an den achtundzwanzig Jahre älteren Lengefeld gebunden, der ein rechtschaffener und zuverlässiger Charakter war und als Oberforstmeister des Fürsten eine sichere Stellung hatte; freilich gehörten zu seinem Amt Kontrollgänge und Überprüfungen der Förster, genaue Kenntnis der Waldbestände, des Bodens, der wirtschaftlichen Nutzung.
Aber eben auf diese umsichtige Geschäftigkeit kam es an, und Lengefeld, der Alternde, hatte mehr und mehr unter Schmerzen der Gelenke und einer zunehmenden Taubheit der Glieder gelitten, als der Arzt, den man endlich befragte, auch Augenschäden und unkontrollierte Bewegungen feststellte.
Das Übel, das der Freiherr mit unerbittlicher Beherrschung unterdrückt hatte, schließlich vortäuschend, was er nicht mehr leisten konnte, brach endlich – scheinbar plötzlich – über ihn herein: eine Lähmung, die ihn auf einer Seite bewegungsunfähig machte.
Er mußte dann in einem Wagen gefahren, auf einer Trage herumgeschleppt werden, mit Schmerzen und mühsam nur imstande, die unebenen Waldpfade zu bewältigen.
Wenn er zu Hause anlangte, brauchte er allerlei Pflege, Wärmung, Tränke und Einreibungen, und Luise wurde schließlich ganz zur Pflegerin, zu einer manchmal übermüdeten und gereizten Gehilfin, und gewöhnte sich an, vieles allein zu tun, um die Dienstboten über den wirklichen Zustand des Herrn zu täuschen.
Nach seinem Tod, der als drohender Schatten schon fast seit dem Beginn der Ehe über ihr gehangen hatte, wurde erst deutlich, daß auf eine ausreichende Versorgung, eine Pension für die Witwe kaum zu hoffen war. Es mußte etwas ganz anderes angefangen werden; ein Einschnitt, eine schmerzhafte Kerbe hatte da – plötzlich trotz aller Voraussicht – den gleichförmigen Trott und die einfarbige Behaglichkeit zerrissen.
Vielleicht empfand das Kind Charlotte das deutlicher als die in ihrer Konvention wie in einem nicht mehr gespürten Panzer gehaltene Mutter, und sogar stärker als Karoline, obwohl diese älter war.
Karoline hatte die glückliche oder gefährliche Anlage, alles farbiger, lauter, eindrucksamer zu erleben als Lotte. Sie verwandelte Äußerliches in Phantasiegebilde, in blumig-geschwungene schwebende Linien, in stilgemäße Ornamente, Formen, die ihrem Wesen entsprachen und die sie ertragen konnte oder sogar herbeiwünschte.
Als man dann den kleinen ländlichen Heisenhof und das eingeengte, aber überschaubare Leben aufgeben und der Sparsamkeit zuliebe nach Rudolstadt ziehen mußte, war es der Mutter um die Nähe des herzoglichen Hofes zu tun, dem man durch die Verbindung zu Lottes Patin, Frau von Stein, näher zu kommen hoffte.
Hatte der leidende Mann schon durch seine Schwerfälligkeit, die nicht nur körperlich war, das Eindringen in die elegante Gesellschaft erschwert, war sein Charakter und vielleicht auch seine ganze Einstellung dagegen gewesen, so suchte die chère mère, wie sie jetzt als Mitte der Familie zärtlich und ein bißchen ironisch genannt wurde, mit allerlei gesellschaftlichen Winkelzügen sich und die Kinder dem herausleuchtenden Zentrum des kleinen Fürstenhofes näherzubringen.
Es gab nichts Besseres, die Stufenleiter war vorgegeben, ihre Spitze blitzte als einzig mögliches Ziel. Denn Adel – komme er, woher er wolle – war die Auszeichnung und das Dekor der Erwählten in ihren Augen.
Karoline, die mit sprühendem Witz und gelegentlich scharfem Urteil die gezirkelten Tanzschritte solcher Lebenswege beobachtete, suchte da – wenigstens in ihren Gedanken – manchmal auszubrechen.
Lotte war noch zu sanft, zu angepaßt, zu naiv auch, um sich Kritik zu erlauben. Und gerade sie wurde deshalb von der Mutter dazu ausersehen, als Hofdame zu debütieren, da sie die hübschere, weiblich-sanftere von den beiden Töchtern war.
Das kleine ersparte Vermögen des Vaters war in ein paar Jahren verbraucht. Die wohlwollenden Steins hatten nicht viel zu verschenken, zumal sie durch die Stellung des Mannes als Oberstallmeister und Charlotte von Steins Hofbindung zu größerer Repräsentation verpflichtet waren.
Luise von Lengefeld mietete sich also am Stadtrand von Rudolstadt ein, beengter als vorher und ohne großen „Troß“. Freilich, nach außen, beim Auftreten in Gesellschaft suchte sie das Dekor zu wahren.
Man arrangierte Tees, literarische Zirkel, kleine Assembléen, und dabei wollte man die Lengefelds nicht übergehen, besonders da Charlotte von Stein und ihr Kreis sie einluden. Die Mama redete viel und nicht immer taktvoll von ihren Sorgen um das Auskommen der Mädchen, die eine gute Bildung genossen hätten.
Indessen war die sechzehnjährige Karoline eine junge Dame geworden, während Lolo noch in ihrem träumerischen Kinderland gefangen war, sanft und bescheiden und sehr zurückhaltend; die keckere Karoline zeigte sich, von der Mama lanciert, mit allerlei Talenten, schrieb wohlformulierte Briefe und belebte, lachend, kokett und vital, die kleinen Gesellschaften.
Die chère mère sah das gern und unterstrich Karolinens Wirkung durch allerlei schmückendes Beiwerk und farbenfrohe Accessoires, dämpfte kaum ernsthaft ihre Ausgelassenheiten und tadelte nur andeutend die manchmal „zu auffälligen Décolletées“.
„Karoline ist ein Füllen“, sagte Frau von Lengefeld, „und Lolo ein Eselchen.“
Die wußte schon, was man von ihr hielt, und nahm auch die Neckereien der älteren Schwester schweigend und scheinbar unempfindlich hin: Karoline nannte sie zärtlich-spöttisch ein weichmäuliges Grautierchen.
Frau von Lengefeld spürte bitter ihre Lage, da ihr – wie sie meinte – nun nur noch die einzige Aufgabe gestellt war, ihre beiden Töchter in eine vorteilhafte Ehe zu lenken. Es war ein bißchen Intrige dabei, viel Selbsttäuschung, viel unglückliches Lavieren.
Da waren Bälle im Steinschen Haus, dem kleinen Palais, zu denen sich die chère mère drängte, für die alle Mühe aufgewandt wurde, um die Mädchen vorteilhaft herauszuputzen, und mit möglichst wenig Ausgaben einen luxuriösen Auftritt zu arrangieren. Es gab manchmal groteske Szenen, die Karoline nicht ohne ironische Kommentare lassen mochte: Lottchens zu schmale Figur, Lines zu füllige, mußten mit Rüschen und Schleifen, mit Stäbchen und Miederschnüren korrigiert werden. Aus den Stoffbahnen der mütterlichen Toiletten, modisch längst verblichen, fertigte die Näherin mühsam und einfallsreich, was die Mädchen kleiden sollte – hochgegürtete, ausgeschnittene Griechengewänder und faltige Schals, gekrauste Décolletées, gepuffte kleine Ärmel. Karoline ließ ihr schütteres Haar um das breite Gesicht bauschig toupieren und winzige Löckchen unter einem Goldreif hervorspringen.
Lotte hielt sich schlichter, und da die Mutter ihr eher die Nebenrolle zutraute – „mein weichmäuliges Grautierchen“ – ließ man ihr den Willen.
Die kluge Stein, die Herzogin auch, beobachteten die drei unter ihren vielen geputzten und wirkungssüchtigen Damen mit einer Mischung aus Mitleid und vorsichtiger Ironie; und wer ihnen zusah, entdeckte die ungleiche Wesensart der Lengefeldschen Töchter, das unüberhörbare Auftreten der älteren, die gehaltene, in sich sichere Art der kleinen.
Während die chère mère sich mit den älteren Frauen über allerlei Hofklatsch unterhielt, ohne zu tanzen, wie es sich für eine Witwe gehörte, während Line sich drehte und manchmal fast zu laut ihre Pointen anbrachte, stand Lotte oft mit irgendeinem geduldigen Kavalier in einer Nische und hörte ihm zu.
Und der, war er keiner von den Oberflächlichen, staunte im stillen über ein paar gescheite, durchdachte und ganz bescheiden ausgedrückte Meinungen.
Es waren fast lauter unreife Jungen, die da feierten, im Üblichen erzogen, in den Formen gewandt, gute Reiter und Tänzer, alle ein wenig überheblich und alle von Adel.
Aber auch sie, die jungen Männer, hatten, so wenig wie die meisten Frauen, Einblick und Überblick, wenn es um Politik ging; die Gespräche drehten sich um Pferde und Jagden, und unter den Mädchen um Putz.
Lolo und Karoline amüsierten sich darüber, daß vor nicht allzulanger Zeit die aus Paris verbreiteten Moden nicht durch Journale oder durch kolorierte Stiche bekannt werden konnten; kaum gab es so etwas Praktisches und Angenehmes. Man kannte nur die angezogenen Modepuppen aus Peddigrohr, die aus Paris zu Land oder per Schiff nach Deutschland und England verfrachtet wurden – bis man dahinterkam, daß die hohlen Gestelle das waren, was man später „tote Briefkästen“ nannte – unverdächtige Behälter vieler geheimer Botschaften.
Denn der französische Adel floh schon bald aus dem brodelnden Paris, in dem die gefährlichen Spannungen wuchsen, und England unterstützte die Gegenkräfte, die sich der Aufsässigen erwehren wollten, mit Geld und Versprechen.
Die Gestelle waren bei der Rückkehr aus England schwerer als bei der Hinfahrt, und wer sie sich als Modelle sicherte, war der alte – noch immer vermögende – Adel.
Lottes Ehrfurcht vor dem Gesicherten unterschied noch nicht zwischen gedankenlos übernommener Konvention und dem lebendig Gewachsenen und Wachsenden, der „geprägten Form, die lebend sich entwickelt“, wie es goethisch hieß.
Die Form, die das merry old England übte und zeigte, Tradition, die einmal ihren Sinn besaß und noch nicht ganz verloren hatte, wie überhaupt alles Gehaltene und Beherrschte, empfand Lotte irgendwie als tröstlich, als beruhigend, weil sie, mehr als Karoline, schon früh und kaum bewußt die Unsicherheit und Fragwürdigkeit ihres gestörten Familienkreises erlebt hatte, die krampfhaften, oft hilflosen Bemühungen ihrer Mutter, festen Boden zu gewinnen nach dem Tod des Vaters. Dieses „englische Beherrschte“ und auch ein wenig Eingleisige tat ihr wohl – sie suchte und fand etwas davon in den Gesprächen mit einigen englischen Offizieren im Steinschen Haus.
Nun war hier unter den eingeführten Gästen eine kleine Gruppe von schottischen Offizieren, lange, schlanke, sportliche Soldaten in kleidsamen Uniformen, die sie von teuren Schneidern eigens anfertigen ließen, junge Leute aus adligen Häusern, die von ihrem Herrentum überzeugt waren und übrigens kurz vor der Versetzung in den Kolonialdienst standen; und weil sie noch ein Zipfelchen Heimat und Glück in der Erinnerung mitnehmen wollten, schauten sie mit sehnsüchtigen Augen die jungen Mädchen an, die ihnen da vorgeführt wurden.
Captain Heron war einer von ihnen, besonders adrett, Bruder eines Lord Inverary, als Zweitsohn für den Dienst in den Kolonien bestimmt. Lotte suchte manchmal seine Nähe, um sich aus der Atmosphäre eines unerwünschten Herrn Knebel zu retten; Knebel war ein dichtender Schöngeist, Logenbruder des Herzogs, einstiger Prinzenerzieher und viel älter als Lotte.
Lotte war jung, umgeben von einer Gesellschaft, in der erwünschte, verweigerte, beginnende und erkaltende Beziehungen wie Spinnfäden hin und her gingen und wo – durch die Mama gefördert – erotische Empfindungen in der Luft lagen. Karoline sah dem schüchternen Spiel amüsiert zu.
Lotte selber nahm die scheuen Huldigungen errötend an – was eben so üblich war zwischen einem jungen Offizier und einem adligen Fräulein, Blumensendungen und zierliche Briefchen und einmal sogar einen Mondspaziergang in einer baumrauschenden warmen Nacht – und es „erwachte“ in ihrem Gemüt die Fähigkeit, Verse zu schreiben und Reime zu finden, die Heron wohl nie zu sehen bekam.
Das Ende der kaum ausgereiften Beziehung war ein schmerzlicher Abschied, für den Karoline schwesterlich vermittelnd die Gelegenheit schuf, ein letztes Zusammentreffen mit Tränen und Treueschwüren, da der junge Mann nach Indien kommandiert worden war.
Was blieb, waren Lottes Verse, die in Erinnerung an dieses Erlebnis am 2. 8. 1787 entstanden. Die Überschrift heißt:
„An… 1785.“
„O wie oft erwacht in meinem Herzen
Liebevoll dein Bild;
Statt der Freude fühl’ ich bitt’re Schmerzen
Und mit Sehnsucht meine Brust erfüllt.
Jener Stunde dacht’ ich weinend immer,
Da ich einst dich fand;
Dachte Dein beim sanften Abendschimmer
Oft an meines blauen Flusses Strand.
Endlich heilte meiner Liebe Wunden
Die wohltät’ge Zeit;
Und mein Herz hat wieder Ruh’ gefunden,
Aber, glaube, nicht Vergessenheit.“
Aus Madras schrieb Heron noch einmal an den Freund Knebel, der später den Brief an Lotte weitergab. In ihrem Tagebuch klagte sie ihrer Romanze nach, es hieß da in einem englischen Zitat: „It’s the hardest science to forget.“
Warum der junge Mann sich nicht heftiger um die anmutige Charlotte bemühte, der auch der hochdotierte und hochangesehene Herr von Knebel in aller Korrektheit ein wenig nachstellte – das blieb sein Geheimnis. Mag sein, daß ihm die Karriere doch wichtiger war, daß die Aussichten eines Ausländers, zumal eines Zweitsohnes, dessen älterer Bruder Patronatsherr und Lord wurde, der Mama Lengefeld zu dürftig waren, daß ihm selber nur die Möglichkeit einer späten reichen Heirat blieb – Lotte jedenfalls lernte die „hardest science“, zu vergessen nämlich, und beschied sich mit der Erinnerung.
Heron schrieb ihr noch aus Rotterdam und dankte ihr für ihr Abschiedsgeschenk, einen kleinen Reiher in winziger Uniform, das ihn immer begleite – Heron heißt „Reiher“ … Lotte schickte ihrem „Reiher“ ihre Silhouette, und er schrieb ihr darauf:
„Ich habe eine kleine schwarze Gefährtin, sie wird beständig meine Gespielin sein. Ihr ruhiges heiteres Aussehen wird mir manche schwermütige Stunde erleichtern, und in der Betrachtung derselben werde ich mich belebt fühlen durch einige der reinen Gedanken, die das Urbild beseelen.“
Weil Frau von Lengefeld ihre Töchter und vor allem die jüngere Lotte bei Hofe und natürlich in Weimar unterbringen wollte, mußte die Kleine französisch sprechen können, und Frau von Stein, Gönnerin und Beraterin der Lengefelds, riet dringend zu einer Reise in die französische Schweiz; Frankreich selber, vollends Paris, schien doch zu unsicher.
Aber die chère mère hatte große Sorgen: eine solche Ausgabe war nur mit Schulden zu bestreiten! Karoline, ach, Karoline hatte doch einen Bewerber, der reich war… nur, die Tochter sträubte sich gegen die Verbindung mit dem jungen Herrn von Beulwitz, der ein trokkener, zuverlässiger, aber langweiliger Geselle war. Er war nicht einmal charmant, und Karoline, die Temperamentvolle, brauchte Attraktionen, Abwechslung, blitzende Lebendigkeit, und sie war erst siebzehn Jahre alt!
Endlich erreichte die Mutter mit vielerlei Lamento und drängenden Vorwürfen, daß Karoline wenigstens in eine Verlobung einwilligte – die konnte man noch lösen, und bis zur Hochzeit verginge noch Zeit.
„Bedenke, Kind, wie sich Königstöchter für Land und Familie opfern müssen; und für dich ist es nicht einmal ein Opfergang – dieser nette, ordentliche, wohlerzogene junge Mann, strebsam und sichtlich für eine große Karriere ausersehen!“
Und Beulwitz schickte Blumen und Schmuckstükke und umwarb die „kleine Braut“ mit bewundernden Blicken. Karoline erlaubte kaum Zärtlichkeiten.
Die Mama hatte es also nicht lassen können, von der so notwendigen Schweizer Reise zu reden, und welchen Kummer es ihr mache, daß sie die Zukunft der „armen kleinen Lolo“ nun auf immer zerstören müsse, weil sie ja doch eine solch wichtige und entscheidende Studienfahrt nicht machen könnten – des leidigen Geldes wegen… Ach, das Unglück ihres Gatten, dieses unver diente Leid! Und wie er sich noch auf dem Totenbett damit geplagt habe, die Seinen so mittellos und die Mädchen ohne Ausbildung zu verlassen!
Herr von Beulwitz verstand; und weil ihm wirklich an der sprühenden, blühenden Karoline lag, bot er an, die Reise zu finanzieren.
Karoline, die sich eigentlich auf die Abwechslung gefreut hatte, sah das alles nur ungern: ein so großes Geschenk verpflichtete, und sie war es, die den Preis bezahlen mußte.
Sie versuchte, die Hochzeit hinauszuzögern, bis die Reise vorüber wäre; aber sie, die seither robuster und vitaler gewesen war als Lolo, litt plötzlich an einem nervösen Gesichtszucken, das der Arzt auf ein zu kühles Bad zurückführte. Lolo strich der Schwester über Stirn und Wangen, wenn es sie wieder befiel, und Karoline selber beobachtete ihr seltsames Leiden im Spiegel, so oft sich ihr Gesicht zur Grimasse verzerrte …
„Manchmal kommt es mir vor“, sagte Lotte einmal leise, „als hättest du’s dir gewünscht – wie die heilige Kümmernis ihren Bart!“ Und sie erzählte der Geplagten die Legende von der christlichen Königstochter, die den
Männerbart bat, sodaß der Bewerber sich mit einigem Befremden von ihr abkehrte.
Die Fahrt in die französische Schweiz kam zustande. Man fuhr in mehreren Kutschen; zuerst in Richtung Stuttgart – und dahin fuhr man elf Tage lang: Frau von Lengefeld, die beiden Töchter und der Baron von Beulwitz, mit einigen Bediensteten und viel Gepäck.
Anfang Mai 1783 wollte man in Stuttgart sein, freilich nicht auf dem schnellsten Wege.
Bequem waren die Fahrten in der engen Kutsche ohnehin nicht, aber erträglicher durch allerlei eingeplante Aufenthalte, Besuche, Abstecher, so daß eine solche Reise ein langdauerndes, aber erlebnisreiches Unternehmen war. Und wenn nicht alles zum wilden Abenteuer ausartete, kein Rad brach, kein Straßenräuber sich von einem überhängenden Baum aufs Kutschendach fallen ließ und mit einer riesigen Pistole „Geld oder Leben“ verlangte, dann war man schon recht zufrieden.
Trotzdem war’s ein übles Gerüttel und Gestoße, bei nassem Wetter mußte die Wagenplane geschlossen bleiben, so daß die Luft beengend lastete, und auch die Pferde konnten ihre Launen haben, oder gar auf den Poststationen keine guten, kräftigen Tiere bereit sein.
Immerhin, man war enger zusammengerückt, man lernte sich noch besser kennen, man teilte Proviant und manche körperlichen Beschwerden miteinander, und Beulwitz erwies sich als diskreter und hilfreicher Kavalier.
Die Fahrt ging über Coburg, Lichtenfels, Bamberg, Forchheim, Nürnberg, Dinkelsbühl, Ellwangen und dann über Gmünd und Schorndorf nach Stuttgart.
Es war noch hell, ein lauwarmer Maiabend. Man wollte Frau von Wolzogen besuchen, eine Tante der chère mère, die in Stuttgart wohnte, um ihren vier Söhnen nahe zu sein, die – wie einst Schiller – die Hohe Carlsschule des Herzogs Carl Eugen besuchten. Der Herzog sammelte dort bekanntlich begabte junge Leute. Alles, was ihm geeignet schien, Ruf und Ruhm der Anstalt und des Landes zu erhöhen, holte er in seine Schule, um „tüchtige Beamte und Gelehrte“ auszubilden, in seinem Sinn und unter seiner Hand – und nach Ausfertigung eines „Revers“, der in den lebenslangen Dienst des Fürsten verpflichtete.
Die „Akademie“, die der Kaiser später in den Rang einer Hochschule erhob, wurde militärisch geführt, mit strengem Reglement, in dem auch der Rangunterschied zwischen Bürgers- und Adelssöhnen deutlich gewahrt wurde.
Aber ihren guten und immer weiterreichenden Ruf dankte die Schule nicht nur dem Rang und den Verbindungen des Herzogs, sondern auch ihren ausge zeichneten Dozenten, die Carl Eugen meist aus Tübingen holte, junge hervorragende Gelehrte, wie den Professor Abel etwa, mit dem Schiller später noch lang freundschaftlich verbunden war.
Frau von Wolzogen freute sich auf den Besuch der Nichte, mehr noch auf die Großnichten, und beschaute mit beherrschter Neugier den vorgesehenen Gemahl der jungen Karoline. Er gefiel ihr nicht durchaus, obwohl Lotte, die Gutherzige, loyal seine Partei ergriff, als die Schwestern mit der Tante allein waren.
Denn Karoline machte keinen Hehl aus ihrer Abneigung, mindestens zeigte sie ihr Unbehagen, wenn die Rede auf eine dauernde Verbindung kam. Die Vorstellung quälte sie sichtlich, daß Beulwitz als Gemahl, als Herr und Meister, ihr seine Anweisungen aufzwingen würde. Und eines Tages könnte er dann doch ihre Abhängigkeit von seinem Reichtum betonen.
Freilich, zunächst standen angenehmere Eindrücke bevor: Frau von Wolzogen hatte viele interessante Bekannte, sie erzählte von ihren weitgespannten Verbindungen. Die Sprache kam auf Schiller, den vielberedeten, dem sie einst auf ihrem Gut Bauerbach Asyl gewährt hatte. Fahnenflüchtig als „entloffener Regimentsmedikus“ war er ihr Gast, ein unermüdlich schreibender, eingemauert von Bücherbergen und monatelang von ihrer Hilfe abhängig gewesen. Damals, so wußte man, war der „Don Carlos“ entstanden.
Man nahm sich Zeit – Frau von Wolzogen zeigte ihren Gästen bei bequemen Wagenfahrten Stuttgart und seine Umgebung, die Filderhöhen und das Neckartal, lauter harmonische Eindrücke, fast zu harmonisch für die leicht gereizten Nerven Karolines, die ein paarmal mit betontem Stöhnen auf Beulwitzens banale Bemerkungen reagierte; heiter und dankbar aufgenommen von Lotte, der ein lieblich-sanft geschwungener Bergrücken, schimmerndes Licht im Fluß, Weinberge im Abendglanz kleine dichterische Anwandlungen verschafften, die sie – ihrem Alter entsprechend – erfreut registrierte und abends im Gastbett als etwas epigonenhafte Reime zu Papier brachte.
Den Besuch der berühmten Hohen Carlsschule mochten sich die Damen nicht versagen. Er gehörte, vom Herzog empfohlen, für gebildete Gäste sozusagen zum obligaten Programm.
Lotte hatte später, wohl doch unter dem Eindruck von Schillers Erzählungen, über den bedrückenden Anblick berichtet, den die reihenweise aufmarschierten Burschen, die auf Befehl und im gleichen Rhythmus beteten und ähnlich abgezirkelt aßen, im Speisesaal der „Hohen Schule“ gemacht hatten: Uniformiert, mit exakt gedrehten Zöpfen, mußten sie gleichsam täglich die unentrinnbare Autorität ihres Brotherrn spüren, der ihnen bei festlicher Gelegenheit als gütiger Mäzen vorgeführt Wurde.
„Meine Söhne“ – das war freilich nicht nur eine vertrauenheischende Floskel, sondern traf die Wahrheit in einigen Fällen genau: Carl hatte in seiner geliebten und gepflegten Anstalt wirklich etliche seiner „Nebensöhne“, und einige, wie der Herr von Ostheim, wurden von Lehrern und Aufsehern wahrscheinlich mit mehr Nachsicht behandelt als etwa der Eleve Schiller, der „nur“ der Sohn des Feldschers Caspar war.
Der hatte es freilich durch seine zähe Tüchtigkeit schließlich bis zum Hauptmann, sogar am Ende zum Major gebracht, und das war gewiß ein seltener Fall, da das Offizierkorps sich fast nur aus dem Adel rekrutierte, eine Regel, die sich lang wirksam hielt und noch über hundert Jahre hin galt.
Frau von Wolzogen hatte den Besuch bei den Eltern ihres Bauerbacher Schützlings angemeldet. Man fand die Schillers auf der Solitude und plauderte, ein wenig gehemmt wohl, auch mit der Schwester Christophine, die Lottes hübsches „blaues Jäckelchen“ bewunderte.
Elisabeth Dorothea Schillerin, die geborene Kodweiß, Wirts- und Bürgermeisterstochter, war eine geduldige, gütige Frau, bescheiden und gescheit und mit ein bißchen schelmischem Humor, den sie wohl neben dem knorrigen Mann nötig hatte.
Der Vater Caspar hatte sich durch schwere Jahre in Feldzügen und Seuchenzeiten durchgeschlagen, hatte seine wache, „vorspringende“ Intelligenz, seine geistige Neugier dabei kaum befriedigen können, aber, oft genug todmüde, nach dem bitteren gefährlichen Dienst noch gelesen und gelernt. Nur als Feldscher durfte er ein Weniges von der Sehnsucht nach medizinischem Wissen, physiologischen und anatomischen Zusammenhängen stillen.
Er sah gewiß auch Ungerechtigkeiten und Übergriffe, nahm Anstoß an dem – wie er es nannte – „Lotterleben des Hofes“, aber seine militärische Disziplin und seine Ehrfurcht vor der gottgegebenen Obrigkeit hielten jede obstinate Regung im Zaum. Seine Vorstellung von Korrektheit und Ordnung nahm ihm auch jedes Verständnis für das großzügige Schuldenmachen des genialen Sohnes.
Daß Dalberg Friedrich Schiller zum Theaterdichter „ernannte“, daß er gegen die Verpflichtung, jährlich drei Stücke zu liefern, ein festes Gehalt bekommen sollte – davon hielt der Vater Schiller nicht sehr viel.
„Fiesko“ hatte – nach anfänglicher Ablehnung wegen Schillers schwäbisch gefärbter Sprache beim ersten Vorlesen – endlich in Mannheim Erfolg gehabt, aber der hielt nicht lange vor.
Und die Schauspieler nahmen lieber die eingängigen Rollen in Ifflands Stücken an als die psychologisch anspruchsvollen des jungen Dichters, in die man sich versenken und einarbeiten mußte, ohne die herkömmlichen, üblichen Töne anzuschlagen – Pathos, Sentiment, billige Gefühlseffekte, die das wenig kritische Publikum zu Beifallstürmen und Tränenbächen rührten.
Das alles und die pietistisch getönte Abneigung gegen das Theater als „Tummelplatz lasterhafter Bohemiens“, wie Caspar Schiller es sah, ließen ihn brummig und verlegen, wenn auch mit zurückhaltender Höflichkeit auf die Fragen nach dem Sohn antworten.
In der bescheidenen Stube – ein Tisch, Sessel, Stühle, eine eingelegte Kommode und ein Spiegelschrank – saß man eine Weile und trank Kaffee, den Elisabeth Dorothea aus der Küche hereintrug: Eine bauchige bemalte Kanne, Goldrand tassen, dazu Hefegebäck – man war ja angemeldet gewesen.
„Ja, der Fritz …“
Die „Räuber“ hat man gesehen – die Zuschauer haben geschrien und geschluchzt. Es ist eine neue Art von Theater, die da gespielt wird, und doch sind’s die alten theatralischen Effekte – der schwarze und der weiße Sohn und der verhungernde Vater.
Aber da ist eine Wandlung, Erklärung, Auffaltung des „guten“ Carl, der auf einmal zum Räuber und Mörder wird und doch edel bleibt –
„Versteh’s, wer’s kann!“ … –, Caspar Schiller schüttelte den Kopf.
„Warum er den Braven ,Carl‘ heißt – wie unseren Souverain?“ wollte die Mutter wissen.
„Und ,Franz den Schurken?“ fragte Lotte dagegen.
„Ob da die katholische Kirche nicht beleidigt ist? Franz klingt katholisch.“
„Die wär’s noch mehr mit den wilden Szenen …: das Nonnenkloster …, und im ,Carlos’ erst …“
„Man sagt, der echte Carlos sei mit Folter und Hunger zum Wahnsinn getrieben worden und nach einer Woche im Kerker gestorben …“, wußte Caspar.
„Und die ,Räuber’? Ist die Geschichte irgend einmal so geschehen?“ fragte jetzt Karoline.
„Die hätt’ er vom Schubart“, sagte die Mutter aus ihrer Ecke, wo sie neue Milch eingoß.
„Und Schubart? Der Gefangene vom Asperg? Seit sieben Jahren gefangen?“ fragte jetzt Beulwitz, der seither geschwiegen hatte.
Man beschloß dann, einen Besuch auf dem „Tränenund Aschenberg“ einzuplanen. Der Vater Schiller wollte das vermitteln.
An einem Morgen, der mit leichtem Sprühregen alles grüner und blitzender machte und den hellgrauen Himmel wie ein silbrig durchschienenes Schleiertuch darüberbreitete, fuhren die Töchter mit der chère mère den ansteigenden Asperg hinauf; Beulwitz hatte sich entschuldigt.
Droben der düstere Durchgang zwischen dem fast schwarzen Mauerwerk, Eingang in die hingestreckte, lastend getürmte Festung.
Schubart hatte oft Besuch, sogar die Carlsschüler kamen herauf, vom Herzog geduldet, der den berühmten Gefangenen gern als Beispiel eines unbotmäßigen Untertanen vorwies, als abschreckendes Exempel dafür, wie man „so einen“ strafte.
Der Kommandant führte die Damen auf den Wällen herum – ach, ein schöner weiter Talblick, den Schubart in Versen gefeiert hatte.
Lotte ergriff die Vorstellung, daß ein Dichter ohne Möglichkeit des Widerhalls, ohne Wirkung auf seine Zeitgenossen, isoliert und der Stimme beraubt leben müßte; der Kommandant versäumte freilich nicht, mit dem Schauobjekt seiner Festung, dem Dichter, zugleich seine geduldige und tolerante Aufsicht zu demonstrieren – Schubart hatte 1783 und das folgende Jahr schon lange die Erlaubnis, „auf den Wällen zu ambulieren“, Klavierstunden zu geben, mit vielen Bekannten zu korrespondieren – er war, so verstand es Carl Eugen, nur noch in leichter Haft, um „sein unmäßiges Feuer zu dämpfen“, wie der Herzog das in Schillers Carlsschultagen ausgedrückt hatte; damals hatte er freilich Schiller gemeint.
Was die gescheite Franziska, die Gefährtin des Herzogs, ihrem Carl immer wieder vorstellte, bedachte der nicht: Daß er den aufbrausenden Rebellen damit – trotz aller humanen Versorgung – zum Märtyrer machte und mithalf, das geheiligte Gebäude der Autoritäten, des geweihten Souverains, zu untergraben.
Vielleicht, so blitzte es durch Lottes Gedanken, war diese Märtyrerrolle eindrücklicher als alle seine Verse und Lieder und Schriften …
Man schickte eine Ordonanz in Schubarts Zelle; der Mann rapportierte, der Herr Professor bitte um etwas Geduld, er sei noch nicht adrett hergemacht und etwas derangiert.
Man führte die Damen inzwischen auf dem Festungshof herum, wo gerade exerziert wurde, bis dann aus einer kleinen Tür ein Trupp Gefangener sich herauswand wie eine graue müde Schlange, einer nach oder neben dem anderen, gebeugte haarsträhnige Köpfe, kaum ein Aufblicken, Ketten an den Handgelenken, schlurfend, langsam.
Da rief jemand aus dem Fenster über ihnen, der Herr Professor lasse bitten.
Schubart war (schon nach dem ersten schweren Jahr) ein bevorzugter Gefangener, allein in der Zelle, die er sich ein wenig bequemer ausstatten konnte. Ein Besuch, vollends von Frauen, war freilich aufregend und alarmierend für den Mann, der im Gleichmaß versunken und in seiner Hoffnungslosigkeit und Verbitterung eingeschnürt lebte. Man hatte ihm gesagt, acht Jahre nach seiner Verhaftung werde er seine Familie sehen dürfen – Helene, seine Frau, der er verzweifelte Briefe schrieb.
Kurz vor diesem Damenbesuch hieß es in seinem Brief an die Frau: „Der Herzog muß äußerst gegen uns aufgebracht seyn, weil mein siebenjähriger Kerkertod ihn noch nicht auszusöhnen imstande ist… Inzwischen bin ich fest gesonnen, einen neuerlichen Versuch für meine endliche Erlösung zu wagen … Wie gern wollte ich alles wagen, wenn es Dir erlaubt wäre, mich zuweilen auf einige Tage besuchen zu dürfen und meinen Gram auf Deinem Herzen zu verweinen! Aber schrecklich ist’s, daß uns der Herzog so ganz und gar verkennt und uns für eine verdächtige Zigeunerbande anzusehen scheint. Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Seele!“
Aber die Hoffnung, die Seinigen bald zu sehen, wurde immer wieder – bittere Seelenfolter! – zunichte gemacht.
Und da kamen nun drei Frauen aus der „oberen Welt“, gepflegte ansehnliche Wesen in modischer Tracht, etwas, das er längst nicht mehr kannte. Die Mutter, Madame von Lengefeld, ein wenig dicklich und ein bißchen geziert, mit scheuen, flackernden Augen und gedrehten Schläfenlocken, rosarot und seidenraschelnd, im braunroten Überwurf – (so müßte Helene sich jetzt kleiden, wenn sie nur Geld genug hätte) – und die Töchter, die untersetzte Karoline, die er zuerst für die jüngere gehalten hatte, ihrer runden Wangen wegen, und die andere, die man ihm als Charlotte vorstellte – er verneigte sich vor ihnen allen, vor jeder einzeln – am tiefsten vor Charlotte mit dem langfallenden braunen Haar, den großen rührenden Augen; er nahm den schlanken Hals wahr, die zartschimmernde Haut, die schmale Gestalt – und schaute und schaute, obwohl er sich seiner peinlichen Lage bewußt war, so ungepflegt und schlecht frisiert vor ihnen zu stehen, die ihm wie Engelswesen erschienen.
Der Kommandant von Scheeler beobachtete wohlwollend die Szene, wie er überhaupt gern arrangierte, nicht ganz so berechnend wie sein Vorgänger, der Obrist Rieger, der den Schubart wie eine Fliege in seiner Hand hatte tanzen lassen, als er ihm den „Dr. Ritter“ zuführte und das Gespräch – etwas gewaltsam – auf das neue Schillerdrama lenkte, auf die „Räuber“, über das er, Schubart, eine Rezension hatte drucken lassen – bis Schubart sich, endlich aufgeklärt, in hingerissener Begeisterung und Freudentränen „ergoß“ und Schiller umarmte.
Von dieser Szene hatten die Damen gehört. Man berichtete, wie der junge „Räuber“-Dichter gerührt die Umarmung des Gefangenen empfing, und was für ein lebhaft angeregtes Gespräch zwischen den beiden hin und her gegangen war.
Jetzt, als die drei Frauen ihre zierlichen Schuhe trippelnd auf dem unebenen Steinboden des Verlieses bewegten, Schubart stehend die Hände rieb und der Wärter sich um Stühle bemühte – diesmal kam kein feuriges Gespräch zustande.
Karoline fragte schließlich in eine peinliche Pause hinein, was man denn für ihn, den gefangenen Poeten, Hilfreiches tun könne.
Aber sie merkte gleich darauf, daß solche Themen, die ja eine Bedürftigkeit voraussetzten, in Gegenwart des Kommandanten unerwünscht waren.
Schubart, im Bemühen, die Damen für die Anstrengung ihres Besuches zu entschädigen, fragte leise und demütig, ob es wohl statthaft sei, daß er sein Gedicht über den Ausblick von der Mauer vortrage? Und beim Nicken des Kommandanten fing er schon an, heiser und selbst gerührt, zu deklamieren:
„Schön ist’s, von des Thränenberges Höhen
Gott auf seiner Erde wandeln sehen,
Wo sein Odem die Geschöpfe küßt …
Schön ist’s, in des Thränenberges Lüften
Bäume sehn in silberweißen Düften,
Die der Käfer wonnesummend trinkt, …
Und der Neckar, blau vorüberziehend,
In dem Gold der Abendsonne glühend,
Ist dem Späherblicke Himmelslust.
Und den Wein, des siechen Wand’rers Leben,
Wachsen sehen an mütterlichen Reben,
Ist Entzücken für des Dichters Brust …
Aber, armer Mann, du bist gefangen,
Kannst du trunken an der Schönheit hangen?
Nichts auf dieser schönen Welt ist dein!“
Schubart stockte auf einen Wink des Kommandanten, der ihn vorsichtig zur Bank führte, auf der er sonst saß.
Aber er, der sich einen Augenblick lang die Stirn gewischt hatte, stand gleich wieder da, hielt sich an der Mauer und deklamierte mit tönender Stimme, ein bißchen zu pathetisch, wie es Lotte schien:
„Alles, alles ist in tiefer Trauer
Auf der weiten Erde, denn die Mauer
Meiner Veste schließt mich Armen ein …
Doch herab von meinem Thränenberge
Seh ich dort den Moderplatz der Särge,
Hinter einer Kirche streckt er sich, …
Grüner als die andern Plätze alle –
Ach, herab von meinem hohen Walle
Seh ich keinen schönem Platz für mich!“
Während der Kommandant mit gefaßter, geübter Geduld aushielt, die Mama sich wohlerzogen und etwas verlegen über die Szene hinwegrettete, von künstlerischen Regungen unberührt, stand Lotte still und in sich gekehrt in einer Ecke und schaute großäugig und mitleidig auf den zerzausten, verstörten Mann, dem in seiner jahrelangen Isoliertheit jedes Selbstgefühl, sogar alles Maß für Abstand und Begrenzung verloren gegangen war; er wußte selber kaum noch, was erwünschtes Pathos, beabsichtigte Rührung – und was echtes Leiden ist …, ein Entwürdigter, der seine Persönlichkeit kaum mehr aufzubauen fähig sein würde, wenn er … ja, wenn er freikam.
Karoline, scharfen Verstandes, aber voll überschwellenden Gefühls, hatte die Deklamation nur mühsam überstanden – jetzt, bei den erschütternden Schlußsätzen, fing sie plötzlich an zu weinen.
Der Oberst trat auf sie zu und berührte ihren Arm, um sie vorsichtig gegen die Tür zu lenken, die chère mère folgte schnell nach, Lotte zögerte noch einen Augenblick und ging dann auf den Mann zu, der erschöpft auf sein Schemelchen hingesunken war. Er hatte die Augen wie in Scham zugedrückt und den Kopf gesenkt; da nahm sie seine herabhängende Hand und hob sie an ihren Mund. Dann lief sie schnell den anderen nach.
Schubart, als ein Exempel für den Unwert des Geistigen in diesem System, ist für Lotte so eindrücklich, daß sie kaum mehr Augen für ihre Umgebung hat; Karoline sieht alles realistischer, so stark und übersteigert sie die Augenblickseindrücke aufnimmt: sie merkt bei allem Mitgefühl auch etwas von Schubarts Überschwenglichkeiten, eben weil sie auch zu ähnlichen Reaktionen neigt. Sie spürt Verwandtes und ahnt Gefährliches, vor dem sie sich selber zu hüten gelernt hat – ganz in Beulwitzens Sinn. Bloß, ob das immer gelingen könnte? Sie hofft es, aber sicher ist sie nicht, Augenblicksmensch, der sie ist …
In der Carlsschule lebt seit zwölf Jahren der junge Wolzogen; als er eintreten mußte, war er ein Kind von sechs Jahren, und oft genug verzweifelt, meint seine Mutter, die mit den Rudolstädterinnen eines Tages zu Besuch in die Hohe Schule kommt.
„Erstaunlich“, sagt sie, „daß man auch die beiden jungen Damen zuläßt, Karoline, die Braut, und Lotte, das Mädelchen“! Denn – so hat Schiller später gesagt – ,man erlaubte Damenbesuche nur, ehe die Frauen anfingen, interessant zu werden, und nachdem sie aufgehört hatten, es zu sein …‘
Der junge Wolzogen, jeder Weiblichkeit ungewohnt, da der einzige „fernverehrende“ Aufblick nur der Gefährtin des Herzogs, der Reichsgräfin von Hohenheim, gelten durfte, spürte wohl, daß Lotte noch vom Eindruck der „gefesselten Geistigkeit“ in Schubarts Gestalt und der unwürdigen Zwänge in der Carlsschule erfüllt war, er spürte auch Karolines unternehmende Neugier, vielleicht sogar die Sehnsucht, auszubrechen und sich eine neue Welt zu erobern, und sicher sah er auch ein bißchen Koketterie; und obwohl er wußte, daß sie mit Beulwitz verlobt war, verliebte er sich heftig in Karoline.
Sie selber empfand die glühende Aufgeschlossenheit des jüngeren Mannes und auch eine sofort überspringende Sympathie, die Beulwitz kaum bemerkte.
Für ihn war es eine Aufgabe und Anstrengung, beständig der anspruchsvollen geistigen Beweglichkeit und den phantastischen Einfällen seiner Braut nachzukommen; er war es müde, mehr als das „am Wege Liegende“ zu denken und zu tun, und Karoline merkte den Zwang, den er sich ihr gegenüber antat.
Beulwitz hatte sich unterwegs für die „Weltenuhr“ des Pfarrers Hahn interessiert, als man Echterdingen besuchte. Das mathematisch ausgeklügelte Getriebe, das einem mystischen Glauben seine Ursprünge verdankte, galt als eine Sensation, der Herzog Carl Eugen durch die Aufstellung in seinen Hohenheimer Anlagen seine Reverenz erwies – freilich in dem Bestreben, das Genie „seiner Schwaben“ (unter seiner Regierung!) für fremde Besucher deutlich zu machen.
Die „Weltenuhr“ sollte Tag und Stunde des Weltlaufs und – Untergangs anzeigen, ein kompliziertes Getriebe, das der skurrilen, kulturträchtigen Anlage der Schwaben entsprang: dem technischen Genie und dem philosophischen Trieb. Und wie lang haben sie versucht, beides zu verbinden! Wie viele Irrwege, krumme Gäßlein und verschnörkelte Bahnen führten da unter ungeheuren Opfern und Mühen endlich doch in die Nähe einer weltverwandelnden Wahrheit!
Der Pfarrer, Mystiker und Pietist, dem – fast wie dem größeren Schwaben, Johannes Kepler – „die Ausforschung des göttlichen Willens und Wesens“ seine mechanische Tüftelei befohlen hatte, erhungerte sich sein Theologiestudium in langen Jahren und zog sich dadurch wohl sein schweres Magenleiden zu, an dem er schließlich starb: ein tiefernster, wissender Frommer.
Unbekümmert reimte Schubart, so hörten die Damen, um Hahn mit einem Poem zu huldigen, wie er alles Erreichbare in seine dichterische Formung einbezog. Da hieß es dann:
„Komm und lasse dein Kornwesten,
Sag es auch den andern Gästen.
Engel, die Befehle bringen,
Rufen dich nach Echterdingen …“
Das war dem Geistlichen zugerufen, als er aus der Kornwestheimer Pfarre nach der besseren, Echterdingen über Stuttgart, beordert worden war.
Die Reisegesellschaft setzte ihre Fahrt fort:
In Vevey am Genfer See bezog man bestellte Quartiere, es gab alte Bekannte, frühere Lehrer der Mädchen, die Briefe und Grüße Weitergaben, man fand erfreute und erstaunte Gesichter und auch bald willige Bereitschaft, den gesellschaftlichen Verkehr aufzunehmen und zu pflegen, den Madame sich als üblichen Rahmen für die erstrebte französische Konversation ausbedungen hatte. Es gab Ausflüge und Teenachmittage, Exkursionen und Abendkonzerte, und die Tochter des Landvogts Lentulus wurde Lottes Freundin.
Von Neuchâtel aus besuchte man auch Rousseaus Zimmer auf der Petersinsel, redete und stritt über seinen „Contrat Social“ untereinander und war insgesamt in den Theorien viel extremer und unbedingter, als man es in der Praxis leiden mochte. Gelegentlich sorgte die Mama dann dafür, daß Lotte nicht nur beim Geplauder, dem sie meist nur zuhörte, Französisch lernte – es sollte ja ein klassisches, hoffähiges Idiom sein – man ließ den Monsieur Fauçonnier kommen, daß er mit Strenge und Eifer sein Wissen vermittle – und Lotte nahm das ohne großes Interesse hin.
Der Magister war ein ungewöhnlicher Mann, wie man sie in der Zeit der Auflösung aller bisher gültigen Begriffe jetzt manchmal fand, ein ehemaliger Jesuit, der den Orden um einer Frau willen verlassen hatte, verfemt zwar, aber wegen seiner Tüchtigkeit geduldet, auch ein angenehmer Unterhalter, wenn er sich und seiner Schülerin eine Pause gönnte.
Lotte fühlte sich der Mutter gegenüber beruhigter und dem opferbereiten Beulwitz weniger verpflichtet, der diesen Unterricht bezahlte.
Auch die chère mère sah ihren Zweck erreicht; nur Karoline war immer in Unruhe, ritt, ruderte, schwamm und wanderte, getrieben, in unpraktischen Kleidern und immer in Begleitung des treuherzigen Beulwitz, der auch ihre ausgefallensten Wünsche erfüllte.
Im Mai 1784 ging’s auf die Rückreise. Reisen war Erleben, nicht nur „transportiert werden“.
Lavater wurde wieder aufgesucht. In Speyer traf die kleine Gesellschaft Sophie von Laroche, die Frau des Kurtrierischen Kanzlers, die einmal Wielands Braut gewesen war. Sie gab eine Zeitschrift „Pomona“ für „Teutschlands Töchter“ heraus, die Karoline interessierte; sie bot ihr einige von ihren Essays für die „Pomona“ an, die gerade viel gelesen wurde.
Beulwitz benutzte die Fahrt in den Süden zu einem Abstecher nach Lyon, aus welchen Gründen auch immer. Als er wieder zu der Gesellschaft gestoßen war, setzte man schon ein wenig müde zu viert die Reise fort.
Die Damen von Lengefeld hatten sich vorgenommen, in Mannheim den bereits berühmten Autor der „Räuber“ kennenzulernen; den Anlaß boten die Grüße der Eltern, die man auf der Solitude besucht hatte, und die Beziehung zu Frau von Wolzogen.
Am 6. Juni 1784 wollte man bei dem „Theaterdichter“ einkehren, dessen Name auch im thüringischen Weimar schon mit Achtung, mindestens mit Neugier genannt wurde.
Lotte und Karoline waren gespannt auf die Begegnung, hatten sie sich doch nach Karolines Weise romantischphantasievolle Vorstellungen von dem beflügelten Genius gemacht und waren enttäuscht, als sie den Erwarteten in seinem Quartier nicht antrafen; er war an die frische Luft gegangen, wohl um sich zu sammeln, seine Mattigkeiten, die ihn immer wieder anfielen, aufzufangen, sein beständig lauerndes, leichtes Fieber abzuschwächen.
Man gab also, wie gesellschaftsüblich, nur die Karten ab, zur Erleichterung der Mama, die sich von dieser Begegnung nicht allzuviel versprochen hatte, zumal es sich weder um einen vermögenden noch auch um einen standesgemäßen Herrn handelte, der für die Töchter als Partner in Frage gekommen wäre: jedenfalls für Lotte, denn für Karoline hatte man gesorgt – sie würde sich mit Beulwitz schon arrangieren.
Kurz nach dem vergeblichen Besuch kehrte Schiller zurück, fand die Karten und eilte, noch etwas „derangiert“, wie Frau von Lengefeld fand, ins Hotel, da auf den Billetts etwas von seinen Eltern vermerkt war.
Den Herrn von Beulwitz kannte er nicht, auch die Lengefelds waren ihm nur dem Hörensagen nach bekannt; er traf sie im Aufbruch, zwischen Hutschachteln und hingeworfenen Schals, die Mama verlegen ob der Unordnung, die Töchter in den bereits aufgesetzten Kapotten und bemüht, die langen Handschuhe zur Begrüßung abzustreifen.
Schiller verbeugte sich, erst vor der Mama, dann, etwas flüchtiger, vor jeder der Töchter, wobei er die ernste Charlotte für die Ältere hielt, unerfahren wie er in diesen Dingen war.
Karoline strahlte, zeigte weiße kleine Zähne und deutete einen übertriebenen Knicks an.
Da man sichtlich an die Abfahrt mehr dachte als an den Besucher, tauschte man schnell die nötigen Floskeln aus, bestellte die Grüße der Seinen – es gehe ihnen recht gut, auch Christophine sei dagewesen – Lotte lächelte, ihr fiel das hellblaue „Jäckelchen“ ein, von dem sich Christophine ein Muster abgenommen hatte – die Mama fragte höflich nach den weiteren Plänen und zeigte sich leidlich über das bisherige Werk Schillers unterrichtet.
Lotte fand den Mann mit der verrutschten Halsbinde und dem leicht zerzausten rötlichen Haarschopf nicht sonderlich adrett, aber seine große hagere Gestalt – als er, bald genug, aufstand – irgendwie eindrucksvoll; sie hatte das Gefühl von etwas Unbedingtem, Kristallenem, das von ihm ausginge, und sah über den ausgeprägten Jochbögen der schmalen Wangen ein unverhofftes Aufblitzen der grauen Augen, irisierend, ins Blaue überspringend.
Beulwitz benahm sich korrekt, streifte aber den braunen Frack des Mannes mit einem abschätzigen Blick, ein Knopf fehlte sogar, die Schnallenschuhe waren staubig.
Schiller verabschiedete sich mit Dankesbezeigungen und Verneigung, und die Mama überließ ihm ihre Hand zum Kuß.
Auf der Heimreise besprachen die Mädchen den Eindruck – allzu sanft, nichts Wildes, Brausendes oder Hinreißendes, ein freundlich-schüchterner Mensch mit sonderbarem Dialekt, den er freilich zu verdecken suchte!
Und die Formen, die so wichtigen, tadelte die chère mère, wären ihm auch nicht eben angeboren, eher kämen sie als verlegene und unbeholfene Übungen zum Vorschein, wenn er sich Mühe gab – und doch hatte der Mensch ein schroffes Selbstgefühl, das er aus seiner Dichtung beziehen mochte … Madame von Lengefeld hatte das zähneblitzende Lächeln ihrer Ältesten bemerkt; sie hatte auch Beulwitzens vergebliches Bemühen erkannt, Karoline verständnisvoll zuzunicken, in gemeinsamer Kritik, um wenigstens so ein Einverständnis herzustellen.
Es wurde Zeit, ihr wildes Füllen an die Kandare zu nehmen, die früh Erblühte irgendwo zu verankern, nein, nicht irgendwo natürlich, nur da, wo es die ge schickte Mama für tunlich und zweckmäßig hielt, und nicht etwa mit einer so unsicheren Fessel, wie sie ein Poet bieten mochte.
Im September 1784 wurde die Trauung mit Beulwitz vollzogen; chère mère wohnte ihr mit einem – so schien es Karoline – beinah triumphierenden Lächeln bei; sie prunkte, in eine enge Korsage gezwängt, in dunkelrotem Samt, und Friedrich von Beulwitz machte bei der Zeremonie eine würdige Figur.
Schließlich hatte auch die chère mère, „als der erste Glanz verblichen war“ (so blumig hatte es Frau von Lengefeld ausgedrückt), da es also fader und grauer in ihrer Ehe wurde, ausgehalten, zumal als sich die Lähmung des Mannes zeigte, die schwere Hinderung in seinen Berufsgeschäften.
Karoline redete sich ein, sie würde sich zu helfen wissen, so oder so. Jedenfalls wollte sie durch keine verfrühte Schwangerschaft überrascht werden.
Man wohnte nicht weit voneinander, Lotte und die Mutter hatten ihr Haus fast neben dem Beulwitzschen, so daß sich ein häufiges Hin und Her zwischen den beiden Wohnungen ergab, vor allem zwischen den Schwestern, weil die Mutter jedes Alleinsein mit Karoline vermied, um keine Klagen zu hören.
Lotte übernahm, gutherzig wie sie war, treulich die Rolle der Trösterin, redete zum Guten, wie sie es verstand, und versuchte, die poetischen Neigungen der Schwester zu stärken.
Aber das nutzte nicht viel, im Gegenteil: Karoline geriet nach solchen vertraulichen Aussprachen mit Lotte immer mehr in eine bedrückte Resignation, sie redete von Selbstmord, auch wenn ihr das vielleicht nicht ganz ernst war, sie saß stundenlang untätig mit traurigen Augen am Fenster, und Beulwitz, der sie immer noch ganz zu gewinnen hoffte, suchte eifrig nach neuen Geschenken, die ihm Karoline näherbringen könnten.
Frau von Stein spürte die bedrückende Atmosphäre, wenn sie die Lengefelds besuchte, spürte auch die Apathie der armen Karoline, sobald Beulwitz in der Nähe war. Und Lotte, wie eine sich langsam entwickelnde, lang verschlossene Knospe, schien ihr gehemmt von der schwermut der schwester, die sie ja liebte und der sie doch nicht helfen konnte.
Vielleicht war es auch ein stilles Einvernehmen zwischen der chère mère und der „Tante Stein“, das dazu führte, Lotte aus diesem bedrückenden Dunstkreis herauszuholen und ins Steinsche Haus zu verpflanzen.
Frau von Stein führte die „Kleine“ in die Gesellschaft ein, nahm sie mit auf Hofbälle, und der Winter 1785 wurde für die eben noch kindliche Lotte zu einer Kette von blitzenden Festen und vergnüglichen Begegnungen, denen sie freilich keine große Bedeutung zuschrieb.
Es gab Spielabende und Laientheater, und wenn das Eis fest genug war, Schlittenpartien, keine gefährlichen wohl, denn die Damen wurden pelzvermummt in breiten, gepolsterten Gefährten von den Kavalieren übers Eis geführt.
Auch Goethe zeigte sich auf der blitzklaren Fläche, und ein paarmal schob er auch Lottes Schlitten, was gebührend bemerkt wurde.
Denn solche Auftritte galten dem Gesehenwerden, dem Kennenlernen, der harmlos-lustigen Geselligkeit, und Goethe, damals noch nicht fünfzigjährig, schwang sich gern mit jugendlicher Eleganz durch die Reihen. Vielleicht ging es aber dabei doch ein wenig geheimrätlicher zu als damals in seinen Studententagen in Leipzig oder gar in Frankfurt, als ihn die verliebte Mutter im wehenden Mantel, mit gekreuzten Armen dahinfliegend, strahlend bewunderte.
Freilich, auch hier war er der Mittelpunkt der Gruppe, wohin er sich auch wandte, selbst wenn in seinen Werken noch nicht jeder Sinn und Wichtigkeit erkennen konnte.
Im Kreis der Frau von Stein und der Lengefelds las man viel, alles Neue und Neuerschienene war wichtig, es wurde an Teenachmittagen diskutiert, Altes und Neues verglichen und kritisch abgewogen, Sprache und Aussage abgetastet und beurteilt. Dafür waren die langen Winterabende mit den flackernden Kerzen gut.