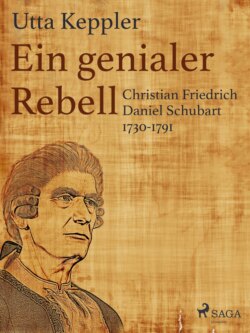Читать книгу Ein genialer Rebell - Christian Friedrich Daniel Schubart 1730-1791 - Utta Keppler - Страница 6
Keim aus gärendem Erdreich
ОглавлениеDer Vater Schubart hielt es jetzt für nötig, den Jungen in eine höhere Schule zu schicken, da ihm das Herumstreichen mit dem Hauptmann nicht gefiel, noch weniger aber der Einfluß Rieders, dessen lasches, genüßliches Wesen sich immer mehr in Launenhaftigkeit verkehrte, bis man ihm endlich wegen unzüchtiger Handlungen den Prozeß machte und ihn entließ.
Der Dekan wählte also das Nördlinger Lyzeum für seinen begabten Sohn, das der Rektor Thilo leitete, ein tüchtiger Philologe, der auch Theologie studiert hatte und sich mit der Ästhetik der Alten wie mit der Philosophie beschäftigte.
Jakob Schubart brachte den Jungen beim Chirurgen Seidel unter, der bieder und redselig, wie er war, den jungen Christian bald ein wenig in seine Profession einführte, bei allerlei Unpäßlichkeit beriet und ihm das Interessante seines untergeordneten Berufs anpries, den er mit Geschick und Schlauheit betrieb; denn es war durchaus nicht immer nur das Leibschneiden oder Brüche und Quetschungen, die er heilte, er riß Zähne und stach den Star und gab mit seinen skurrilen Geschichten dem Glauben und Aberglauben seiner Patienten zu kauen: Wie die Spinnweben im Stall gegen Warzen gut seien, erklärte er ihm, und was der Nachtschatten schade oder woher die Hexenringe aus Waldpilzen kämen und die glattgescheuerten rindenlosen Streifen an den Eichenstämmen. Er erzählte auch vielerlei von der „Kunst Aphroditens“, wie er sagte, und machte derbe Späße dabei.
Für Christian waren es zwei Welten, und beide behagten ihm – die klare, geordnete, gütig humorvolle Art des Rektors schulte ihm Geist und Verstand, und des Baders Geschwätz schläferte ihn ein wie laue, sumpfige, dumpfe Luft. Was ihm der Vater nahegelegt hatte und immer wieder anmahnte, den Ernst des Glaubens, konnte er nicht recht einsehen; der Religionsunterricht, den Thilo nicht selber gab, war dürr und trocken. Der Rektor führte seine Schüler – und Christian war sein bester – zu den Klassikern: Homer, Plato, Horaz und Cicero wurden vorgekaut und eingepaukt, aber auch über dem peinlichsten Eindrillen verloren sie nicht ganz ihren Schimmer. Schubart las für sich, abends in der Kammer, noch einmal und im Zusammenhang, was er in den Schulstunden hörte. Auch die neuen deutschen Dichter brachte Thilo zum Klingen.
Und dann die Musik, immer wieder brach diese Urbegabung durch: Schubart spielte jetzt fast virtuos, komponierte, sang, Rhythmus und Klang verlockten ihn zu eigenen Versen, die ihm allzuleicht flossen. Auf das Lissaboner Erdbeben dichtete er eine Nänied, stark gefühlt, in „schwellenden“ Tönen, fugierte Choralmelodien, und so nebenbei, fast unbewußt, entstanden Volkslieder, verspielte, derbe und sangbare Reime; ein Gang durchs Feld, eine Nacht im Wald – alles lag in ihm wie ein empfangener Keim bereit, und es brauchte nur ein Wort, eine Tonfolge, daß sich das Geformte fertig aus ihm löste und er es nur niederzuschreiben hatte – aber oft genug ließ er’s auch hinströmen, sagte es nur sich selber vor und verlor es wieder, da es ihm nicht kostbar genug war, um es zu halten. Es formte sich nicht immer ganz originell, manchmal in den Bahnen Klopstocks und Herders, oft als Hexameter. „So lebt ich also –“ sagte er später von jener Zeit – „zaumlos als ein luftiger, gedankenloser Jüngling mein Leben hin.“
1756 verließ er Nördlingen. Man erregte und empörte sich gerade heftig über den jungen Herzog: Carl Eugen hatte es arg getrieben, selbst nach dem Urteil der geduldigen Nördlinger, und was man von Stuttgart hörte, war zwar im Licht ähnlicher Affären nicht ungewöhnlich an europäischen Höfen, aber für die Schwaben auffällig genug: Der junge Fürst hatte sich nicht lang nach den Maximen Friedrichs von Preußen gehalten, die ihm dieser zur Thronbesteigung mitgegeben hatte, wohl wissend, daß er durch seine Beurteilung des Prinzen mitverantwortlich für seine Regierungsführung wurde. Er rate, schrieb der König, drei Jahre seiner Jugend „dem Vergnügen zu weihen“, dann aber zu heiraten und mit Ernst an seine hohe Stellung zu denken. Und obwohl Carl sich schon als halber Junge sterblich in seine künftige Frau verliebte, „weihte“ er sich weiterhin dem „Vergnügen“, wie er es als sein gutes Recht verstand.
Die sechzehnjährige Friederike von Brandenburg- Bayreuth, eine Nichte Friedrichs, galt als Schönheit mit den großen Brandenburger Augen und ihrer grazilen Gestalt. Geist und musische Neigung hatte sie von der Mutter, Friedrichs kluger Schwester Wilhelmine, mitgebracht. Aber es fehlte ihr der Humor, die Weite und Reife, um den neuen Forderungen gewachsen zu sein; sie war zu jung, um, wie Maria Theresia, keinerlei Ansprüche an die Treue ihres Gemahls zu stellen und ihn trotzdem zu lieben, zu hochmütig, um ihr bäuerlich gutherziges Volk zu verstehen, und bald auch zu verstört, um zu alledem auch nur den guten Willen aufzubringen.
Ihr erstes Kind, eine kleine Tochter, starb nach einem Jahr; Carl ritt, jagte, tanzte und feierte, ohne Rücksicht auf sie zu nehmen. Balletteusen und Sängerinnen, primitive, oft nur in ihrem Fach tüchtige Geschöpfe, waren seine wechselnden Gefährtinnen. Die fähigen Minister verabschiedete er schnell; um sich als selbständiger Herrscher zu bestätigen, ließ er unbewährte Berater Einfluß gewinnen, Kreaturen, die ihm geschickt schöntaten, zwielichtige Figuren, die ihn ausnutzten und immer mehr Ausgaben verlangten, denn es sei, so legte man ihm nahe, seine Aufgabe, den glanzvollsten Hof Europens zu präsentieren. Nur der Ruhm einzigartiger Berühmtheiten könnte diese Pracht verleihen. Unsummen brachte das Land auf, erpreßten die Werber und Finanziers, um die unübersehbare Fülle von Festen und Genüssen zu bezahlen.
Ein paarmal war Friederike, die sonst gern an Opern- und Theaterabenden teilnahm, verbittert zu ihren markgräflichen Eltern gefahren; aber sie kam immer wieder, gebeten oder gemahnt und mit Rücksicht auf den Klatsch der Höfe, kaum mehr Carl zuliebe. Dann floh sie endgültig und kam nie mehr zurück.
Christians Vater stammte aus Altdorf, der berühmten Hochschulstadt bei Nürnberg, in der auch Wallenstein studiert hatte und die später Erlangen hieß. Er bestimmte seinen Sohn für Nürnberg. Zwischen Nördlingen und Nürnberg, im Begriff, seinen Fuß in die größere Welt zu setzen, verschaffte ihm ein Freund die Gunst, in Stuttgart die Oper zu hören. Man spielte „Xerxes“ von Händel, und die Pirker, aus England kommend und unter Gluck ausgebildet, sollte die Amastris singen.
Der junge Mann aus der Provinz, schüchtern in seinem unmodischen Frack, den der Freund mit eigenen Tressen aufgebessert hatte, betrat das knarrende Parkett des obersten Ranges im Hoftheater. Der Holzbau roch dumpfig, unten summten die geputzten, gepuderten Zuschauer; oben drückte sich eine Gruppe von jungen Burschen zusammen. Die Hofloge war noch leer. Der steife gemalte Vorhang wogte im Licht der Kerzenreihen, als ein mächtiger Mann davor auftauchte: Der Musikdirektor Jomelli, „so begnadet wie füllig“, wie man sich zuflüsterte. Er wurde erstaunt betrachtet, endlich beklatscht. Aber er winkte mit der fleischigen Hand. Es sei keine erfreuliche cosa, die er zu verkündigen habe: Die célebre und von ihm hochgeachtete Primadonna Madame Pirkerin sei unpäßlich und könne nicht auftreten. Man habe deshalb schnell ein anderes Stück angesetzt, in dem sie nicht benötigt werde, ein Werk des Salieri aus Salzburg, der Mozarts Konkurrent gewesen war. Schubart begeisterte freilich auch das, wiewohl er die Marianne Pirker gern gehört hätte; später erfuhr der Freund, ein junger Musiker vom Hoforchester, die Pirker sei plötzlich verschwunden.
„Was?“ schrie Schubart aufgeregt, „das ist doch nicht möglich?“
„Doch, derlei gibt’s“, murmelte der andere betreten. „Man sagt, sie sei eine sonderliche Freundin der Herzogin gewesen, habe auch früher in Bayreuth gedient und sei des öfteren dorthin gefahren. Und dabei… aber darüber dürfe niemand reden.“
„Man kann sich’s denken“, bestätigte Schubart, „sie hat Briefe oder einen Bericht von der Herzogin mitgenommen, und was drinstand, weiß man schon.“
„Woher hörst du derlei?“ fragte der Freund.
Schubart wurde rot. „Vom Liesele“, bekannte er dann, „die hilft in der Hofküche.“
Der andere lächelte ein wenig blöde.
„Und jetzt?“ fragte Christian Schubart. „Er hat sie verhaften lassen! Ich ahne es schon!“
Der Musiker nickte; er war blaß geworden. „Und auch den Mann, den alten Pirker, und den Friseur Reich – alle miteinander“, ergänzte er flüsternd, „sie seien schon auf dem Twiel, ohne Verhör und Verhandlung…“
„Da sie zu Bayreuth des jungen Herren Sprünge gemeldet!“ sagte Schubart und sah sich unbefangen um. „Komm, Baste, oder magst lieber Drollinger genannt sein, da du nicht hörst?“
Der andere zuckte erschrocken zusammen. Drüben an der Mauer stand ein Mann und schaute herüber; er kannte ihn nicht, und Schubart hatte seinen Namen so laut gerufen.
Er zog den Freund am Ärmel mit, Schubart sträubte sich und schüttelte den Kopf.
Inzwischen trat der dunkle Mensch heran, mit raschen weichen Schritten war er plötzlich da. „Sie sind?“ fragte er.
Schubart mit seinem feinen, fast tierhaften Gespür für die Antriebe der Leute, antwortete spontan: Sie seien Reisende, Freunde des eben angekommenen Seigneur de Saingalt, der bekanntlich Gast des Herzogs sei – „Serenissimi… meinte ich“, setzte er gewandt hinzu.
Der Frager zog den schwarzen Schlapphut in die Stirn und lachte. „So, des Casanova Freunde – die kennt man hierzulande!“ Er blieb einen Augenblick stehen; während sein Gesicht im Schatten lag, verneigte er sich leicht. Dann ging er, mit den gleichen katzenhaften Wendungen, wie er sich genähert hatte.
Sebastian Drollinger nahm Schubarts Arm. „Das hätte schlecht ausgehen können“, flüsterte er, „’s war ein Spion des Herzogs – eher wie nicht!“
„Serenissimi“, verbesserte Schubart und lachte schallend. „Warum läßt er in den Gassen herumhorchen?“
„Von den Gefangenen soll niemand wissen“, meinte Drollinger, „das könnte uns übel aufstoßen, wenn ihn dein Casanovagerede nicht überzeugt hat.“
„Vielleicht erkundigt er sich bei dem Italiener“, vermutete Schubart und fing an zu trällern: „Wär ich der Herr Saingalt – ich würde nimmer kalt …“
„Still, Esel!“ zischte der Freund entsetzt, „mußt uns doch nicht noch einmal hineinreiten, du Leichtfuß!“
Ein paar Tage danach kam ein Bote zu Sebastian. Sein Name war genau vermerkt, obwohl er erst wenige Wochen in Stuttgart wohnte, und Schubart, der ohne Wissen der Eltern noch immer nicht nach Nürnberg abgereist war, saß dabei, als Drollinger das Schreiben öffnete.
„Verehrter unbekannter Freund, junger Mann!“ stand da, „des Durchlauchtigsten Sbirrene haben mich heute morgen besucht, als ich eben, noch schlaftrunken und von einer Aventure träumend, im Bette lag. Sie wollten hören, ob Sie mir bekannt? Und obgleich solches nicht zutraf, habe ich die Intrigue durchschaut und als Ihr treuer alter Freund fungieret. Nun aber wird es Zeit, diese Stadt zu meiden – tun Sie es rasch. Der Ihre, C.“
„Ich hätte wohl Lust, den Casanova wahrhaftig aufzusuchen“, eröffnete Schubart dem Freund.
„Das wäre das Dümmste, was wir tun könnten.“
„Warum?“ Schubart fing an, im Zimmer herumzutänzeln und beobachtete heiter, wie draußen die Schneeflocken wirbelten. Der andere schob Holz in den Ofen, der dieses Jahr noch nicht geheizt worden war. Es qualmte erbärmlich. „Ja, Baste, das tun wir – oder willst mich allein lassen dabei?“
„Du hörst doch, was denen geschieht, die sich bei Hof mißliebig machen“, warnte Drollinger, „ich bin drauf angewiesen, hierorts eine Stelle zu finden, mindestens Schüler, kann doch nicht den Häschern ungut auffallen.“
„Den Shirren? Er redet sie venezianisch an, der Casanova! Du, das ist ein feiner Herr, gelehrt, hört man, und weiß sich dem jungen Herzog angenehm zu machen, nicht bloß den Damen.“ Er blinzelte sehnsüchtig.
„Tu, was du magst“, murrte Drollinger, „diesmal mußt allein gehen.“
Schubart nickte. „Schad’,“ sagte er unter der Tür und war gleich danach in seinem Gasthof, einem alten Haus in einer unbeleuchteten Gasse, durch die der schmelzende Schnee den Unrat schwemmte. Schubart zog sich um. Er fragte den Wirt nach dem Quartier des Seigneur de Saintgalt und der riß die Augen auf und tuschelte ihm zu, der edle Gast bewohne den „Güldenen Schwanen“, allwo er vier Zimmer gemietet habe. Schubart dankte und übersah die ausgestreckte schmierige Hand.
Im „Schwanen“ fand er den Gesuchten nicht. Man war verstört, man schwieg und druckste an einem Wort, man zuckte die Achseln, bis Schubart zornig rief: „Wenn Ihr’s nicht sogleich bekennet, wo er ist, schick ich die herzogliche Polizei nach ihm!“
„Die hat ihn schon!“ hieß es kleinlaut, „vor einer Stunde ist er geholt worden, wegen eines Händels mit den wirtenbergischen Offiziers, die mit ihm gekartelt haben gestern nacht.“
Schubart überlegte, während er die Gasse entlangpatschte. Es roch übel, nach schlechtem Fett und nach den Misthaufen vor den Zäunen. Aber er war nun einmal im Schwung, er mochte jetzt nicht mehr einhalten.
Nach einigem Befragen fand er das Gefängnis, stand eine Weile vor der Mauer mit den vergitterten Löchern, dann fing er im Dämmern an zu pfeifen. Es war ein Tanz, eine Tonfolge aus der Salierischen Oper, mit ein paar Trillern und Schleifen, die er dazu erfand. Drinnen regte sich nichts, außen schlurfte nur ein Bettelweib schielend vorbei.
Da ratterte ein Wagen heran, und Schubart drückte sich an die Mauer. Das Gerassel wurde lauter und hielt an. Aus dem Gefährt, das nur in Umrissen kenntlich war, glitt etwas Helles, ein wehender Schemen, während der Kutscher das Ledertreppchen zum Aussteigen entrollte. Duft streifte den Wartenden, es rauschte an ihm vorbei aufs Tor zu.
Jetzt wurde er neugierig und folgte dem Diener, der das Licht trug. Niemand fragte, es ging alles zu rasch. Am Tor schellte der Lakai. Der Wärter kam, prüfte unter der Lampe ein Schreiben, öffnete eine Tür. Schubart schlüpfte mit hinein. Das Hofpflaster war glitschig und uneben. Der Diener schaute ihn an und hob die Laterne.
„Ein Freund!“ tuschelte Schubart und bückte sich, um nicht erkannt zu werden. Die Dame drehte sich um. Schubart, in einer Eingebung, ergriff ihren Schal und tat, als habe er ihn eben noch vor dem Abgleiten in den Schmutz bewahrt. Er gab ihn mit einem Bückling zurück, erwischte die Rechte der Dame und küßte den Handschuh. Sie lachte und ließ ihn mit eintreten; drinnen stand ein Kommissar.
„Lady Thibaut of Sothcliff!“ stellte sich die Gestalt vor, die Schubart vergeblich näher zu betrachten suchte; ein rauchblauer Schleier verdeckte das Gesicht unter dem toupierten Haar, auf dem ein winziger Hut schwebte. Schubart drückte sich hinter dem breit wippenden Reifrock weiter, ein Wächter erschien schlüsselrasselnd und schaute erstaunt auf den Kommissar. „Sonderpermission Seiner Gnaden, des Grafen Montmartin!“ schnauzte der und ließ die Dame mit einem Bückling vorbei. Wieder ruckte der Wärter unsicher mit dem dicken Kopf, aber sie ergänzte ohne Zögern: „Mit zweien Bediensteten.“
Eine so vornehme Frau konnte unmöglich ohne Begleiter ein Gefängnis besuchen wollen, und die beiden Beamten zogen sich dienernd an die Wand zurück. Schubart hatte sofort die zuversichtlich-devote Haltung angenommen, die seiner Rolle zustand, und der Lakai, das flackernde Lämpchen erhoben, ging wortlos voraus. Der Gang zog sich hin, ein feuchtes Gewölbe mit vielen Türen, hinter denen man die Gefangenen vermutete. Dann wurde die Decke höher, die Mauern glatter, die Umrisse einer Tür erschienen als schwaches Viereck. Der Kommissar nahm dem Diener die Lampe ab, ließ sich den Schlüssel reichen und öffnete. Helligkeit brach in das dunkle Gelaß, in der Ecke schwang sich ein Mann vom Lager und warf einen Umhang über: Casanova. Im ungewissen Schein erkannte Schubart ein weiches Profil mit angebogener knapper Nase, große Augen, dunkle dichte Brauen; das Haar hing zerzaust um die schmalen Wangen und das schwache Kinn – ein romanisches Gesicht ohne bedeutende Linie – dachte er schnell, als schon die Lady, ungeachtet ihrer Zuschauer, auf den Erschrockenen zuflog und – „Giacomo!“ – ihm am Hals lag. Kommissar und Wärter wandten sich in den Gang zurück und die beiden Begleiter blieben stehen wie Holzklötze.
Casanova faßte sich und schob die Dame sanft von sich ab. „Wie hast du das fertiggebracht, du Hexe?“ fragte er italienisch, was Schubart einigermaßen verstand. Sie sprudelte vergnügt und unaufhörlich, halb deutsch, halb italienisch, eine phantasievolle Erklärung; dann fragte sie flüsternd: „Wie bringen wir dich hinaus?“
„Mylady!“ rief Casanova lachend – er schien seine Haft trotz gräßlicher Drohungen seiner Wärter nicht ernst zu nehmen – „Mylady!“
„Du weißt ganz gut, wer ich bin!“ sagte sie und schlug endlich das Schleierchen zurück, freilich so, daß Schubart ihr Gesicht nicht sah.
„Jetterin, du freches Geschöpf!“ kam es jetzt deutsch und deutlich aus dem Mund des Kavaliers. „Hinauskommen? Nicht ganz leicht, zumal mir hier weder ein dummer Mönch noch ein steiler Dachfirst dienen wird, wie zu Venedig in den Bleikammern.“
Schubart, mit seiner ganzen jungenhaften Abenteuerlust, rief dazwischen: „Aber ich getrau mir, die Wächter abzulenken und Sie zu decken, Mylady und Seigneur!“
„Parbleu, der ladrone redet italienisch!“
„Soltanto un poco!“ wagte Schubart schüchtern, „aber…“
Da war schon der Wächter wieder da, pochte und rasselte, vermeldend, es sei nicht länger statthaft, mit dem Delinquenten zu „karessieren“. Er sagte wirklich so, und Schubart lachte laut, was einem Bedienten kaum angestanden hätte. Aber die Dame winkte gnädig und überreichte mit einem charmanten Lächeln dem Delinquenten ein umfängliches Paket, das sie unter dem Reifrock hervorzog. Dann entfernte sie sich mit Händewedeln und Nicken. Schubart, der als letzter ging, drehte sich um. „Sono sempre al Suo servizio!“f rief er kühn, selber nicht ganz überzeugt von seinen Sprachkenntnissen. Aber – „Mille grazie, amico!“ respondierte der Kavalier und lächelte entzückt. Er war ja auch wirklich in einer Lage, in der man einen dienstbereiten Freund brauchen konnte.
Draußen wandelte sich die Lady in ein kicherndes, ziemlich alltägliches Geschöpf, das Schubart schöne Augen machte. Immerhin hatte es ihr imponiert, daß der junge Mensch die Sprache des berühmten Reisenden beherrschte, wie sie meinte. Und Schubart nahm sich vor, den Faden, der ihn vielleicht schon beim Beginn seiner studentischen Laufbahn an ein Abenteuer knüpfte, nicht so schnell loszulassen.
Die Gelegenheit, ihn weiterzuspinnen, kam bald genug. Schubart, den Freund Baste verlassen hatte, war schon entschlossen, endlich weiterzureisen, als ihn der Diener der Jetterin aufsuchte. Er habe einen Brief im Sack, flüsterte er in derbem Schwäbisch, von der Madame Lady, und er, Schubart, solle ihn gleich lesen, da ja „der andere“ nimmer da sei, wie man erfahre. Das Geschreibe war ziemlich fehlerhaft, die Schrift holprig. Aber der Inhalt elektrisierte ihn: Er möge sich bereithalten, da er der einzig denkbare Helfer sei, sein Versprechen betreffend die bewußte notleidende Person wahrzumachen, und zu diesem Zweck des Abends um halber neune im Schloßpark am Lusthaus hinten warten.
Er verschob seine Abreise und bestieg in frühem Schneegestöber den Wagen, in dem die Frau im Dunkeln auf ihn gewartet hatte. Dem klingenden Trinkgeld der Jetterin war es zu danken, daß man ohne den Wärter zu dem Gefangenen vordrang. Drinnen war es Nacht, die Lichtbahn vom Fenster verhängt; jemand sprang vom Lager und zog den Vorhang weg. Schubart sah erstaunt, daß es eine braunhäutige Frau war, die nicht ungeschickt mit ihrem schaukelnden Reifrock umging, als sie hüftwiegend herankam. Eine weiße Lockenperücke verbarg die Stirn, ein Schal um den Hals, geraffte Spitzen rundeten die Figur, Handschuhe deckten die etwas lang geratenen Hände. Es war dasselbe Kostüm, wie es die Jetter trug. Freilich, das Sprechen dämpfte die Dame vorsichtig, als sie „Buona sera!“ wünschte.
Schubart durchschaute das Manöver sofort, aber – wie sollten dreie hinausgelangen, wo zwei hereingekommen waren? Etwas sorgenvoll bedachte er seine eigene Rolle. Würde Casanova von ihm verlangen, daß er zurückblieb? Den Gefangenen spielte? Sich jahrelanger Haft aussetzte – ihm zuliebe? Er sah die Jetterin erschrocken an. Aber er hatte sich in ihr verrechnet. So dumm sie ausschaut, so schlau ist sie doch, dachte er erleichtert: sie befahl ihm, den Arm der „Dame Neuhaus“ zu nehmen.
Schubart stockte zuerst, bis er sich klarmachte, daß Casanova auf deutsch Neuhaus bedeutete. Da tat er, was sie ihn geheißen hatte. Aber die Lady? Er fragte fast gleichzeitig mit dem Verkleideten. Sie bleibe, erklärte die Jetterin, und sie werde eine Geschichte erzählen, daß es die Wärter grause. Und – freikommen werde sie auch, dafür sei gesorgt.
Nicht sofort, aber sichtlich erlöst, nickte Casanova. Ehe er noch höfliche Einwände machen konnte, tappten draußen Schritte heran. Die Jetterin schlüpfte mit einer Behendigkeit unter das Lager, die einige Übung vermuten ließ. Sie zog die Decke herunter und hielt sich reglos. Als der Wärter umständlich aufschloß, lag das Logis in der trüben Dämmerung seiner Laterne. Schubart und seine „Dame“ traten ihm so schnell entgegen, daß er gar nicht mehr hereinzukommen brauchte. Er brummte etwas von späterer Kontrolle durch den Kommissar persönlich und ging voraus mit dem Licht. Die Tür verschloß er.
Im Hof bestieg die „Dame“ ihre Karosse. Schubart saß auf dem Bock beim Kutscher. Ein Stück weiter, im Park wartete ein zweiter kleinerer Wagen, Casanova stieg wortlos um. Er winkte flüchtig aus dem Fenster des Gefährts, das ihn – Gott wußte, wohin – in die Dunkelheit entführte.
Schubart, zitternd vor Spannung, mußte jetzt an seine geschmolzene Barschaft denken. Ob er bezahlt sei, fragte er den Kutscher, und wie weit er ihn mitnehmen könne? Das sei erledigt, antwortete der Mann neben ihm, und er werde ihn am Eßlinger Tor absetzen. Nicht weit davon lag Schubarts dürftiges Quartier. Erschöpft, als habe er Schlachten geschlagen, schlief er in der Nacht. Am nächsten Tag gingen Gerüchte um, die ihn vorsichtig machten. Es hieß, man habe im Gefängnis des Seigneur de Saintgalt eine Dame gefunden, die sich als Lady ausgebe. Sie sei, wie sie versichere, von dem berüchtigten Abenteurer aufs übelste mißhandelt worden, schließlich habe er sie hilflos auf dem Stroh liegen lassen und sich davongemacht. Daß sie eine Lady sei, glaubte man ihr freilich nicht, aber die sie kannten, schwiegen lieber. So wurde die Jetterin frei, fuhr heim und lachte. Der betrogene Wächter wurde bestraft, obwohl er mit heiligen Eiden beschwor, daß Tür und Tor unpassierbar gewesen seien. Casanova verfolgte man nicht – er hatte Gönner am Hof.
Schubart war allein. Den Drollinger war er los, leider, denn er war ein guter Kerl gewesen.
Das Liesele in der Hofküche und die Gretel am Markt und die Hanne im Wirtshaus – der junge Mann hatte in Stuttgart viele Bekanntschaften gemacht und manche Freundschaft geschlossen, und als er nach Nürnberg kam, trieb er’s so weiter. Es waren dumme, naive und raffinierte Geschöpfe darunter und er – ein Bursche von siebzehn Jahren, noch fast ganz unerfahren und recht gutgläubig, erwartete von jeder die Offenbarung und Erlösung, bis er allmählich stumpfer wurde und leichtfertiger mit den Mädchen umging. Er tröstete sein pietistisch geschliffenes Gewissen mit der Dichtermoral, die er sich vorsagte, und flog hin und her, bis ihn der Vater, ernstlich besorgt, heimrief und zum Studium der Theologie in Jena bestimmte. Sehr begierig war der junge Schubart freilich nicht auf das Studium, denn er bemerkte altklug, daß die hohe Schule weder den Weisen noch den genialsten Mann schaffe, man könne wohl beides sein, ohne je eine Universität gesehen zu haben. Nun tat er sich zunächst in der Heimat um, besuchte den Lauterburger Pfarrer Schuler, der wie viele Zeitgenossen die Himmelskunde betrieb, „Gläser schliff und Sehrohre machte“, und versuchte sich selber in der Astronomie, wie er alles ergriff, was es Neues und Interessantes in seiner Umgebung gab, wißbegierig und aufnahmebereit.
Im Herbst 1758 reiste er, bepackt mit Büchern, Wäsche, Würsten und Bouteillen und nicht minder mit Ratschlägen und Verboten, nach Jena ab. Aber unterwegs, in Erlangen, hielten ihn die sangeslustigen Genossen und ein paar hübsche Mädchen fest, er warf sich unternehmend ins Gewirbel des Burschenlebens, ein trink- und musikfreudiger Mensch und rede- und versgewandter Gesellschafter, ohne weiter zu denken, als wie er mit den schwärmenden Freunden Tage und Nächte „hinbrausen“ könnte. Dazwischen studierte er „tumultuarisch“, wie er es später reuevoll nannte, alles durcheinander; Systeme waren nie seine Stärke und niemand hatte ihn je angewiesen, sich zu beschränken, einzuteilen, zu wählen, wie es für eine „seriöse Bildung“ nötig gewesen wäre.
Da verklagte ihn sein Hauswirt wegen der Mietschulden, der Weinschenk wegen der Kreide für viele unbezahlte Bouteillen und einige Väter wegen den Umtrieben mit ihren Töchtern; er schrieb nach Hause, er sei ein zitternd halbverhungertes Opfer seines Übereifers in Theologiae und einiger böswilliger Verleumder, doch der Dekan in Aalen reagierte unerfreulich: Der Herr Sohn habe denen großen Opfern derer eingeschränkten Eltern zu gedenken und sich entsprechend eifrig seines Studiums zu befleißigen, da man ihm sonst den Wechsel sperren würde.
Aber zu dieser Umkehr war es zu spät. Als er nachts heimkam, wartete der Stadtbüttel; er saß mürrisch und mit dem Schlaf kämpfend auf der Stiege, Der Herr sei verhaftet und habe unverzüglich ins Stadtgefängnis mitzugehen, „keine Widerrede, Herr Studiosus“.
Der weinselige Schubart taumelte in der kühlen Nacht, schlich vor dem Büttel in sein Verlies – sein erstes, wenn man den Besuch bei Casanova nicht rechnen wollte, und kroch zerknirscht in eine Mauerecke. Was die zu Hause denken würden, und die Freunde und die Mädchen? Und – die Professoren? Aber er hatte keine Protektion und keine Damen zur Seite, die ihn freimachten wie den Casanova; er mußte brummen.
Man hielt ihn ordentlich, gab ihm gut zu essen, da es ja um Kavaliersdelikte ging, um Spiel- und Trinkschulden eines Studenten, aber herauskommen würde er kaum, ehe der Vater zahlte.
Ein paar Tage dämmerte er bekümmert hin, danach erwachte die alte ruhmredige Lust am Leben und dem eigenen Genie, er verlangte Feder und Papier und einen Boten, der sein Geschreibe forttrage. Eine gestickte Weste gefiel seinem Wächter, und mit ihr erkaufte Schubart sich auch den Besuch eines Freundes, der einen Korb Flaschen mitschleppte; dann wurden es mehr Besuche und auch Giovanetta wurde hereingeschoben, seine italienische Freundin, die hübsche sizilianische Liedchen singen konnte.
Als endlich ein zorniges Schreiben und – „um der Schande willen“ – ein Guldenbetrag von Aalen kam, ließ sich der Wärter erbitten, ein altes Klavier hereinzuschaffen, das dem Kommissar, einem ehemaligen Gastwirt, gehörte.
Jetzt sah Schubart keinen Grund mehr, sich zu grämen: Er gab „Konzerte“ mit der Giovanetta, spielte, komponierte und „wütete in die Saiten“, trank, lärmte mit den Freunden, und lebte zudem umsonst auf Staatskosten – bis ihn der Bruder Conrad, Student der Rechte, unverhofft besuchte, und hinter ihm, schrecklich genug, das ernste magere Gesicht des Vaters auftauchte.
Indessen war er von der Hohen Schule relegiert worden, der Vater ließ letzte erborgte Gulden zurück, bis die Haft abgesessen sei, und Schubart kämpfte mit einem Fieber, das ihm sein unmäßiges Leben eingetragen hatte. Einer seiner Lehrer, der sein musikalisches Talent kannte, erwirkte endlich mit eigenen Opfern die Freilassung.
Schubart kam heim, nach Aalen, ins stille wohlgeregelte Dekanat, ohne Examen, ohne irgendein Zeugnis seines Fleißes, ohne Geld und – krank. Der Vater sprach nicht mit ihm, die Mutter weinte, die Brüder, so oft sie nach Hause kamen, mieden ihn ärgerlich.
Und ihm schwirrte der Kopf, Fieber und wilde Ideen trieben ihn um, der Medikus kurierte weniger, als er ihn kujonierteg, da er den Kummer des Dekans sah. Schubart hielt sich brav, er spürte die fragenden Blicke seiner Mutter, und die gingen ihm näher als des Vaters steinerne Miene. Er stand am Vormittag auf, die Abstinenz von Wein und Umtrieb fiel ihm schwer. Unlustig stocherte er im Essen herum, das die Magd fett und mehlreich gekocht hatte; gegen Abend lief er in die Wälder; jetzt, im Frühling lagen sie rotbraun knospend, voller Erwartung unter dem hellen Himmel; aus dem starkduftenden Boden stießen Grasspitzen und aus den schmalen Zweigen gelbgrüne Knospen, die Berghänge schwangen sich am Horizont hin, hauchzart gezeichnet, in der Ferne immer blasser und unbestimmter schwebend, wie eingesogen und aufgeschlürft von dem Wind, der die nahen Bäume wiegte und schaukelte. Schubart hatte eine Predigt des Vaters mitanhören müssen, ungern genug setzte er sich den unverhohlen feindlichen Blicken der Honoratioren aus, paßte nicht recht auf, da er sich über die nüchternen gradlinigen Gedanken des Alten erhaben dünkte, und wußte doch, daß es um die „herrliche Freiheit der Kinder Gottes“ ging.
Jetzt, im zunehmenden Abendwind, dachte er daran: Freiheit! Klopstock sang davon: „O Freiheit, Silberton dem Ohre, / Licht dem Verstand und hohes Glück zu denken, / dem Herzen groß Gefühl…“ –
Freiheit – das ist mein Grundklang, Freiheit, die Freiheit vom Zwange; „Kinder Gottes“, das verpflichtet, und ich will nicht, will nicht eingeschworen sein auf irgend etwas; ist der Wind da angebunden? Die Zweige? Wolken und Vögel? – Menschen allein zwingen einen ins Joch, das ich nicht mag.
Es wurde langsam dunkler, Umrisse verschwammen, Farben bräunten sich, der Himmel ließ noch ein paar schmächtige Streifen rot aufscheinen, dann zog sich der unsichtige Vorhang zu.
Schubart trabte heim, den Mauern zu. – Freiheit, Freiheit, dachte er auf einmal, gibt’s die, wenn nicht auf jemandes Kosten? Wie wollte ich frei leben ohne des Vaters Geld? Frei schreiben ohne des Buchbinders Buch, des Tischlers Tisch, der Vorigen überliefertes Wissen? – Ach ja, niemand ist aus sich selber. „Keiner lebt ihm selber und keiner stirbt ihm selber“, das ist ein Bibelspruch, wie komm ich daran? Eingetrichtert von Kind an, eingebleut… Er suchte sich den Weg in den engen Gassen bei spärlichem Licht; aus den Fenstern schimmerte und schummerte es vertraut. Freiheit, Freiheit – wo? Da kam er ans Dekanat und schellte. Die Messingglocke schepperte ungut, die Magd schloß auf, es roch nach feuchtem Stein, aber doch auch nach Wärme, Holzbrand, Essen, Tabak – die Amtsstube des Vaters lag hier unten; er schrieb, übersetzte, präparierte und memorierte seine Predigten, er tat mehr, seit er den wilden Sohn noch mitverhielt. Schubart schlich in seine Stube unter dem Dach und kam nicht zum Nachtmahl herunter.
Nach ein paar Wochen – anonyme Briefe und Andeutungen aus seiner Gemeinde setzten dem Dekan hart zu – nahm er sich den Sohn vor: Er solle endlich versuchen, den für gescheiterte Theologen üblichen Weg zu einer Hauslehrerstelle einzuschlagen; es gebe in der Nähe Leute, die es mit ihm versuchen wollten. Auch an den Fürstprobst von Ellwangen müsse man sich wenden, da ja – wie er wisse – der katholische Kirchenfürst lamentablerweise noch immer über die lutherischen Pfarrstellen zu befinden habe. Er möge wählen; einen der beiden Wege sehe der Vater noch für ihn.
Schubart schwankte zwischen Trotz und Zerknirschung: Das Gefühl vom eigenen Genie brauste ihm stark durch den Kopf, und die Demutslehren des Vaters saßen ihm von Kind an im Gebein. Zum Hauslehrerbittgang fühlte er sich zu krank, hatte auch keine wirksamen Argumente für sein Versagen zur Hand. Aber dichten, ein Poem „schmettern“, mit dem er zugleich den Fürstprobst und die Welt von seinem Geistesflug überzeugte, das wollte er, und damit – ein schwäbisch-schlauer Gedanke schlich sich ein – zugleich dem Ellwanger Fürsten schmeicheln; das war üblich und nötig und schloß ihm die Pforten und Hände auf zum geistlichen Palais, aus dem die Gewährung einer Pfarrstelle ihm kommen sollte, trotz dürftiger Studien und fehlender Examina. Zwei Tage darauf war Wochenmarkt. Im Aalener Dekanat saß Schubart und horchte auf den Lärm draußen.
Es war Spätsommer. Die Bauernwagen rumpelten durch die Gasse, Kinder schrien und Weiber zankten, und die Männer hatten neben ihrem Handel Zeit zum Fluchen oder zum Flattieren, denn es waren auch anmutige Mädchen auf dem Marktplatz, die ihre geblümten Röcke schwenkten. Man sah freilich nur einen Zipfel vom bunten Getriebe, denn das Haus stand in einer Seitengasse; aber dem jungen Mann genügte es schon, um seine Phantasie zu entzünden. Er lag breit im Fenster, schob die Blumenstöcke auseinander und lachte darüber hin.
Ein paarmal drehte er sich um, nahm aus dem Becher einen Schluck und schaute dann wieder hinab. Da stieß er mit dem Ärmel ans Glas. Der Rotwein floß über den Tisch und auf das weiße geglättete Papier. „Die Ode!“ jammerte Schubart erschrocken, denn auf dem Bogen standen schon einige Verse sauber ins reine geschrieben, die jetzt langsam verwischten. „Hol’s der Henker!“ schimpfte der Dichter, „das Stück wär’ so übel nicht, jetzt muß ich’s noch einmal abschreiben!“ Er räumte das Glas auf und wischte an seinem Kunstwerk herum, aber viel war nicht mehr zu retten.
Die Mutter schaute herein und fragte nach dem Fortgang der Arbeit. „Der Teufel soll den Fürstpropst holen!“ brummte Schubart, „plag’ ich mich wie ein Hund mit dem Poem auf einen feudalen Pfaffen und verschütt’ den Wein drüber!“
Die Frau Dekan kam heran und half den Schaden bessern. Dann schaute sie mit schüchterner Bewunderung auf das rosig verfärbte Papier.
„Darf ich’s lesen, Christian?“
„Leset’s gern, Frau Mutter“, sagte Schubart, „es soll ihm wohltun; wird ihm noch nicht oft passiert sein, seit er lutherische Pfarrer ins Brot setzt, daß einer dichtet! Der kann mir die Stell’ nimmer abschlagen.“
Helene Schubartin fing laut zu lesen an und legte viel Andacht in ihren Ton:
„Der Musen Schar, so den Parnaß umgaukelt,
Vermengt der Glieder Tanz mit himmlischem Gesang,
Indeß Apoll die Leier schaukelt,
Draus göttlich aller Töne Quell entsprang…“
„Da ist’s aber ganz verwischt!“ sagte die Dekanin bekümmert, „kannst du’s noch lesen?“
Schubart stand auf. „Jetzt kommt die Stell’ vom Gesang – die muß her!“
Sie mühten sich beide, mit heißen Wangen übers Papier gebeugt. Schubart vermißte ein Blatt seiner Aufschriebe, er fuhr sich verzweifelt in die Haare, luftholend lief er ans Fenster und beugte sich vor: Drunten summte es wie Bienengeläut, Gelächter mischte sich mit ein paar Liedzeilen, die er nicht verstand. Er drehte sich zur Stube hin wie ein Kreisel und reimte plötzlich aus dem Stegreif:
„Gesang, der Fröhlichen beglückte Wonne,
Der vollen Herzen Überlauf!
Du dampfest, wie der Tau im Strahl der Morgensonne,
Bis zum Olymp hinauf!“h
Langsam wuchs die Ode wieder zusammen. Die Mutter brachte ein neues volles Glas und riet zur Geduld. Doch eh „Apoll“ ausgesungen hatte zur „schaukelnden Leier“, verzog sich schon drunten der Marktlärm.
Obwohl die Hymne unversehens aus dem antikisch Heidnischen ins barock Christliche umschlug, schien sie den Fürstpropst nicht ganz zu befriedigen; er war ein Fugger-Glött, ein feingebildeter, literarisch und künstlerisch empfindsamer Mann.
Schubart empfing, sehnlich erwartet, nach zwei Wochen sein Honorar: Das Geld für einen „wolltuchenen, wohlgefälteten Ausgehrock“, wie er einem Erlanger Freund resigniert berichtete.
Da blieb nur die Hauslehrerstelle. Sie bot sich im nahen Königsbronn beim „Unternehmer“ Bletzinger, der mit dem herzoglichen Königsbronner Hüttenwerk zu tun hatte. Dort waren die Kinder zu unterrichten. Hauslehrer sein hieß, sich einfügen und anpassen, bescheidentlich hinnehmen, was geboten und verboten wurde, da man ohne Rückhalt von den finanziellen Gnaden des Hausherrn abhing. Schubart fuhr und ritt oft heim; er wanderte, bis ihn Herbststürme mit krachenden Ästen und Regenschauern vertrieben.
Auf diesen Gängen entwarf er Oden und Nänien, kurze, flink gereimte Lieder, Gesänge in Klopstocks Stil. Er zeichnete Geschichten auf, die er hörte oder las. Die schreckliche Ballade von den feindlichen Brüdern notierte er und schlug darin wieder das Grundthema seines Wesens an: Freiheit, Verkümmerung im Zwang, Verrat an der echten Freiheit, der innersten.