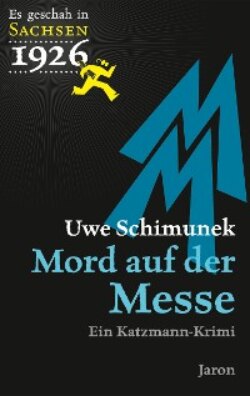Читать книгу Mord auf der Messe - Uwe Schimunek - Страница 6
ZWEI
Sonntag, 28. Februar 1926
ОглавлениеELEKTRISCHES LICHT ist eine praktische Erfindung. Mittels der richtigen Glühlampe und einer geeigneten Reflexionsfläche lässt sich die Helligkeit hervorragend steuern. Zum Beispiel kann ich morgens vor meinem Gespräch einen Lichtschein erzeugen, der es mir ermöglicht, mein Gegenüber zu blenden. So sehe ich ihn, aber er mich nicht.
Überhaupt ist die Elektrizität eine großartige Sache. Mit Mikrophon, Verstärker und Lautsprecher lässt sich meine Stimme unkenntlich machen. Ich klinge, als hätte ich einen schweren Katarrh. Es hört sich so gruselig an, dass ich bei der Mikrophonprobe eine Gänsehaut bekommen habe. Diese Verstärkeranlage ist eine enorm hilfreiche Angelegenheit. Denn erstens erhöht das den Respekt bei meinem Gesprächspartner, und zweitens kann ich so unsichtbar bleiben. Denn seien wir ehrlich: Wenn der Mann mich erkennen würde, würde das sein Leben abrupt beenden. Und ich gebe mir stets größte Mühe um das Wohlergehen aller meiner Leute.
Auch der Mann, der vor mir sitzt, ist ein wertvolles Mitglied meiner Gruppe, das ich nur ungern verlieren würde. Er kauert auf seinem Stuhl, als wolle er sich unter der Sitzfläche verstecken.
Der Mann erzählt, dass der Ober von zwei Journalisten entdeckt wurde. «Ich selbst habe vom Eckhaus an der Mittelstraße zur Tauchaer zugesehen, wie die beiden die Leiche gefunden haben. Vorher saßen die Männer noch im Bierrestaurant im Krystall-Palast und ließen sich vom Ober bedienen. Sicher haben sie ihn erkannt.»
Ei, ei, das hatte ich gar nicht bedacht. Wieso konnten sich diese Wichte von der Arbeiterpresse rauschende Feste im Krystall-Palast leisten – mitten in der Krise? Jammern in ihrem Blatt über den wirtschaftlichen Niedergang und prassen im Amüsierschuppen. Na ja, was ist schon dabei, dass sie den Ober erkannt haben? Den Beruf des Opfers würde jeder schnell herausbekommen. Nun wissen die beiden es gleich. Wo liegt der Unterschied?
«Ich wollte eigentlich nach Hause gehen. Aber als ich die beiden und den Ober gesehen habe, bin ich noch ein bisschen geblieben. Ich konnte genau beobachten, wie die Journalisten den Leichnam inspiziert haben. Sie haben sich über einen Zettel unterhalten. Genaueres konnte ich auf die Entfernung leider nicht verstehen.»
Ich gucke den Mann an. Nein, der verbirgt nichts. Der sitzt wie ein Häschen auf dem Stuhl.
Ich frage: «Was haben die beiden denn im Krystall-Palast gemacht?»
«Sie haben das Konzert von Bernadette La Belle besucht. Mir sind sie aufgefallen, weil sie das Da Capo versäumt haben und in das Bierrestaurant gegangen sind.»
Zwei Journalisten, die zu früh aus dem Konzert gehen. Vielleicht haben die das Konzert schon ein paar Mal erlebt. Das klingt mir zunächst nicht, als müsse ich mir Sorgen machen. «Kennen Sie die beiden?»
«Den einen habe ich schon ein paar Mal gesehen. So ’n gutaussehender junger Kerl. Teure Anzüge. Ich würde sagen, Salon-Sozi.»
Aha, daher weht der Wind. Klar, wer’s dicke hat, kann sein Bier im Krystall-Palast trinken und am nächsten Morgen etwas für die Gerechtigkeit auf der Welt tun. Und der andere Kerl? Ich nicke dem Mann zu, denke wieder einmal nicht daran, dass er mich nicht sehen kann. Aber egal, der spricht bestimmt gleich von allein weiter.
«Der andere Kerl ist ungefähr genauso alt, aber kräftiger und hat einen Lockenkopf. Er sieht irgendwie eckig aus …»
Irgendwie eckig, darunter soll sich einer etwas vorstellen können … Das ist doch keine Rätselstunde! Aber ich will nicht ungeduldig werden. Sage nichts.
«Er trug auch einen teuren Anzug, aber der saß nicht so perfekt. Ich habe das Gesicht noch nie gesehen.»
Ein Modelinker und ein neureicher Zugereister, die ein Konzert vor der Zugabe verlassen und Bier trinken gehen … Was ist das denn für ein Pärchen? Hatten die was Wichtiges zu besprechen? Bestimmt ist der Fremdling nur ein harmloser Messegast …
Und eigentlich habe ich genau erreicht, was ich wollte: Journalisten sollten den Ober finden. Das war das Ziel, und so ist es gekommen. Und dank der Aufmerksamkeit des Mannes vor mir weiß ich nun sogar, welche Schmierfinken meine kleine Botschaft entgegengenommen haben. Ich muss das Positive sehen. Andererseits: Vorsicht ist die Mutter des Erfolgs. Ich brauche mehr Informationen.
«Also, hören Sie gut zu.» Wie herrlich meine Stimme aus den Lautsprechern knarzt! Ich bekomme Gänsehaut, der Mann schrumpft in seinem Sitz. «Bekommen Sie heraus, wer die beiden sind. Behalten Sie sie im Auge. Und erstatten Sie Rapport, wenn Sie etwas Neues wissen.»
In der Untergrundmessehalle drängten sich die Menschen. Die Gesichter sahen im elektrischen Licht gespenstisch aus, als habe jemand die Farbe herausgesaugt. Heinz Eggebrecht wollte lieber nicht wissen, wie er in dieser Beleuchtung wirkte. Er hatte das Gefühl, aus seinem Gesicht sei die Luft abgelassen worden und nun hänge seine Haut wie altes Leder an den Wangen. Er konnte die Augen kaum aufhalten, dafür drückten die Augäpfel. Vermutlich glich er einem Frosch, nur dass unter den Augen kein breites Maul war, sondern Ringe – schwarz wie Reifengummi. Er hätte das mit der Schnapsflasche in der Kammer bei seinen Eltern sein lassen sollen. Gestern Abend dachte er noch, dass er den Anblick der Leiche aus seinen Gedanken spülen könnte … Falsch gedacht.
Und dann der Lärm. Keiner im näheren Umfeld sprach besonders laut, aber es schien, als habe sich halb Europa hier unten in der Messehalle versammelt. Und wenn eine Million Menschen in tausend Sprachen in Zimmerlautstärke redeten, konnte einem das in der Summe die Nerven rauben. Das galt insbesondere für jemanden, der einen Kater hatte, ach was, einen Bengaltiger oder ein noch größeres Tier – so wie Heinz Eggebrecht.
Schon das Drehen des Kopfes fiel schwer. Aber da kam er nicht drum herum, wenn er sich einen Eindruck verschaffen wollte. Die Halle schien kein Ende zu nehmen. Eggebrecht wusste, dass der unterirdische Ausstellungsraum in der Länge knapp hundert Meter maß, aber hier sah alles viel größer aus. Über der Erde bildeten der Eingang zum Untergrundmessehaus auf der Südseite des Marktes und das Siegesdenkmal am Nordende natürliche Enden des Platzes. Da war die Entfernung gut zu überblicken und hatte nichts Bedrohliches. Hier unten aber stand Eggebrecht im Gewimmel kurz vor der Platzangst und konnte kaum Wände sehen. Zwischen schlanken Betonsäulen, die zur Decke ragten, führten immer abwechselnd Gänge und Standreihen in die Tiefe – ins endlose Gewusel des Messeauftaktes.
«Und, können wir losgehen?» Katzmann wirkte verdächtig wach, wer weiß, was der am Morgen genommen hatte. Dabei strahlte der Reporter eine Ruhe aus, dass es Eggebrecht vorkam, als stehe Katzmann vor einer flimmernden Kinoleinwand, auf der eine Massenszene in doppelter Geschwindigkeit lief.
«Hm.»
«Vielleicht fangen wir ganz links an …»
«Hm. Links. Klar.» Sozi blieb eben Sozi – wenn er links begann, konnte er sich prima nach rechts vorarbeiten, dachte Eggebrecht und musste schmunzeln. Immerhin ein klarer Gedanke, der Tag schien zu beginnen.
Katzmann ging los, schritt auf das Gedränge zu, wurde von der Masse eingeatmet. Eggebrecht stolperte hinterher, drang ins Gewühl. Die Messegäste trugen Anzüge, deren Farben von dunklem Grau über Anthrazit bis Schwarz variierten. Die Jacketts unterschieden sich kaum, allenfalls in der Anzahl der Knöpfe unterm Revers oder der Kragenlänge. Frauen gab es nicht. So wirkte das Gedränge, als warte eine Geschäftsleute-Armee auf den Beginn der Parade. Aus dem Gemurmel hörte Eggebrecht im Vorbeigehen Satzfetzen, Worte wie Krise, Bereinigung, Sparen, Werben, Abwarten, Weitermachen …
Katzmann verschwand im Gang. Eggebrecht folgte ihm, quetschte sich zwischen den Geschäftsleuten hindurch, murmelte die Entschuldigungen immer genervter. Er umkurvte eine Gruppe blonder Männer. Deren Haare leuchteten so hell, die Kerle mussten vom nördlichsten Ende Skandinaviens kommen – oder gleich vom Nordpol. Dann endlich der Gang, er sah Katzmann wieder. Der Reporter stand vor der ersten Nische.
Auch in dem Gang sah Eggebrecht keine Frauen, was ihn verwunderte, weil Nähmaschinen ausgestellt wurden. Zahllose Fabriken befassten sich damit, den Frauen in den neuen Zeiten das Leben zu erleichtern. Welche Geräte die Damen zu ihrem Glück brauchten, entschieden anscheinend die Männer.
Er schloss zu Katzmann auf, aber der hatte offenbar genug gesehen und lief hinunter in die Tiefe des Gangs.
«Nun warte doch mal, Konrad …»
«Was ist denn los? Steckt das Kopfkissen noch in deinem Kragen?»
«Nein … ich will …» Eggebrecht versuchte sich zu konzentrieren. Warum stand er eigentlich hier? Und lag nicht in seinem Bett? Die Messe würde auch am Nachmittag noch geöffnet haben.
«Ich bin noch nicht richtig wach … Ich hatte so meine Probleme einzuschlafen.»
Katzmann schob die Brille am Bügel in Richtung Stirn und sagte: «Komm schon, denk nicht mehr an tote Ober, Zettel oder Banden. Jetzt ist Messe. Arbeiten hilft.» Katzmann drehte sich zur nächsten Nische. Hier bot ein Mann Zubehör für die moderne Näherin an: Fäden auf Spulen, Nadeln, Metalldinger, deren Namen Eggebrecht nicht kannte und deren Funktion er allenfalls erahnen konnte. Die Waren lagen in Holzkästen, es mussten Hunderte auf dem Präsentationstisch stehen, schätzte Eggebrecht.
«Guten Tag, Hemmann-Textilzubehör, Hemmann mein Name. Sie sind Einzelhändler, hoy?» Der Mann in der Nische sang das Sächsische der Erzgebirgsvorländler, er kam sicher aus der Chemnitzer oder Zwickauer Ecke, vielleicht sogar aus dem Vogtland. Er trug eine Halbglatze und schien das fehlende Haupthaar mit seinem struppigen Schnurrbart kompensieren zu wollen. Vielleicht sollte der Bart auch verhindern, dass der Händler beim Blick nach unten ständig seinen gewaltigen Bauch sehen musste. Eggebrecht überlegte, was er täte, wäre er ähnlich fett. So ein Oberlippengestrüpp käme für ihn nicht in Frage.
«Eggebrecht und Katzmann. Wir sind von der Presse.» Katzmann übernahm das Gespräch, er war offenbar wach genug.
«Da wollen Sie nichts bestellen, hoy?»
«Wie laufen die Geschäfte denn?»
«Es sind ja erst ein paar Stunden. Ich bin erst heute ganz zeitig aus Reichenbach angereist.» Er machte eine kurze Pause und sagte: «Wenn die Damen kein Geld für Kleider haben, nähen sie selber, hoy? Und wenn’s dann wieder bessergeht, wollen sie öfters ausgehen und müssen mehr nähen, hoy?»
Ein Kaufmann, der nicht jammerte. Eggebrecht konnte es kaum fassen.
«Nur wenn die Geschäfte in den Städten pleitegehen, ist das schlimm, hoy? Ich kann ja nicht überall sein und meine Waren selber verkaufen, hoy?»
Na immerhin, da bekam die Krämerseele noch die Kurve, dachte Eggebrecht.
Katzmann lächelte freundlich. «Herr Hemmann, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würden wir Sie in den nächsten Tagen noch mal besuchen. Dann würden wir Sie gern zu Ihren Messeerfahrungen befragen.»
«Aber nehmen Sie doch bitte Platz.» Theodor Stötzenau wies auf zwei Sessel, die hinter einem kniehohen Tisch standen.
Katzmann setzte sich und beobachtete Eggebrecht dabei, wie er um den Tisch herumtrottete und in den anderen Sessel fiel. Inzwischen war es fast Mittag, und der Photograph schien nicht wach werden zu wollen. Also würde er auch bei diesem Gespräch keine große Unterstützung sein. Katzmann betrachtete den Gastgeber. Theodor Stötzenau saß im Vorstand mehrerer Aktiengesellschaften, die Messehäuser in der Innenstadt verwalteten, bei der Neuen Leipziger Messehäuser AG fungierte er als Prokurist. Vielleicht konnte Katzmann das Interview für einen Artikel verwenden.
«Einen Cognac?» Stötzenau stand an einem Sekretär, holte eine Flasche und drei Gläser heraus.
Eggebrecht brabbelte eine Zustimmung, bevor Katzmann auch nur den Mund öffnen konnte. Er fragte sich, ob neuer Alkohol dem Photographen helfen würde. Katzmann hatte vor ein paar Wochen einen Artikel über die Heilpraktiker-Bewegung nach den Lehren des alten Leipzigers Samuel Hahnemann geschrieben. Diese Homöopathen versuchten, Menschen zu heilen, indem sie Gleiches mit Gleichem bekämpften. Allerdings verabreichten sie die Mittel in winzigsten Dosen. Stötzenau schien beim Füllen der Gläser eher nach der Maxime zu verfahren: Viel hilft viel.
Stötzenau kam mit dem Tablett voller Schnäpse zum Tisch. Nicht schnell, aber auch nicht besonders langsam. Alles an diesem Mann war durchschnittlich: Er war mittelgroß, mit einem Bauchansatz, ohne gleich dick zu sein. Die Haare waren zu kurz, um in Strähnen auf dem Kopf zu liegen, und zu lang, um als Borsten vom Kopf abzustehen.
«Also, was führt die Herren zu mir?», fragte Stötzenau.
«Nun, die Messe.» Katzmann machte eine kurze Pause, wollte sehen, ob Stötzenau auch ohne Frage etwas zu erzählen hatte.
«Dieses Jahr läuft es nicht so gut. Die Krise.» Stötzenau schaute in die Runde, runzelte die Stirn, sprach weiter. «Natürlich, wenn man es mit 1924 vergleicht … oder mit dem Krieg, den die Roten vertrödelt haben … Wir jammern auf hohem Niveau …»
«Wir kommen gerade aus der Untergrundmessehalle. Von Flaute konnten wir nicht viel feststellen …»
«Ein paar Prozent mehr oder weniger sieht man nicht auf den ersten Blick. In den Messehallen drängen sich immer noch Menschen. Aber auch wenn die Arbeiterpresse es nicht gern hört, unsere Gesellschaft lebt davon, dass alles größer wird. Wer nicht wächst, der schrumpft, und wer schrumpft, der stirbt. So ist das in der Wirtschaft.»
«Vielleicht kommt daher das Unglück … weil keiner genug bekommen kann.» Eggebrecht kippte den Schnaps hinunter, als wolle er beweisen, dass es wirklich keine Grenzen gebe.
Stötzenau wirkte für einen Augenblick verwirrt. Dann hob er den Mund zu einem Grinsen. «Nun, es ist einer der Vorteile an unserem Wirtschaftssystem, dass wir die Bürger immer besser mit den grundlegenden Waren versorgen können. Möchten Sie noch ein Glas?»
Ein Kapitalist mit Humor, das kam Katzmann nicht so häufig unter. Wohin sollte das führen, wenn er mit einem Bourgeois in dessen Bureau saß und scherzte? Aber genau genommen galt der Scherz nicht ihm, sondern Eggebrecht, der gerade einen neuen Schnaps bekam. Bevor der Photograph vom Stuhl fiel, musste Katzmann das Gespräch in geordnete Bahnen lenken. «Noch mal zurück zur Messe. In welcher Größenordnung hat die Zahl der Gäste abgenommen?»
«Genaue Zahlen kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben bei den Ausstellern weniger Buchungen aus Deutschland und etwas mehr aus dem Ausland.» Stötzenau schwenkte sein Cognacglas, so dass die braune Flüssigkeit am Rand entlangzuschweben schien.
«So ähnlich wird das vermutlich auch bei den Gästen sein.» Katzmann schaute zu Stötzenau. Der Mann zeigte dieses Lächeln, das Leute aufsetzen, wenn sie sich überlegen fühlen. Aus dem würde er nichts Konkretes herausbekommen. Katzmann konnte das sogar verstehen, wer berichtete schon gern von Misserfolgen. Und für seine Artikel in der kommenden Messewoche hielt er sich sowieso besser an das Messefußvolk. Nichts erschien ihm langweiliger als Berichte mit Zitaten von Verlautbarern, davon gab es in den Texten über die SPD schon genug. Also Themenwechsel. Katzmann fragte: «Haben Sie schon mal was von der Blei-Bande gehört?»
Stötzenau zuckte. Beinahe wäre ihm das Glas aus der Hand gefallen. Er guckte zu Eggebrecht, dann erneut zu Katzmann, zögerte noch einen Moment und sagte: «Ähm, nein … eigentlich nicht.»
Eggebrecht lachte, als kitzle ihn jemand an den Füßen. Auch Katzmann musste schmunzeln.
«So, so, eigentlich nicht … Vielleicht überlegen Sie noch einmal …» Katzmann musste an den Oberkommissar denken und wie der berichtet hatte, dass die Kleinganoven bei den Messen im vergangenen Jahr verschüchtert geschwiegen hatten. Entweder Stötzenau gehörte zu diesen, oder die Bande sorgte nicht nur dort für Schrecken …
«Also gut …» Stötzenau hörte auf, sein Glas zu schwenken, und trank einen Schluck. «Aber ich kann nur sagen, was man so erzählt …»
«Klar doch.» Eggebrecht lallte ein wenig, schien aber wieder hellwach zu sein.
Stötzenau guckte genervt zum Photographen, wandte sich dann abermals Katzmann zu. «Mord, Erpressung, Schutzgeld, Betrug, Falschgeld. Alles, was Sie wollen, hört man über die Blei-Bande – nur nichts Genaues. Die Fäden zieht ein Doktor Blei, den noch nie einer gesehen hat. Und glauben Sie mir, Sie wollen auch nicht wissen, wer Doktor Blei ist, wenn Sie an Ihrem Leben hängen …»
Die ganze Stadt war voller Menschen. Eggebrecht und Katzmann liefen durchs Gedränge. Der Reporter schwieg, und Eggebrecht musste an seine Kindheit denken. Jedes Jahr am Messe-Sonntag hatte Vater die ganze Familie in die Straßenbahn gepackt – seine Schwestern, die Mutter und ihn. Zu fünft spazierten sie in ihren Ausgehanzügen unter den Werbebannern hinweg durch das Gedränge: die Petersstraße entlang, über den Markt, durch die Grimmaische Straße bis zum Augustusplatz. Für die Arbeiterfamilie aus Lindenau im Leipziger Westen waren die meisten Produkte unerschwinglich. Vater wollte dennoch auf dem Laufenden sein, die neuesten technischen Entwicklungen zumindest gesehen haben. Statt der Maschinen konnte sich der Vater nur die Bücher über den technischen Fortschritt leisten. Heinz Eggebrecht dachte an die Romane von Kurd Laßwitz, die er aus Vaters Bücherschrank nehmen durfte. Beim Messebummel guckte Familie Eggebrecht mit staunenden Augen in die Schaufenster und Buden. Die Schwestern fanden das bald langweilig und tollten herum, sprangen durchs Gewühl wie Flöhe durch ein Hundefell. Nach ein paar Minuten hatten Vater und Mutter vor allem darauf achten müssen, dass Helma und Helga nicht verlorengingen …
Eggebrecht dachte in letzter Zeit immer öfter an seine Kindheit in der Kaiserzeit. Damals hatte er vor allem eines gewollt: raus. Raus aus dem Leipziger Westen, weg von der Plackerei für karge Löhne. Weg von den Arbeiterkneipen, in denen stolze Proletarier nach dem zehnten Bier von der «Relulution» lallten, bevor sie unter den Tisch fielen.
Gleich nachdem er den Krieg überlebt hatte, war er deswegen in die bürgerliche Südvorstadt gezogen. Ein Großteil seines Lehrlingsgehaltes ging für das Zimmer zur Untermiete drauf. Es war ungefähr so groß wie eine Besenkammer, aber dafür konnte er zwischen Handwerksmeistern, Ladenbesitzern und Gymnasiallehrern wohnen.
Inzwischen zählte er selbst zu diesen Bürgern. Und nun erschien ihm seine Lindenauer Kindheit immer freundlicher – so, als hätte zwischen Leutzscher Holz und Lindenauer Markt immer die Sonne geschienen. Und so, als wäre in Berlin, wo er jetzt wohnte, immer November.
Abgesehen von der Ermanox, mit der er seine Photos schoss, nahm er nach wie vor kaum am technischen Fortschritt teil. Wozu auch? Er brauchte kein Automobil und kein Motorrad. Die Bahnen fuhren ihn in Berlin, wohin er wollte. Und einen eigenen Fernsprecher, wie ihn die Großbürger in ihren Villen hatten, brauchte er auch nicht. So oft war er nicht zu Hause. Nur einen Radioempfänger … ja, das wäre etwas, worauf es sich zu sparen lohnte.
Ein Mann rempelte ihn an. Heinz Eggebrecht schaute auf. Der Mann war Mitte vierzig, trug einen leger geschnittenen Sakko und hatte die Haare mit Pomade zu einem schwarzen Helm geformt.
«Oh, Pardon!» Der Mann sprach weich, als habe er die Daunen aus seinem Kissen verschluckt. Offenkundig ein Franzose.
«Schon gut.» Eggebrecht strich sein Jackett glatt, obwohl der Rempler dem Stoff nichts hatte anhaben können. Er guckte zu Katzmann, der stand neben ihm und schien sich nicht weiter für den Mann zu interessieren.
«’ätten Sie Freundlischkeit, misch sag’n, wo ist Marktplas?» Ganz klar ein Franzose. Der konnte froh sein, dass er hier unter netten Sachsen war! Eggebrecht musste daran denken, wie er in Paris versucht hatte, zu einem Phototermin zu gelangen. Sein Französisch ging sicher nicht als adlig durch, aber das größere Problem schien ihm, dass diese Franzosen einen Deutschen nicht verstehen wollten. Doch jetzt, wo er die Chance zur Rache hatte, kam er nicht aus seiner Haut und sagte: «Aber selbstverständlich. Sie gehen einfach die Grimmaische Straße hinunter.» Eggebrecht überlegte, ob er den Franzosen vielleicht in der Reichsstraße abbiegen lassen und ein paar Kilometer durch die Stadt schicken sollte. Aber sein Arm zeigte gen Markt. Eggebrecht fühlte sich wie eine Marionette seiner Erziehung, als würde die Gastfreundschaft ihn zum Deppen machen.
«Werde isch finde Üntergründmesse’aus?»
«Aber sicher, das können Sie gar nicht verfehlen. Gleich wenn Sie auf den Markt kommen, rechter Hand.» Eggebrecht kam sich vor wie einer dieser modernen Fließbandarbeiter, nur dass er keine Waren produzierte, sondern Freundlichkeit. Auch Katzmann neben ihm grinste.
Der Franzose nickte, deutete eine Verbeugung an. Es sah aus, als wolle er losgehen, doch dann zögerte der Mann, griff in die Innentasche seines Jacketts.
Die Bewegung wirkte beiläufig, beinahe etwas zu unauffällig für Eggebrechts Geschmack. Es war diese einstudierte Natürlichkeit, die Trickbetrüger auf Berliner Volksfesten und anderen Menschenaufläufen an den Tag legten. Seine Kollegen, die aus dem Gewühl berichteten, hatten ihm viele Gruselgeschichten erzählt. Er selbst bewegte sich deshalb mit äußerster Vorsicht zwischen Menschen. Auch jetzt tastete seine Hand nach der Brieftasche.
«’aben Sie ein ’inweis, wo isch kann Geld tauschen?» Der Franzose hatte ein Bündel Scheine aus dem Jackett gezogen und wedelte damit herum.
Wenn er darauf spekuliert hatte, seine Devisen hier loszuwerden, befand er sich auf einem Irrweg. Eggebrechts Hand drückte die Brieftasche gegen die Brust. Sein Kopf wusste, dass die Geldbörse leer war wie ein Euter nach dem Melken. Er sagte: «Auf dem Markt werden Sie sicher ein Bankhaus finden.»
«Was willst du auf dieser Messe, Genosse? Reicht es nicht, wenn die Wirtschaftsredaktion von diesem Auflauf der Kapitalisten berichtet?» Leistner lehnte im Sessel hinter seinem Schreibtisch. Der Qualm der Tabakspfeife folgte seinen Worten und gab dem Gesagten etwas Bedrohliches.
Katzmann kratzte sich an der Stirn. Leistner sprang, seit er Chefredakteur war, immer wieder über seinen Schatten. Das musste Katzmann anerkennen. Die Leipziger Volkszeitung hatte inzwischen einen ernstzunehmenden Wirtschaftsteil, jeden Tag gab es Sportberichte, und sogar der Platz für einen Fortsetzungsroman war geschaffen worden – derzeit bekamen die LVZ Leser Die Metropole von Upton Sinclair mit der Zeitung auf den Tisch. Eugen Leistner tat Gutes, es fiel ihm nur manchmal schwer.
Katzmann sagte: «Aber Eugen, geh mal da raus! Es gibt Unmengen von Menschen, und klar sind da die Bonzen. Aber du weißt doch auch, dass Angestellte, Arbeiter und ganze Familien in die Stadt pilgern. Alle gucken sich den Messetrubel an.»
«Genosse Konrad, du darfst nicht den Blick für die Zusammenhänge verlieren. Es ist Krise – und was machen die Kapitalisten? Sie entlassen die Arbeiter in den Fabriken und geben das Geld für Reklame aus. Ist das richtig?» Leistner zog an seiner Pfeife. Bevor Katzmann antworten konnte, fuhr er fort: «Nein, sage ich. Und weißt du, warum? Weil die Kapitalisten nie das Große und Ganze sehen. Wer soll die Waren denn kaufen, wenn immer weniger Menschen eine volle Lohntüte nach Hause bringen?»
Katzmann musste zugeben, dass diese Argumentation eine gewisse Stringenz hatte. Er kannte sie aus einem Artikel in der Samstags- LVZ. Deswegen hatte er schon einen ganzen Tag Zeit gehabt, nach der Lücke zu suchen. «Zum Beispiel können die Waren exportiert werden. Einer dieser Kapitalisten hat mir gerade erzählt, dass in diesem Jahr der Anteil der Ausländer unter den Messebesuchern steigen wird.»
Leistner paffte. Eine Wolke zog vor seiner Stirn nach oben und zeichnete die Falten über den Augenbrauen weich. «Und dann, Genosse Konrad? Was passiert dann? Dann verlieren die Arbeiter in Frankreich und Polen ihre Arbeit. Dafür wird das Heer der deutschen Arbeitslosen vielleicht etwas kleiner. Aber weil so viele Menschen auf die wenigen offenen Stellen hoffen, wird es weniger Lohn geben und weniger Rechte für die Arbeiter. Wir haben also Arbeitslose im Ausland und Entrechtete in Deutschland. Das kann doch nicht die Lösung sein!»
In Leistners Welt glich der Kapitalismus einer Decke, die immer zu kurz war, an welchem Ende man auch zog. Katzmann behielt den Gedanken für sich, weil er nicht die Nacht bei einer Diskussion in der Redaktion verbringen wollte. Er beschloss, bei nächster Gelegenheit mit Eggebrecht darüber zu sprechen. Der war als freier Photograph schließlich so eine Art Kleinkapitalist.
Katzmann wechselte das Thema. «Was wird eigentlich morgen die Titelgeschichte?»
«Das Volksbegehren zur Fürstenentschädigung natürlich! Ich sitze gerade an dem Artikel.»
So etwas hatte Katzmann befürchtet. Im Herzen der Stadt strömte das Volk zum Ereignis des Jahres, und Leistner bereitete einen seiner berüchtigten Aufsätze über etwas ganz anderes vor.
«Ich werde zuerst ein paar theoretische Grundlagen ausführen und dann mit feurigen Worten zur Teilnahme am Volksbegehren aufrufen. Zum Schluss werde ich zeigen, welche Ungerechtigkeit die Entschädigung bedeutet …»
Theoretische Grundlagen, feurige Aufrufe – Katzmann lief ein Schauer über den Rücken. Wie konnte er den Chef vor dem Schlimmsten bewahren? Und die Leser natürlich auch?
«Schau, Genosse Konrad, ich habe eine Liste anfertigen lassen. Wilhelm II. soll 600 000 Reichsmark im Jahr bekommen, ein Arbeitsloser mit Familie 750. Das ist doch zum Schreien!»
Katzmann nahm den Zettel. Die Zahlen waren beeindruckend. Selbst ein pensionierter General stand bei 18 000 Reichsmark, ein dreißigprozentiger Kriegsversehrter ganz am Ende der Liste bei ganzen 100 Mark. «Das ist eine Frechheit. Da hast du recht, Eugen. Sollte das nicht ganz vorn stehen?»
«Aber Genosse Konrad, ich kann doch meine Zeitung nicht mit einer Tabelle aufmachen! Das sieht doch aus, als hätte ich aus Versehen die Börsenberichte auf Seite eins gedruckt.»
Hm, da war was dran. Doch mit einer guten Überschrift und einem kurzen, aber starken Text, der zur Liste führte … Katzmann guckte noch einmal auf die Liste, überlegte und fragte dann: «Eugen, was macht eigentlich 750 geteilt durch 365?»
«Was?»
«Ich meine, was bekommt ein Arbeitsloser am Tag?»
«Ah …» Leistner nickte, paffte. Er nahm einen Stift und rechnete. «Zwei Mark Fuffzig … Warte mal …» Die Qualmwolken wurden dichter. «1670 Mark bekommt der alte Kaiser nach Doorn.»
Der Kaiser in seinem holländischen Exil, wohin er kurz vor Kriegsende getürmt war … Daraus musste sich doch was machen lassen. Katzmann schaute noch einmal auf die Liste, rechnete.
«Guck mal, Eugen. Du machst eine Überschrift: Die Rentenempfänger der Republik – und dann schreibst du die empörendsten Fakten auf …» Katzmann zögerte kurz, rechnete im Kopf weiter und sagte dann: « 1640 Goldmark täglich für den gesunden Deserteur in Doorn – 27 Goldpfennig für den dreißigprozentigen Kriegsverletzten. Das ist der Einstieg, und dann wird man auch neugierig auf die Liste.»
«Und du meinst, den Aufruf und die Theorie mache ich hernach?»
Die Theorie könnte vermutlich ganz wegfallen, dachte Katzmann, nickte aber artig.
«Ist das nicht ein wenig zu plakativ, Genosse Konrad?»
«Mit welchen Mitteln kämpft der Feind, Eugen?»
Leistner schrieb, rauchte und nickte. «Da sagst du eine Wahrheit, Genosse Konrad.» Er schrieb den von Katzmann vorgeschlagenen Satz auf einen Zettel. «Gut, so machen wir es.»
«Dann kann ich mich in den nächsten Tagen auf der Messe umschauen … und mich ein bisschen nach der Blei-Bande umhören.» Katzmann sah, wie Leistner paffte, und merkte, wie der zu murmeln begann, als er anfügte: «Über die Blei-Bande würde ich auch ein paar Zeilen für die morgige Ausgabe schreiben.»
Leistner guckte kurz auf, als wolle er sagen: Du immer mit deinen Kriminalfällen! Dann hielt er das Blatt mit den ersten Worten des morgigen Aufmachers hoch und nickte.
Das Bureau von Herfried Rinke wirkte wie aus einem Museum geklaut. Die Möbel – vom Sekretär über die stoffbezogenen Stühle bis zum Holztisch – schienen mit der Wucht des Neobarock auf dem Teppich mit den goldenen Verzierungen zu lasten.
Heinz Eggebrecht hatte einen kleinen Spaziergang durch die Stadt gemacht, nun würde der Cognac in seinem Glas ihn schon nicht umhauen. Den Schnaps hatte Rinke auf den Tisch gestellt und sich dann für einen Augenblick entschuldigt. Der künstlerische Leiter des Krystall-Palastes stand am Regal neben seinem Schreibtisch und blätterte in einem Buch mit Ledereinband. Wie er vor dem Regal auf die Seiten blickte, erinnerte Rinke an einen Dirigenten, der vor dem Auftritt noch einmal seine Noten studierte. Er trug einen Smoking, der seine hagere Figur unterstrich. Die Haare sahen aus, als sei Rinke direkt nach dem Bad in einen Tornado geraten. Die grauen Strähnen würden sicher bis auf das Revers des Smokings fallen, stünden sie nicht in alle Richtungen vom Kopf ab.
«Wann, sagten Sie, wollen Sie den Termin mit Madame La Belle haben?»
«Wenn es nach mir ginge, so bald wie möglich.» Eggebrecht setzte den Cognacschwenker an und trank einen Schluck. Der Schnaps floss die Kehle hinunter wie warmes Öl. Es kam ihm vor, als schalte sein Gehirn einen Gang herunter. Die ganze Welt schien hinter einem Schleier zu verschwinden – ein gutes Gefühl. Eggebrecht beschloss, diesen Alkoholpegel für den Rest des Tages beizubehalten. Schließlich war Sonntag und somit eigentlich ein freier Tag.
«Hm …» Rinke blätterte in dem Buch, kam zum Tisch und setzte sich. Er blätterte noch eine Seite weiter. «Dienstagvormittag wäre ein guter Zeitpunkt … Da ist keine Probe, und auch sonst stehen keine Termine für Madame an.»
Übermorgen. Eggebrecht überlegte. Einerseits schien ihm das nur mit großzügiger Auslegung unter «so bald wie möglich» zu fallen, andererseits hatte er sich bei seinen Eltern für die ganze Woche eingenistet, und die Messe wollte auch photographiert werden. Und da waren auch noch Katzmann und die Sache mit der Blei-Bande … «Dienstagvormittag würde mir auch passen. Wo könnte ich die Aufnahme machen?»
«Am Dienstag könnten Sie zwischen elf und zwölf Uhr den Varietésaal nutzen.» Rinke trank einen Schluck Cognac. Er beugte dabei den Kopf nach hinten, seine Haarpracht erinnerte an die Borsten eines überdimensionalen Putzgerätes.
«Wo melde ich mich am Dienstag?»
«Sie kommen am besten hier ins Bureau, Herr Eggebrecht. Meine Sekretärin wird sich dann um alles kümmern.»
Sekretärinnen waren immer gut. Eggebrecht hatte in Berlin gelernt, dass Termine am zuverlässigsten eingehalten wurden, wenn eine Tippse sich darum kümmerte. Für Vereinbarungen, die er mit wuschelhaarigen künstlerischen Leitern traf, galt das erfahrungsgemäß in besonderem Maße.
«Kommen Sie, ich stelle Ihnen Fräulein Schneider vor.» Eggebrecht trank seinen Cognac aus und stellte den Schwenker auf den Tisch. Auf dem klobigen Möbel wirkte das Glas wie eine Daunenfeder auf einem Ziegelstein. Er stand auf und folgte Rinke zum Vorzimmer.
Fräulein Schneider und ihre Stupsnase waren ihm schon beim Hereinkommen aufgefallen. Die Tippse trug einen Bubikopf, wie ihn die Mode gerade vorschrieb. Unter dem braunen Pony sausten zwei grasgrüne Augen zwischen den Wimpern hin und her.
«Fräulein Schneider, Herr Eggebrecht wird am Dienstagvormittag kommen, um Madame La Belle abzulichten. Sie werden ihn in den Varietésaal begleiten.»
Fräulein Schneider nickte und zwinkerte Eggebrecht zu, als wolle sie sich mit ihm zur Begehung von kleineren Straftaten verabreden. Oder bildete er sich das nur ein? Eine Welle von Wärme wanderte seinen Hals hinauf.
Rinke verabschiedete sich, verschwand in seinem Bureau und ließ Eggebrecht mit Fräulein Schneider allein.
«Wann darf ich Sie am Dienstag erwarten?»
Am liebsten hätte Eggebrecht gesagt: Wann immer Sie zwinkern, werde ich da sein! Aber erstens traute er sich das nicht, und zweitens wäre es natürlich ein völlig unangemessenes Verhalten. Eggebrecht überlegte kurz, wie viele Liebesbeziehungen entstehen könnten, würden sich die Menschen öfters unangemessen verhalten … Er sagte: «Ich würde kurz vor elf zu Ihnen kommen. Dann könnten Sie mir den Saal und vor allem die Lichtschalter zeigen, bevor Madame La Belle Zeit hat.»
«Ganz ausgezeichnet.» Fräulein Schneider lächelte bei den Worten, als könne sie den Termin kaum erwarten.
Eggebrecht hatte das Gefühl, in seinem Kopf würde etwas schmelzen.
«Sagen Sie, Herr Eggebrecht, Sie waren doch gestern Abend im Konzert von Frau La Belle.»
Das klang nicht wie eine Frage, aber Eggebrechts weiche Birne nickte.
«Und Sie waren mit Herrn Katzmann da.»
Schon wieder keine Frage. Der Kopf nickte weiter, allerdings wurde der Brei im Innern etwas härter.
«Sehen Sie Herrn Katzmann öfters?»
«Hm.» Dieses Gespräch nahm keinen guten Weg, dachte Eggebrecht und fragte: «Kennen Sie ihn gut?»
«Nun ja …» Fräulein Schneider guckte zur Decke. Offenbar dachte sie nach, jedenfalls sah sie hinreißend aus. Sie sagte: «Ich habe viel von ihm gehört. Meine beste Freundin … stand ihm einmal … sehr nahe.»
Stötzenau saß schon in den Bacchusstuben, als Katzmann im Krystall-Palast ankam. Der Reporter zog seine Uhr aus der Tasche – nein, es war kurz vor zehn und er pünktlich. Stötzenau hatte in der Redaktion angerufen und den Termin zu nachtschlafender Zeit vorgeschlagen. Er könne ihm eine interessante Person vorstellen, einen Mann, der eventuell etwas über die Blei-Bande wüsste.
«Guten Abend, Herr Katzmann. Nehmen Sie einen Wein, der Meißner hier ist vorzüglich.»
«Gern», sagte Katzmann, obwohl ihm die bürgerlichen Rituale mit zunehmendem Alter immer mehr auf die Nerven gingen, besonders am späten Abend. Er könnte jetzt gut im Bett liegen, anstatt mit einem Mann, der ihm nicht besonders sympathisch war, Belanglosigkeiten über regionale Weine auszutauschen.
Stötzenau schenkte Katzmann ein, dabei sagte er: «Ein ausgezeichneter Jahrgang. Besonders die Fruchtnote im Abgang … So einen Tropfen muss man getrunken haben.»
Die Fruchtnote im Abgang, solche Sachen hatte sein Vater auch immer palavert. Katzmann erinnerte sich an Gespräche, bei denen er zum Schein darauf eingegangen war und von erdhafter Note und schattigem Nachtrag redete, bis sein Vater merkte, dass er veralbert wurde. Den Vater machte das stets wütend. Humor war nicht die Stärke des Großbürgertums.
Jetzt wollte Katzmann keinen Ärger, sondern Informationen, also trank er und nickte. Der Wein schmeckte ihm, wenigstens das. Er versuchte, die Vorrede zu beenden, und fragte: «Vielleicht können Sie mich etwas vorbereiten. Wen erwarten wir denn?»
«Oh, das hatte ich am Telephon gar nicht erwähnt?» Stötzenau trank einen Augenblick, wohl um die Spannung zu steigern.
«Siegbert Wulpius wird uns gleich die Ehre erweisen.»
Wulpius, den Namen hatte Katzmann schon einmal gehört – aber wo? Sicher in der Redaktion, das Ressort fiel ihm nicht ein …
«Siggi, so nennen ihn seine Freunde, weiß alles über Leipzigs …», Stötzenau suchte nach einem Wort, schien keines zu finden, «… Leben. Wenn Sie wissen, was ich meine …»
Nein, Katzmann wusste nicht, was Stötzenau ihm sagen wollte. Die Unterwelt? Die Kriminellen? Nun, das musste er selbst herausfinden. Also nickte er und fragte: «Wie kommt Herr Wulpius zu seinen Kenntnissen?»
«Siggi ist sehr umtriebig. Er macht vielfältige … Geschäfte.» Stötzenau schien nachzudenken, wie er das konkretisieren konnte. Er wurde erlöst. «Ah, da kommt er.»
Vom Eingang der Bacchusstuben schleppte sich ein Mann heran. Katzmann schätzte ihn auf 160 Zentimeter hoch und 160 Kilogramm schwer. Von weitem sah es aus, als würde ein Mühlstein im Anzug durch die Gaststube walzen. Offenbar nahm der Mann schneller zu, als sein Schneider Anzüge fertigen konnte. Der Zweireiher kam nicht von der Stange, glänzte wie frisch aus der Werkstatt, warf aber in der Bauchgegend horizontale Falten.
«Siggi, schön, dass du kommen konntest!» Stötzenau wies mit der Hand zu Katzmann. «Das ist der Reporter, den ich am Fernsprecher erwähnt habe. Katzmann, Konrad Katzmann. Von der Leipziger Volkszeitung.»
Wulpius wuchtete sich auf den Stuhl, wobei er kaum an Höhe abnahm. Er bekam Wein und sagte: «Ah, der Meißner. Sehr gut, Theo.» Dann drehte er sich zu Katzmann und erklärte: «Mir gehören ein paar Weinberge in der Gegend. Ich komme leider nur noch selten hin, aber meine Winzer leisten ganze Arbeit. Finden Sie nicht?»
Schon wieder Weingespräche! «In der Tat ein guter Wein», sagte Katzmann.
«Ah, der Dialekt. Sie kommen aus der Dresdner Ecke. Da ist das bei Ihnen sicher ein Hauswein. Oder trinkt man in Ihren Kreisen andere Getränke?»
Der Bürgerdünkel. Katzmann erlebte das als LVZ Redakteur so oft, dass er sich nicht mal mehr darüber ärgerte. «Nein, nein, ich trinke gerne Wein. Und ja, in meinem Elternhaus stehen Weine vom Elbufer hoch im Kurs.»
Wulpuis nickte und trank noch einen Schluck.
«Siggi, Herr Katzmann hat mich heute Morgen nach der Blei-Bande gefragt …»
«Ja, ja, während der Messe passieren die verrücktesten Sachen in der Stadt. Meine Oma sagte immer: Messezeit ist Kanaillenzeit. Alle werden plötzlich aktiv …»
Katzmann lag die Frage auf der Zunge, welche Aktivitäten Wulpius umtreiben. Aber der schien in Plauderlaune, da wollte er nicht unterbrechen.
«Der gute Theo macht seine Mark mit der Messe, ich habe ein wenig Geld in die Konzertreihe der guten Bernadette La Belle gesteckt … Haben Sie sie schon gesehen?»
«Ja, gerade gestern. Unsere Kulturredaktion wird auch einen Artikel schreiben.»
«Vortrefflich.» Wulpius spülte die Worte mit einem Schluck Wein hinunter, so dass etwas unklar wurde, ob er den anstehenden LVZ Beitrag oder sein Getränk meinte. «Darf ich fragen, was Sie mit der Blei-Bande zu tun haben? Die Arbeiterpresse hat für gewöhnlich andere Sorgen …»
«Nun, mein Chefredakteur sagt immer, man solle das Große und Ganze betrachten. Da ist die Blei-Bande sicher von minderer Bedeutung. Ich interessiere mich dennoch für sie. Ich habe gestern eine Botschaft von einem Doktor Blei erhalten.»
«Gestern?» Wulpius zog eine Augenbraue nach oben.
«Spät am Abend.»
«Dann geht das alles wieder los …» Der dicke Mann schien im Polster zu versinken.
«Was geht wieder los, Herr Wulpius?»
«Herr Katzmann … Ich weiß nicht, was die Botschaft beinhaltete, aber ich kann Ihnen nur den dringenden Rat geben, etwaige Anweisungen auf das Genaueste zu befolgen.» Wulpius sprach leise weiter. «Und die Polizei würde ich an Ihrer Stelle nicht mit Einzelheiten behelligen.»